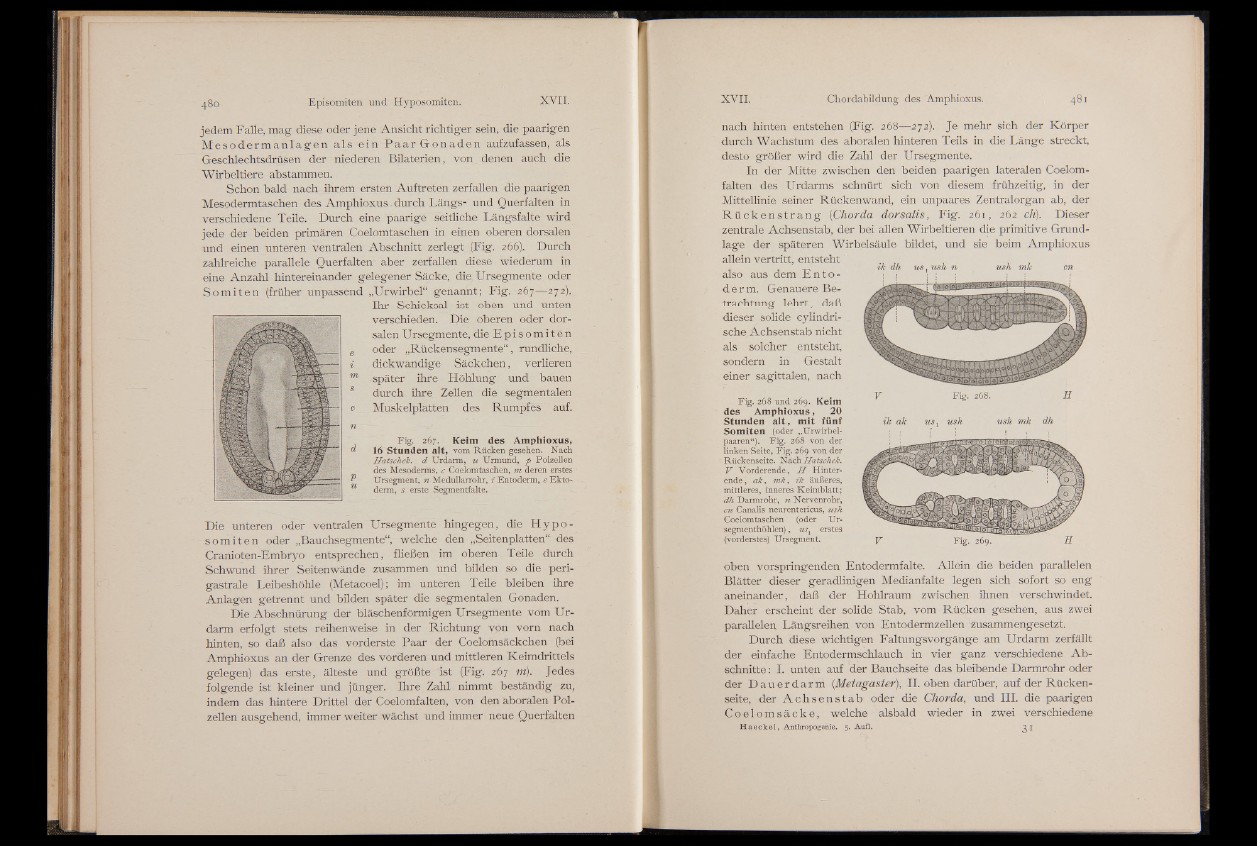
jedem Falle, mag diese oder jene Ansicht richtiger sein, die paarigen
Me sode rmanlag en als ein Paa r Gonaden aufzufassen, als
Geschlechtsdrüsen der niederen Bilaterien, von denen auch die
Wirbeltiere abstammen.
Schon bald nach ihrem ersten Auftreten zerfallen die paarigen
Mesodermtaschen des Amphioxus. durch Längs- und Querfalten in
verschiedene Teile. Durch eine paarige seitliche Längsfalte wird
jede der beiden primären Coelomtaschen in einen oberen dorsalen
und einen unteren ventralen Abschnitt zerlegt (Fig. 266).’ Durch
zahlreiche parallele Querfalten' aber zerfallen diese wiederum in
eine Anzahl hintereinander gelegener Säcke, die Ursegmente oder
Somi ten (früher unpassend „Urwirbel“ genannt; Fig. 267-^272),
Ihr Schicksal ist oben und unten
verschieden. Die oberen oder dorsalen
Ursegmente, die Episomi ten
oder „Rückensegmente“ , rundliche,
dickwandige Säckchen, verlieren
später ihre Höhlung und bauen
durch ihre Zellen die segmentalen
Muskelplatten des Rumpfes auf.
Fig. 267. Keim des Amphioxus, 16 Stunden alt, vom Rücken gesehen. Nach
Hatschek. d Urdarm, u TJrmimd, p Polzellen
des Mesoderms, c Coelomtaschen, m deren erstes
Ursegment, n Medullarrohr, i Entoderm, e Ekto-,
derm, ^ erste Segmentfalte.
Die unteren oder ventralen Ursegmente hingegen, die Hypo-
somi t en oder „Bauchsegmente“, welche den „Seitenplatten“ des
Cranioten-Embryo entsprechen, fließen im oberen Teile durch
Schwund ihrer Seitenwände zusammen und bilden so die peri-
gastrale Leibeshöhle (Metacoel); im unteren Teile bleiben ihre
Anlagen getrennt und bilden später die segmentalen Gonaden.
Die Abschnürung der bläschenförmigen Ursegmente vom Urdarm
erfolgt stets reihenweise in der Richtung von vorn nach
hinten, so daß also das vorderste Paar der Coelomsäckchen (bei
Amphioxus an der Grenze des vorderen-und mittleren Keimdrittels
gelegen) das erste, älteste und größte Ist (Fig. 267 m). Jedes
folgende ist kleiner und jünger. Ihre Zahl nimmt beständig zu,
indem das hintere Drittel der Coelomfalten, von den ‘aboralen Polzellen
ausgehend, immer weiter wächst und immer neue Querfalten
nach hinten entstehen (Fig. 268^272). Je mehr sich der Körper
durch Wachstum des aboralen hinteren Teils in die Länge streckt,
desto größer wird die Zahl der Ursegmente.
In der Mitte zwischen den beiden paarigen lateralen Coelomfalten
des Urdarms schnürt sich von diesem frühzeitig, in der
Mittellinie seiner Rückenwand, ein unpaares Zentralorgan ab, der
R ü c k e n s t r a n g (Chorda dorsalis, Fig. 261, 262 ch). Dieser
zentrale Achsenstab, der bei allen Wirbeltieren die primitive Grundlage
der späteren Wirbelsäule bildet, und sie beim Amphioxus
allein vertritt, entsteht
also aus dem Ento -
d e r m. Genauere Betrachtung
lehrt, daß
dieser solide cylindri-
sche Achsenstab nicht
als solcher entsteht,
sondern in Gestalt
einer sagittalen, nach
Fig. 268 und 269. Keim
des Amphioxus, 20
Stunden a lt, mit fünf
Somiten (oder „Urwirbel-
paaren“). Fig. 268 von der
linken Seite, Fig. 269 von der
Rückenseite. Nach Hatschek.
V Vorderende, H Hinterende,
a k, m k, ik äußeres,
mittleres, inneres Keimblatt;
dh Dannrohr, n Nervenrohr,
cn Canalis neurentericus, ush
Coelomtaschen (oder Ur-
segmenthöhlen), u s, erstes
(vorderstes) Ursegment.
Fig. 268.
oben vorspringenden Entodermfalte. Allein die beiden parallelen
Blätter dieser geradlinigen Medianfalte legen sich sofort so eng
aneinander, daß der Hohlraum zwischen ihnen verschwindet.
Daher erscheint der solide Stab, vom Rücken gesehen, aus zwei
parallelen Längsreihen von Entodermzellen zusammengesetzt.
Durch diese wichtigen Faltungsvorgänge am Urdarm zerfällt
der einfache Entodermschlauch in vier ganz verschiedene Abschnitte
; I. unten auf der Bauchseite das bleibende Darmrohr oder
der Dauerdar ir i (Metagaster), II. oben darüber, auf der Rückenseite,
der Achs ens t ab oder die Chorda, und III. die paarigen
Coe lomsä cke , welche alsbald wieder in zwei verschiedene
H a e c k e l , Anthropogenie. 5* A u fl. ß j