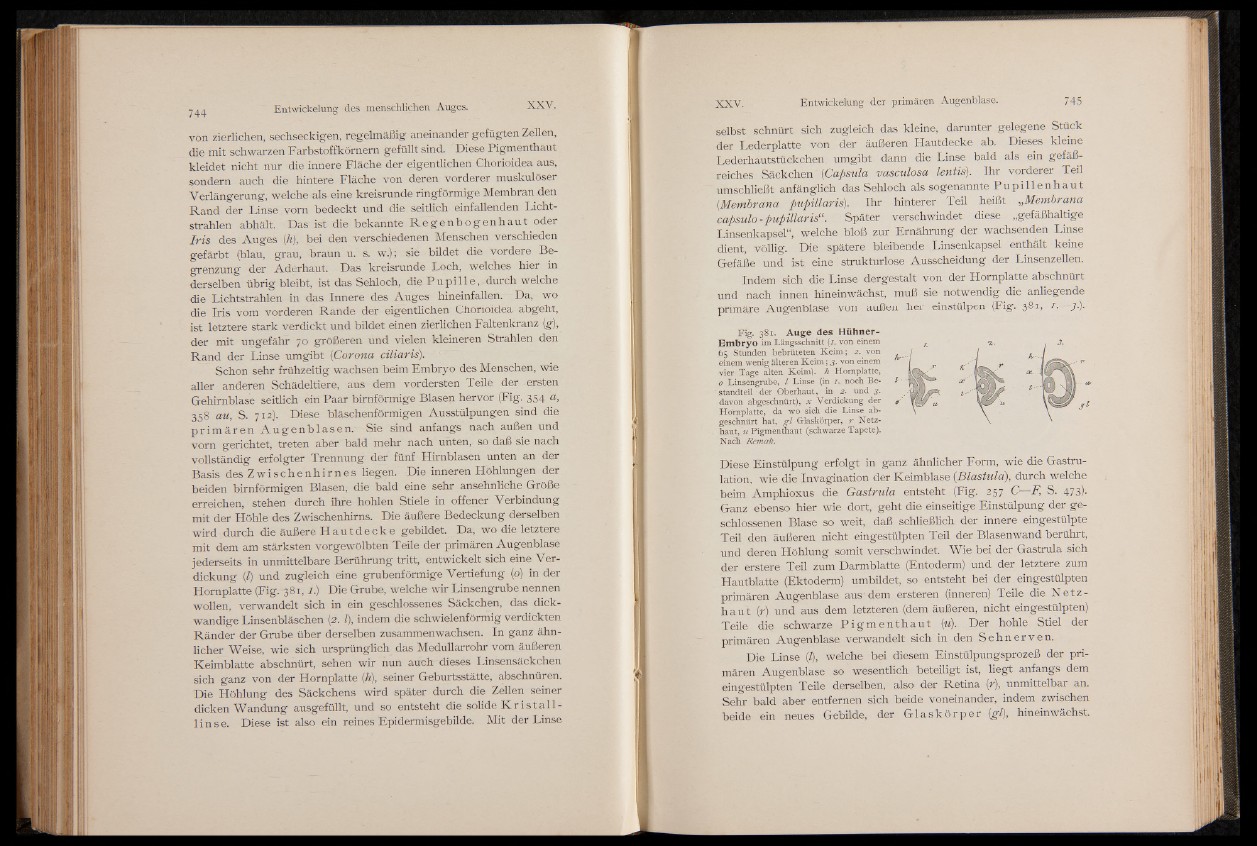
von zierlichen, sechseckigen, regelmäßig aneinander gefügten Zellen,
die mit schwarzen Farbstoffkörnern gefüllt sind. Diese Pigmenthaut
kleidet nicht nur die innere Fläche der eigentlichen Chorioidea aus,
sondern auch die hintere Fläche von deren vorderer muskulöser
Verlängerung, welche als eine kreisrunde ringförmige Membran den
Rand der Linse vorn bedeckt und die seitlich einfallenden Lichtstrahlen
abhält. Das ist die bekannte Re g en b o g e nh a u t oder
Iris des Auges {hu bei den verschiedenen Menschen verschieden
gefärbt (blau, grau, braun u. s. w.); sie bildet die vordere Begrenzung
der Aderhaut. Das kreisrunde Loch, welches hier in
derselben übrig bleibt, ist das Sehloch, die Pupi l l e , durch welche
die Lichtstrahlen in das Innere des Auges hineinfallen. Da, wo
die Iris vom vorderen Rande der eigentlichen Chorioidea abgeht,
ist letztere stark verdickt und bildet einen zierlichen Faltenkranz (g),
der mit ungefähr 70 größeren und vielen kleineren Strahlen den
Rand der Linse umgibt (Corona ciliaris).
Schon sehr frühzeitig wachsen beim Embryo des Menschen, wie
aller anderen Schädeltiere, aus dem vordersten Teile der ersten
Gehirnblase seitlich ein Paar bimförmige Blasen hervor (Fig. 354 a,
358 au, S. 712). Diese bläschenförmigen Ausstülpungen sind die
pr imären A u gen bl äsen. Sie sind anfangs nach außen und
vom gerichtet, treten aber bald mehr nach unten, so daß sie nach
vollständig erfolgter Trennung der fünf Himblasen unten an der
Basis des Zwi s chenhi rne s liegen. Die inneren Höhlungen der
beiden bimförmigen Blasen, die bald eine sehr ansehnliche Größe
erreichen, stehen durch ihre hohlen Stiele in offener Verbindung
mit der Höhle des Zwischenhirns. Die äußere Bedeckung derselben
wird durch die äußere Hau td e ck e gebildet. Da, wo die letztere
mit dem am stärksten vorgewölbten Teile der primären Augenblase
jederseits in unmittelbare Berührung tritt, entwickelt sich eine Verdickung
(/) und zugleich eine grubenförmige Vertiefung (0) in der
Homplatte (Figr38i, I.) Die Grube, welche wir Linsengrube nennen
wollen, verwandelt sich in ein geschlossenes Säckchen, das dickwandige
Linsenbläschen (2. I), indem die schwielenförmig verdickten
Ränder der Grube über derselben zusammenwachsen. In ganz ähnlicher
Weise, wie sich ursprünglich das Medullarrohr vom äußeren
Keimblatte abschnürt, sehen wir nun auch dieses Linsensäckchen
sich ganz von der Hornplatte (h), seiner Geburtsstätte, abschnüren.
Die Höhlung des Säckchens wird später durch die Zellen seiner
dicken Wandung ausgefüllt, und so entsteht die solide K r i s t a l l l
inse. Diese ist also ein reines Epidermisgebilde. Mit der Linse
selbst schnürt sich zugleich das kleine, darunter gelegene Stück
der Lederplatte von der äußeren Hautdecke ab. Dieses kleine
Lederhautstückchen umgibt dann die Linse bald als ein gefäßreiches
Säckchen (Capsula vasculosa lentis). Ihr vorderer Teil
umschließt anfänglich das Sehloch als sogenannte Pupi l lenhaut
(Membrana pupillaris). Ihr hinterer Teil heißt „Membrana
capsulo -pupillaris“ . Später verschwindet diese „gefäßhaltige
Linsenkapsel“, welche bloß zur Ernährung der wachsenden Linse
dient, völlig. Die spätere bleibende Linsenkapsel enthält keine
Gefäße und ist eine strukturlose Ausscheidung der Linsenzellen.
Indem sich die Linse dergestalt von der Homplatte abschnürt
und nach innen hineinwächst, muß sie notwendig die anliegende
primäre Augenblase von außen her einstülpen (Fig. 381, /g~t.).
Fig. 381. Auge des Hühner-
Embryo im Längsschnitt (/. von einem
65 Stunden bebrüteten Keim; 2. von
einem wenig älteren Keim; 3. von einem
vier .Tage alten Keim), h Homplatte,
0 Linsengrube, l Linse (in i._ noch Be-
■ stand teil der Oberhaut, in 2. und 3.
davon abgeschnürt), x Verdickung der
Homplatte, da wo sich die Linse abgeschnürt
hat, g l Glaskörper, r Netzhaut,
u Pigmenthaut (schwarze Tapete).
Nach Remak.
Diese Einstülpung erfolgt in ganz ähnlicher Form, wie die Gastru-
lation, wie die Invagination der Keimblase (Blastula), durch welche
beim Amphioxus die Gastrula entsteht (Fig. 257 C—F, S. 473).
Ganz ebenso hier wie dort, geht die einseitige Einstülpung der geschlossenen
Blase so weit, daß schließlich der innere eingestülpte
Teil den äußeren nicht eingestülpten Teil der Blasenwand berührt,
und deren Höhlung somit verschwindet. Wie bei der Gastrula sich
der erstere Teil zum Darmblatte (Entoderm) und der letztere zum
Hautblatte (Ektoderm) umbildet, so entsteht bei der eingestülpten
primären Augenblase aus dem ersteren (inneren) Teile die Ne t z haut
(r) und aus dem letzteren (dem äußeren, nicht eingestülpten)
Teile die schwarze Pigmen th a u t («). Der hohle Stiel der
primären Augenblase verwandelt sich in den Sehnerven.
Die Linse (/), welche bei diesem Einstülpungsprozeß der primären
Augenblase so wesentlich beteiligt ist, liegt anfangs dem
eingestülpten Teile derselben, also der Retina (r), unmittelbar an.
Sehr bald aber entfernen sich beide voneinander, indem zwischen
beide ein neues Gebilde, der Gla skö rpe r (gl), hineinwächst.