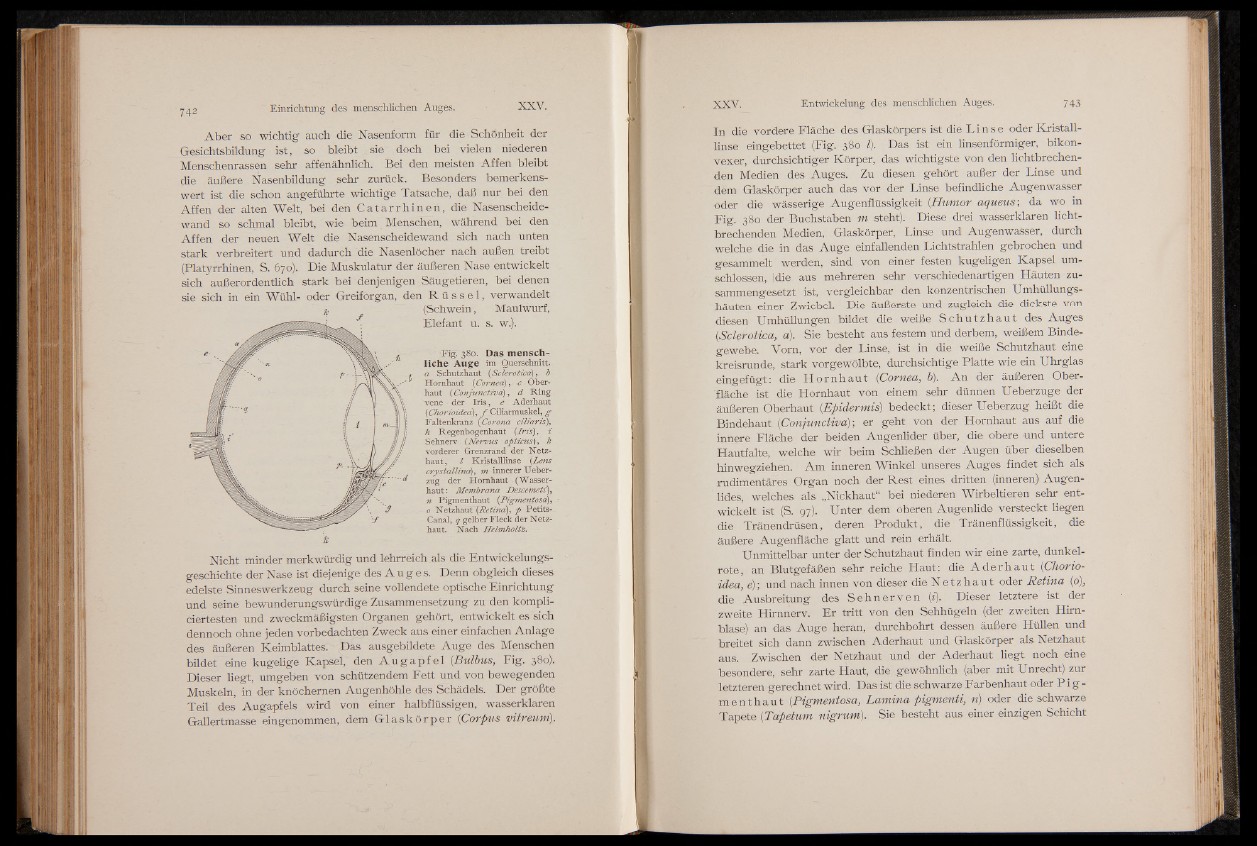
Aber so wichtig auch die Nasenform für die Schönheit der
Gesichtsbildung ist, so bleibt sie doch bei vielen niederen
Menschenrassen sehr affenähnlich. Bei den meisten Affen bleibt
die äußere Nasenbildung sehr zurück. Besonders bemerkenswert
ist die schon angeführte wichtige Tatsache, daß nur bei den
Affen der alten Welt, bei den Catar rhinen, die Nasenscheidewand
so schmal bleibt, wie beim Menschen, während bei den
Affen der neuen Welt die Nasenscheidewand sich nach unten
stark verbreitert und dadurch die Nasenlöcher nach außen treibt
(Platyrrhinen, S. 670), Die Muskulatur der äußeren Nase entwickelt
sich außerordentlich stark bei denjenigen Säugetieren, bei denen
sie sich in ein Wühl- oder Greiforgan, den R ü s s e l , verwandelt
(Schwein, Maulwurf,
Elefant u. s. w.)V
| "F ig . 380. Das menschliche
Auge im Querschnitt.
a Schutzhaut [Sclerotica), b
Hornhaut [Cornea) , c Oberhaut
(Conjunctiva) , d Ring
Vene der Iris, e Aderhaut
(Chorioidea), ƒ Ciliarmuskel, g
Faltenkranz (Corona cilia r is),
h Regenbogenhaut {Iris), i
Sehnerv (N ervus opticus), k
vorderer Grenzrand der Netzhaut,
l Kristalllinse [Lens
crystallina:), m innerer Ueber-
zug der Hornhaut (Wasserhaut
: Membrana Descemeti),
n Pigmenthaut (Pigmentosa),
0 Netzhaut [Retina), p Petits-
Canal, q gelber Fleck der Netzhaut.
Nach Helmholtz.
Nicht minder merkwürdig und lehrreich als die Entwickelungsgeschichte
der Nase ist diejenige des A u g e s. Denn obgleich dieses
edelste Sinneswerkzeug durch seine vollendete optische Einrichtung
und seine bewunderungswürdige Zusammensetzung zu den kompli-
ciertesten und zweckmäßigsten Organen gehört, entwickelt es sich
dennoch ohne jeden vorbedachten Zweck aus einer einfachen Anlage
des äußeren Keimblattes. Das ausgebildete Auge des Menschen
bildet eine kugelige Kapsel, den A u g a p f e l {Bulbus, Fig. 380).
Dieser liegt, umgeben von schützendem Fett und von bewegenden
Muskeln, in der knöchernen Augenhöhle des Schädels. Der größte
Teil des Augapfels wird von einer halbflüssigen, wasserklaren
Gallertmasse eingenommen, dem Glaskö rpe r {Corpus vitreum).
In die vordere Fläche des Glaskörpers ist die Linse oder Kristalllinse
eingebettet (Fig. 380 l). Das ist ein linsenförmiger, bikonvexer,
durchsichtiger Körper, das wichtigste von den lichtbrechenden
Medien des Anges. Zu diesen gehört außer der Linse und
dem Glaskörper auch das vor der Linse befindliche Augenwasser
oder die wässerige Augenflüssigkeit {Humor aqueus-, da wo in
Fig. 380 der Buchstaben m steht); Diese drei wasserklaren lichtbrechenden
Medien, Glaskörper, Linse und Augenwasser, durch
welche die in das Auge einfallenden Lichtstrahlen gebrochen und
gesammelt werden, sind von einer festen kugeligen Kapsel umschlossen,
Idle aus mehreren sehr verschiedenartigen Häuten zusammengesetzt
ist, vergleichbar den konzentrischen Umhüllungshäuten
einer Zwiebel. Die äußerste und zugleich die dickste von
diesen Umhüllungen bildet die weiße Schut zhaut des Auges
{Sclerotien, a). Sie besteht aus festem und derbem, weißem Binde-
gewebe. Vbrn, vor der Linse, ist m die weiße Schutzhaut eine
kreisrunde, stark vorgewölbte, durchsichtige Platte wie ein Uhrglas
eingefügt: die Hornhaut {Cornea, b). An der äußeren Oberfläche
ist die Hornhaut von einem sehr dünnen Ueberzuge der
äußeren Oberhaut {Epidermis) bedeckt; dieser Ueberzug heißt die
Bindehaut {Conjunctiva); er geht von der Hornhaut aus auf die
innere Fläche der beiden Augenlider über, die obere und untere
Hautfalte, welche wir beim Schließen der Augen über dieselben
hinwegziehen. Am inneren Winkel unseres Auges findet sich als
rudimentäres Organ noch der Rest eines dritten (inneren) Augenlides,
welches als „Nickhaut“ bei niederen Wirbeltieren sehr entwickelt
ist (S. 97). Unter dem oberen Augenlide versteckt liegen
die Tränendrüsen, deren Produkt, die Tränenflüssigkeit, die
äußere Augenfläche glatt und rein erhält.
Unmittelbar unter der Schutzhaut finden wir eine zarte, dunkelrote,
an Blutgefäßen sehr reiche Haut: die Ade r haut {Chorioidea,
e); und nach innen von dieser die Net zhaut oder Retina (o),
die Ausbreitung des Sehne r ven (i). Dieser letztere ist der
zweite Hirnnerv. Er tritt von den Sehhügeln (der zweiten Hirnblase)
an das Auge heran, durchbohrt dessen äußere Hüllen und
breitet sich dann zwischen Aderhaut und Glaskörper als Netzhaut
aus. Zwischen der Netzhaut und der Aderhaut liegt noch eine
besondere, sehr zarte Haut, die gewöhnlich (aber mit Unrecht) zur
letzteren gerechnet wird. Das ist die schwarze Farbenhaut oder P i g menthaut
{Pigmentosa, Lamina pigmenti, n) oder die schwarze
Tapete {Tapetum nigrum)^: Sie besteht aus einer einzigen Schicht