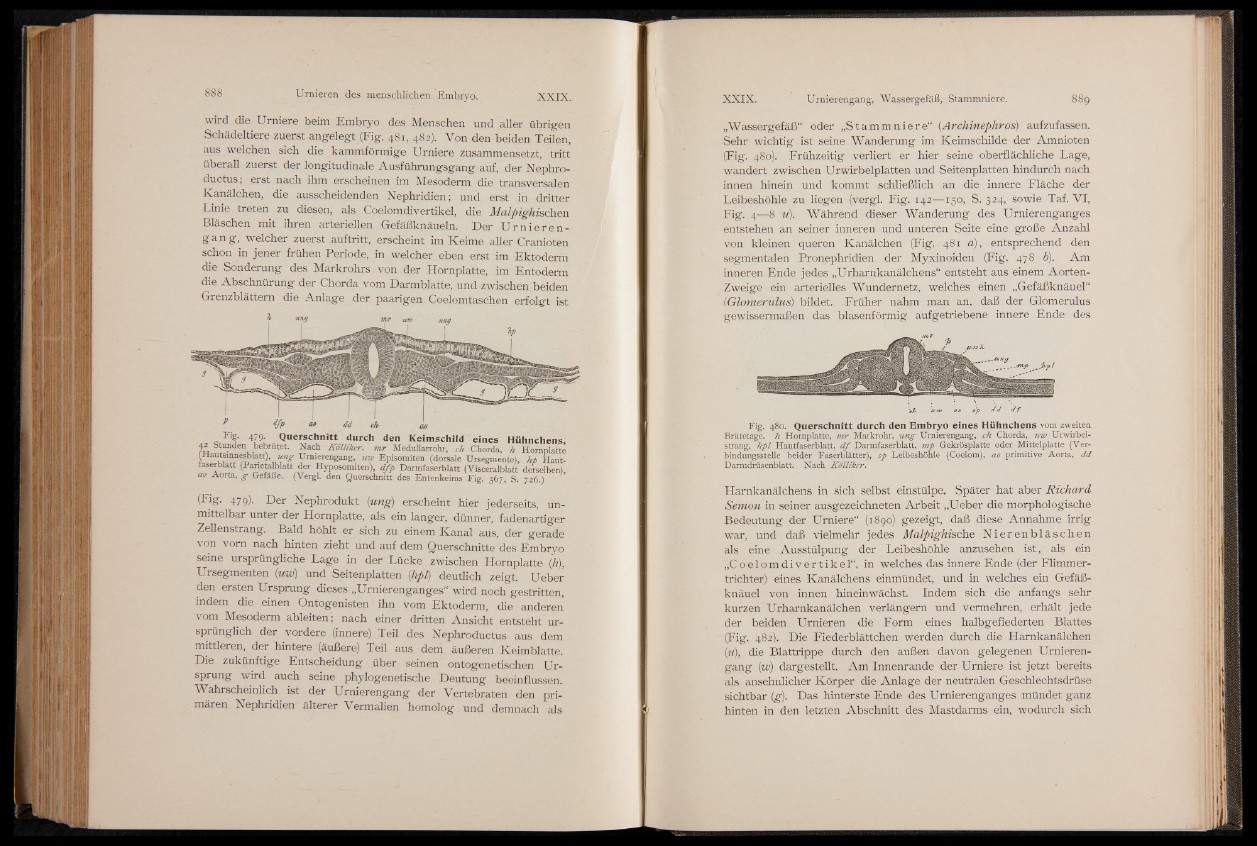
888 Urn ie re n des menschlichen Embryo. X X I X .
wird die Urniere beim Embryo des Menschen und aller übrigen
Schädeltiere zuerst angelegt (Fig. 481, 482). Von den beiden Teilen,
aus welchen sich die kammförmige Urniere zusammensetzt, tritt
überall zuerst der longitudinale Ausführungsgang auf, der Nephro-
ductus; erst nach ihm erscheinen im Mesoderm die transversalen
Kanälchen, die ausscheidenden Nephridien; und erst in dritter
Linie treten zu diesen, als Coelomdivertikel, die .1/uipig/zischet 1
Bläschen mit ihren arteriellen Gefäßknäueln. Der Urnier en-
gang , welcher zuerst auftritt, erscheint im Keime aller Cranioten
schon in jener frühen Periode, in welcher eben erst im Ektoderm
die Sonderung des Markrohrs von der Hornplatte, im Entoderm
die Abschnürung der Chorda vom Darmblatte, und zwischen beiden
Grenzblättern die Anlage der paarigen Coelomtaschen erfolgt ist
Fi§- 479- Querschnitt durch den Keimschild eines Hühnchens,
42 Stunden bebrütet. Nach K S llik er. mr Medullarrohr, ch Chorda, h Hornplatte
(Hautsinnesblatt), un g Urnierengang, uw Episomiten (dorsale Ursegmente), h f Haut-
taserblatt (Panetalblatt der Hyposomiten), ä f f Darmfaserblatt (Visceralblatt derselben),
ao - orta’ g Gefäße. (Yergl. den Querschnitt des Entenkeims Fig. 367, S. 726.)
(Fig. 479). Der Nephrodukt {ung) erscheint hier jederseits, unmittelbar
unter der Hornplatte, als ein langer, dünner, fadenartiger
Zellenstrang. Bald höhlt er sich zu einem Kanal aus, der gerade
von vom nach hinten zieht und auf dem Querschnitte des Embryo
seine ursprüngliche Lage in der Lücke zwischen Hornplatte (7z),
Ursegmenten {uw) und Seitenplatten {hfl) deutlich zeigt. Ueber
den ersten Ursprung dieses „Urnierenganges“ wird noch gestritten,
indem die einen Ontogenisten ihn vom Ektoderm, die anderen
vom Mesoderm ableiten; nach einer dritten Ansicht entsteht ursprünglich
der vordere (innere) Teil des Nephroductus aus dem
mittleren, der hintere (äußere) Teil aus, dem äußeren Keimblatte.
Die zukünftige Entscheidung über seinen ontogenetischen Ursprung
wird auch seine phylogenetische Deutung beeinflussen.
Wahrscheinlich ist der Urnierengang der Vertebraten den primären
Nephridien älterer Vermalien homolog und demnach als
X X I X . Urnierengang, Wassergefäß, Stammniere.
„Wassergefäß“ oder „Stammniere“ (Archinephros) aufzufassen.
Sehr wichtig ist seine Wanderung im Keimschilde der Amnioten
(Fig. 480). Frühzeitig verliert er hier seine oberflächliche Lage,
wandert zwischen Urwirbelplatten und Seitenplatten hindurch nach
innen hinein und kommt schließlich an die innere Fläche der
Leibeshöhle zu liegen (vergl. Fig. 142-^150, S. 324, sowie Taf. VI,
Fig. 4—8 u). Während dieser Wanderung des Urnierenganges
entstehen an seiner inneren und unteren Seite eine große Anzahl
von kleinen queren Kanälchen (Fig. 481 a), entsprechend den
segmentalen Pronephridien der Myxinoiden (Fig. 478 b). Am
inneren Ende jedes „Urharnkanälchens“ entsteht aus einem Aorten-
Zweige ein arterielles Wundernetz, welches einen „Gefäßknäuel“
(<Glomerulus) bildet. Früher nahm man an, daß der Glomerulus
gewissermaßen das blasenförmig aufgetriebene innere Ende des
'eh Irt» ao op tf'd J f
Fig. 480. Querschnitt durch den Embryo eines Hühnchens vom zweiten
Brütetage, h Hornplatte, mr Markrohr, ung Urnierengang, ch Chorda, uw Urwirbel-
strang, h p l Hautfaserblatt, d f Darmfaserblatt, mp Gekrösplatte oder Mittelplatte (Verbindungsstelle
beider Faserblätter), sp Leibeshöhle (Coelom), ao primitive Aorta, dd
Darmdrüsenblatt. Nach K ö llik cr.
Harnkanälchens in sich selbst einstülpe. Später hat aber Richard
Semon in seiner ausgezeichneten Arbeit „Ueber die morphologische
Bedeutung der Urniere“ (1890) gezeigt, daß diese Annahme irrig
war, und daß vielmehr jedes Malpighische Nie r enbläs chen
als eine Ausstülpung der Leibeshöhle anzusehen ist, als ein
„Co e lomdive r t ike l “, in welches das innere Ende (der Flimmertrichter)
eines Kanälchens einmündet, und in welches ein Gefäßknäuel
von innen hirieinwächst. Indem sich die anfangs sehr
kurzen Urharnkanälchen verlängern und vermehren, erhält jede
der beiden Urnieren die Form eines halbgefiederten Blattes
(Fig. 482). Die Fiederblättchen werden durch die Harnkanälchen
(m), die Blattrippe durch den außen davon gelegenen Urnierengang
[w) dargestellt. Am Innenrande der Urniere ist jetzt bereits
als ansehnlicher Körper die Anlage der neutralen Geschlechtsdrüse
sichtbar {g). Das hinterste Ende des Urnierenganges mündet ganz
hinten in den letzten Abschnitt des Mastdarms ein, wodurch sich