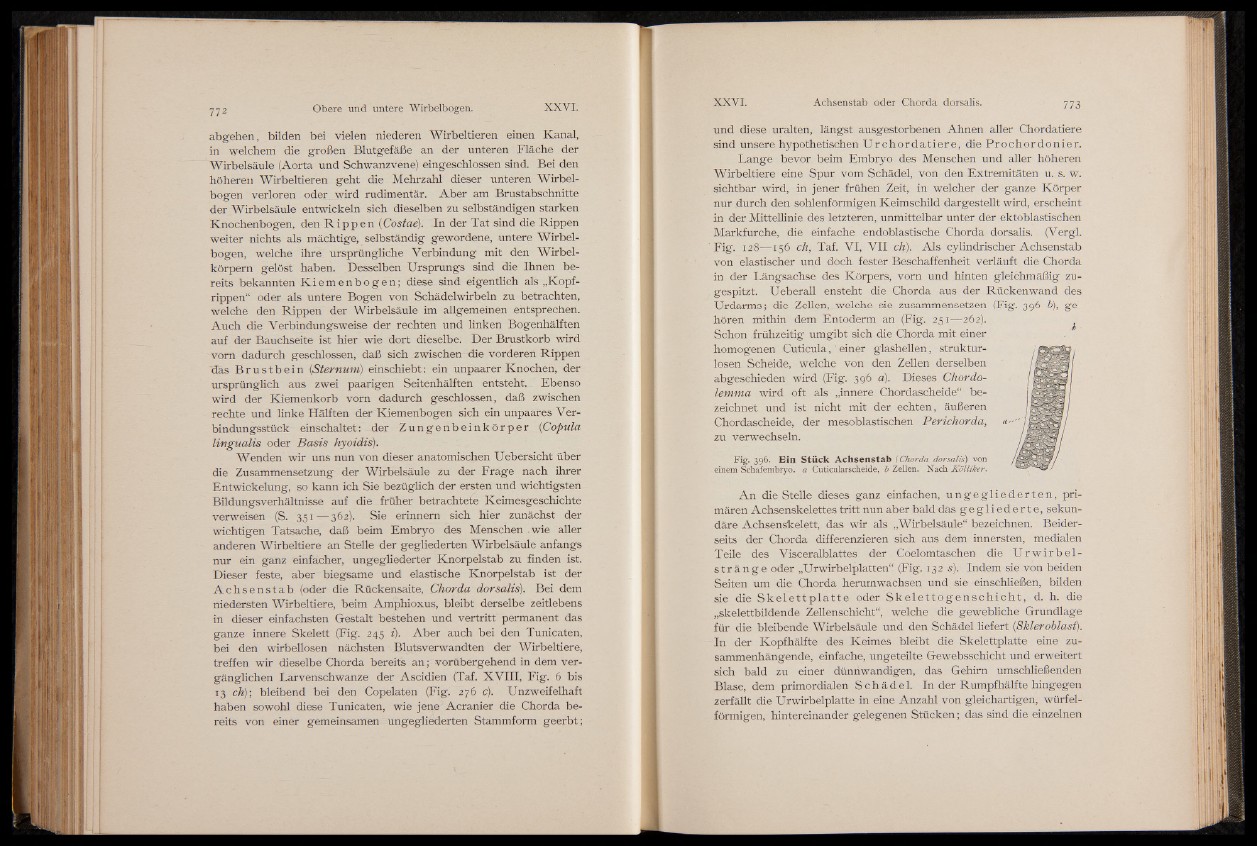
abgehen, bilden bei vielen niederen Wirbeltieren einen Kanal,
in welchem die großen Blutgefäße an der unteren Fläche der
Wirbelsäule (Aorta und Schwanzvene) eingeschlossen sind. Bei den
höheren Wirbeltieren geht die Mehrzahl dieser unteren Wirbelbogen
verloren oder wird rudimentär. Aber am Brustabschnitte
der Wirbelsäule entwickeln sich dieselben zu selbständigen starken
Knochenbogen, den Rip pen (Costae). In der Tat sind die Rippen
weiter nichts als mächtige, selbständig gewordene, untere Wirbelbogen,
welche ihre ursprüngliche Verbindung mit den Wirbelkörpern
gelöst haben. Desselben Ursprungs sind die Ihnen bereits
bekannten Ki emenbo g en; diese sind eigentlich als „Kopf-
rippen“ oder als untere Bogen von Schädelwirbeln zu betrachten,
welche den Rippen der Wirbelsäule im allgemeinen entsprechen.
Auch die Verbindungsweise der rechten und linken Bogenhälften
auf der Bauchseite ist hier wie dort dieselbe. Der Brustkorb wird
vorn dadurch geschlossen, daß sich zwischen die vorderen Rippen
das Brus tbe in (Sternum) einschiebt: ein unpaarer Knochen, der
ursprünglich aus zwei paarigen Seitenhälften entsteht. Ebenso
wird der Kiemenkorb vorn dadurch geschlossen, daß zwischen
rechte und linke Hälften der Kiemenbogen sich ein unpaares Verbindungsstück
einschaltet: der Zung enb e inkö rpe r (Copula
lingualis oder Basis hyoidis).
Wenden wir uns nun von dieser anatomischen Uebersicht über
die Zusammensetzung der Wirbelsäule zu der Frage nach ihrer
Entwickelung, so kann ich Sie bezüglich der ersten und wichtigsten
Bildungsverhältnisse auf die früher betrachtete Keimesgeschichte
verweisen (S. 351— 362). Sie erinnern sich hier zunächst der
wichtigen Tatsache, daß beim Embryo des Menschen .wie aller
anderen Wirbeltiere an Stelle der gegliederten Wirbelsäule anfangs
nur ein ganz einfacher, ungegliederter Knorpelstab zu finden ist.
Dieser feste, aber biegsame und elastische Knorpelstab ist der
Achs ens t ab (oder die Rückensaite, Chorda dorsalis). Bei dem
niedersten Wirbeltiere, beim Amphioxus, bleibt derselbe zeitlebens
in dieser einfachsten Gestalt bestehen und vertritt permanent das
ganze innere Skelett (Fig. 245 i). Aber auch bei den Tunicaten,
bei den wirbellosen nächsten Blutsverwandten der Wirbeltiere,
treffen wir dieselbe Chorda bereits an; vorübergehend in dem vergänglichen
Larvenschwanze der Ascidien (Taf. XVIII, Fig. 6 bis
13 ch); bleibend bei den Copelaten (Fig. 276 c). Unzweifelhaft
haben sowohl diese Tunicaten, wie jene Acranier die Chorda bereits
von einer gemeinsamen ungegliederten Stammform geerbt;
und diese uralten, längst ausgestorbenen Ahnen aller Chordatiere
sind unsere hypothetischen Urchordatiere, die Prochordonier.
Lange bevor beim Embryo des Menschen und aller höheren
Wirbeltiere eine Spur vom Schädel, von den Extremitäten u. s. w.
sichtbar wird, in jener frühen Zeit, in welcher der ganze Körper
nur durch den sohlenförmigen Keimschild dargestellt wird, erscheint
in der Mittellinie des letzteren, unmittelbar unter der ektoblastischen
Markfurche, die einfache endoblastische Chorda dorsalis. (Vergl.
Fig. 128— 156 ch, Taf. VI, VII ch). Als cylindrischer Achsenstab
von elastischer und doch fester Beschaffenheit verläuft die Chorda
in der Längsachse des Körpers, vorn und hinten gleichmäßig zugespitzt.
Ueberall ensteht die Chorda aus der Rückenwand des
Urdarms; die Zellen, welche sie zusammensetzen (Fig. 396 b), gehören
mithin dem Entoderm an (Fig. 251— 262).
Schon frühzeitig umgibt sich die Chorda mit einer
homogenen Cuticula,' einer glashellen, strukturlosen
Scheide, welche von den Zellen derselben
abgeschieden wird (Fig. 396 «). Dieses Chordo-
lemma wird oft als „innere Chordascheide“ bezeichnet
und ist nicht mit der echten, äußeren
Chordascheide, der mesoblastischen Perichorda, «
zu verwechseln.
F'g- 39^. Ein Stück Achsenstab (Chorda dorsalis) von
einem Schafembryo. a Cuticularscheide, h Zellen. Nach K ö llilier.
An die Stelle dieses ganz einfachen, ung e g l iede r ten, primären
Achsenskelettes tritt nun aber bald das ge gl iede r te , sekundäre
Achsenskelett, das wir als „Wirbelsäule“ bezeichnen. Beiderseits
der Chorda differenzieren sich aus dem innersten, medialen
Teile des Visceralblattes der Coelomtaschen die Urwi rbe l -
s t r äng e oder „Urwirbelplatten“ (Fig. 132 s). Indem sie von beiden
Seiten um die Chorda herum wachsen und sie einschließen, bilden
sie die Sk e l e t tp l a t t e oder Ske l e t to g en s ch i ch t , d. h. die
„skelettbäldende Zellenschicht“, welche die gewebliche Grundlage
für die bleibende Wirbelsäule und den Schädel liefert [Skieroblast).
In der Kopfhälfte des Keimes bleibt die Skelettplatte eine zusammenhängende,
einfache, ungeteilte Gewebsschicht und erweitert
sich bald zu einer dünnwandigen, das Gehirn umschließenden
Blase, dem primordialen Schädel . In der Rumpfhälfte hingegen
zerfällt die Urwirbelplatte in eine Anzahl von gleichartigen, würfelförmigen,
hintereinander gelegenen Stücken; das sind die einzelnen