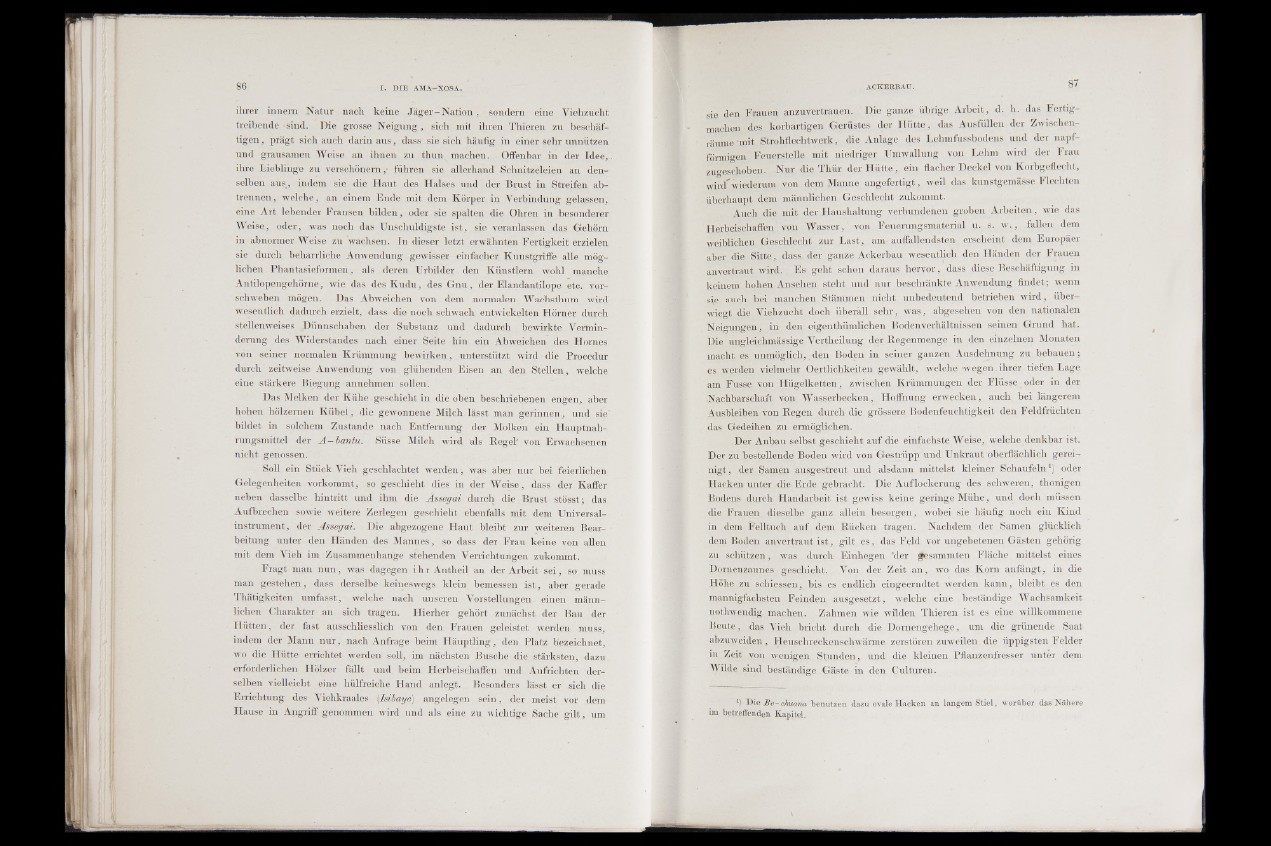
ihrer innern Natur nach keine Jäger—Nation, sondern eine Viehzucht
treibende sind. Die grosse Neigung, sich mit ihren Thieren zu beschäftigen
3 prägt sich auch darin aus, dass sie sich häufig in einer sehr unnützen
und grausamen Weise an ihnen zu thun machen. Offenbar in der Idee,
ihre Lieblinge zu verschönern,* führen sie allerhand Schnitzeleien an denselben
aus,, indem sie die Haut des Halses und der Brust in Streifen abtrennen,
welche, an einem Ende mit dem Körper in Verbindung gelassen,
eine Art lebender Fransen bilden, oder sie spalten die Ohren in besonderer
W eise, oder, was noch das Unschuldigste ist, sie veranlassen das Gehörn
in abnormer Weise zu wachsen. In dieser letzt erwähnten Fertigkeit erzielen
sie durch beharrliche Anwendung gewisser einfacher Kunstgriffe alle möglichen
Phantasieformen, als deren Urbilder den Künstlern wohl manche
Antilopengehörne, wie das des Kudu, des Gnu, der Elandantilope etG. vorschweben
mögen. Das Ahweichen von dem normalen Wachsthum wird
wesentlich dadurch erzielt, dass die noch schwach entwickelten Hörner durch
stellenweises .Dünnschaben der Substanz und dadurch bewirkte Verminderung
des Widerstandes nach einer Seite hin ein Abweichen des Hornes
von seiner normalen Krümmung bewirken, unterstützt wird die Procedur
durch zeitweise Anwendung von glühenden Eisen an den Stellen, welche
eine stärkere Biegung annehmen sollen.
Das Melken der Kühe geschieht in die oben beschriebenen engen, .aber
hohen hölzernen Kübel, die gewonnene Milch.lässt man gerinnen, und sie'
bildet in solchem Zustande nach Entfernung der Molken ein Hauptnahrungsmittel
der A - bantu. Süsse Milch wird als Kegel' von Erwachsenen
nicht genossen.
Soll ein Stück Vieh geschlachtet werden; was aber nur hei feierlichen
Gelegenheiten vorkommt, so geschieht dies in der Weise, dass der Kaffer
neben dasselbe hintritt und ihm die Ässegai durch die Brust stösst; das
Aufbrechen sowie weitere Zerlegen geschieht ebenfalls mit dem Universalinstrument,
der Assegai. Die abgezogene Haut bleibt zur weiteren Bearbeitung
unter den Händen des Mannes, so dass der Frau keine von allen
mit dem Vieh im Zusammenhänge stehenden Verrichtungen zukommt.
Fragt man nun, was dagegen ih r Antheil an der Arbeit• seijßsp muss
man gestehen, dass derselbe keineswegs klein bemessen is t, aber gerade
Thätigkeiten umfasst, welche nach unseren Vorstellungen einen männlichen
Charakter an sich tragen. Hierher gehört zunächst der Bau der
Hütten, der fast ausschliesslich von den Frauen geleistet werden muss,
indem der Mann nur, nach Anfrage beim Häuptling, den Platz bezeichnet,
wo die Hütte errichtet werden soll, im nächsten Busche die stärksten, dazu
erforderlichen Hölzer fällt und beim Herbeischaffen und Aufrichten derselben
vielleicht eine hülfreiche Hand anlegt. Besonders lässt er sich die
Errichtung des Viehkraales (Isibaye) angelegen sein, der meist vor dem
Hause in Angriff genommen wird und als eine zu wichtige Sache g ilt, um
sie den Frauen anzuvertrauen. Die ganze übrige Arbeit, d. h. das Fertigmachen
des korbartigen Gerüstes <ler Hütte, das Ausfüllen der Zwischenräume
-mit Strohflechtwerk, die Anlage des Lehmfussbodens und der napfförmigen
Feuerstelle mit niedriger Umwallung von Lehm wird der Frau
zugeschoben. Nur die Thür der Hütte, ein flacher Deckel von Korbgeflecht,
wird’ wiederum von dem Manne angefertigt, weil das kunstgemässe Flechten
überhaupt dem männlichen Geschlecht zukommt.
Auch die mit der Haushaltung verbundenen groben Arbeiten, wie das
Herbeischaffeii von Wasser,, von Feuerungsmaterial u. s. w ,, fallen dem
weiblichen Geschlecht zur Last, am auffallendsten erscheint dem Europäer
aber die Sitte, dass, der ganze Ackerbau wesentlich den Händen der Frauen
anvertraut wird. Es geht schon daraus hervor, dass diese Beschäftigung in
keinem hohen Ansehen steht und nur beschränkte Anwendung findet ; wenn
sie auch bei manchen Stämmen nicht unbedeutend betrieben wird, überwiegt
die Viehzucht doch überall sehr, was, abgesehen von den nationalen
Neigungen, in den eigenthümlichen Bodenverhältnissen seinen Grund hat.
Die ungleichmässige Vertheilung der Regenmenge in den einzelnen Monaten
macht es unmöglich,,den Boden in seiner ganzen Ausdehnung zu bebauen;
es werden vielmehr Oertlichkeiten gewählt, welche wegen.ihrer tiefen Lage
am Fusse von Hügelketten, zwischen Krümmungen der Flüsse oder in der
■Nachbarschaft von Wasserbecken, Hoffnung erwecken, auch hei längerem
Ausbleiben von Regen durch die grössere Bodenfeuchtigkeit den Feldfrüchten
das Gedeihen zu ermöglichen.
Der Anbau selbst geschieht auf die einfachste Weise, welche denkbar ist.
Der zu bestellende Boden wird von Gestrüpp und Unkraut oberflächlich gereinigt,
der Samen ausgestreut und alsdann mittelst kleiner Schaufeln1) .oder
Hacken unter die Erde gebracht. Die Auflockerung des schweren, thonigen
Bodens durch Handarbeit ist gewiss keine geringe Mühe, und. doch müssen
die Frauen dieselbe ganz allein besorgen, wobei sie häufig noch ein Kind
in dem Felltuch auf dem Rücken tragen. Nachdem der Samen glücklich
dem Boden anvertraut is t, gilt es, das Feld vor ungebetenen Gästen gehörig
zu schützen, was durch Einhegen 'der Jesammten Fläche mittelst eines
Dornenzaunes geschieht. Von der Zeit an, wo das Korn anfängt, in die
Höhe zu schiessen, bis es endlich eingeerndtet werden kann, bleibt es den
mannigfachsten Feinden ausgesetzt, welche eine beständige Wachsamkeit
nothwendig machen. Zahmen wie wilden Thieren ist es eine willkommene
Beute, das Vieh bricht durch die Dornengehege, um die grünende Saat
abzuweiden, Heuschreckenschwärme zerstörenzuweilen die üppigsten Felder
in Zeit von wenigen Stunden, und die kleinen Pflanzenfresser unter dem
Wilde sind beständige Gäste in den Gulturen.
’) Die Be-chuana benutzen dazu ovale Hacken an langem Stiel, worüber das Nähere
im betreffenden Kapitel.