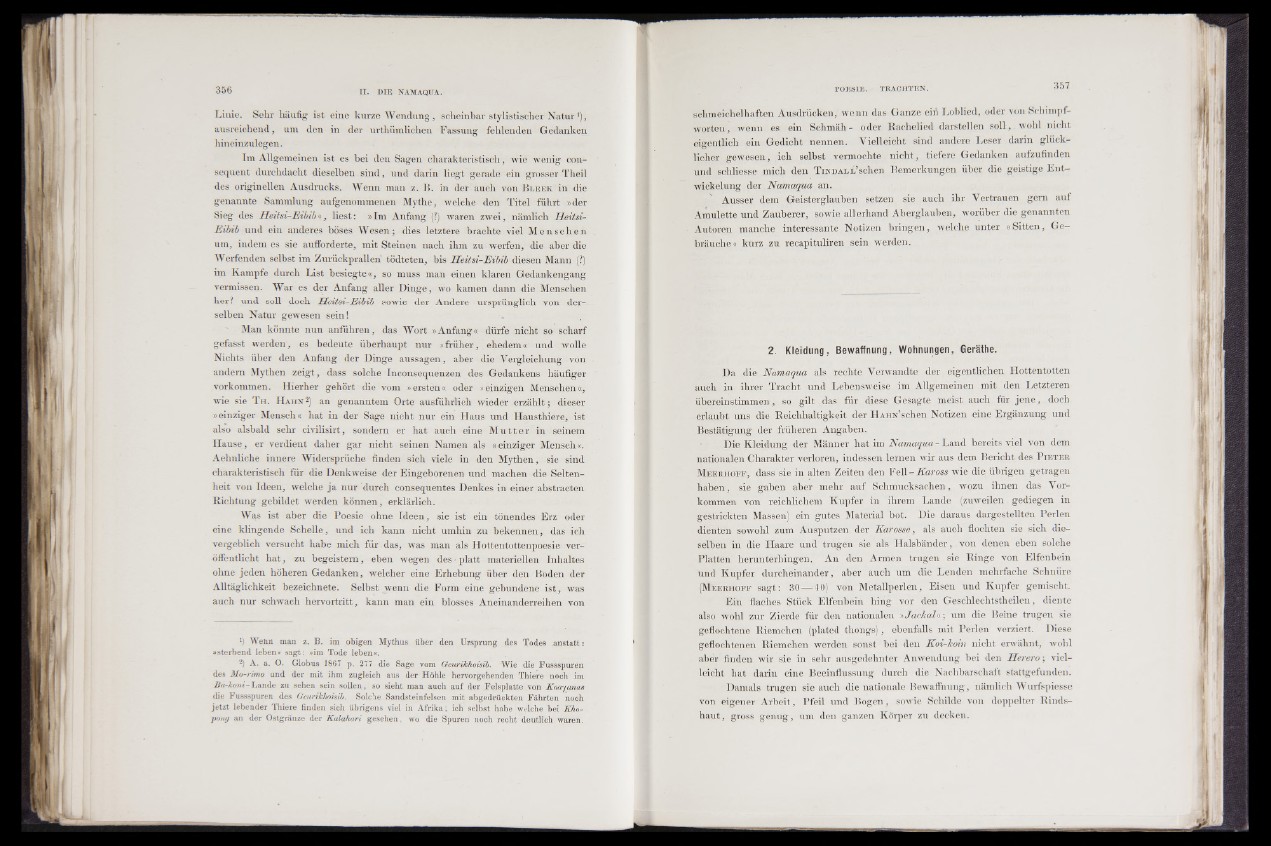
Linie. Sehr häufig ist eine kurze Wendung, scheinbar stylistischer Natur1),
ausreichend, um den in der urthümlichen Fassung fehlenden Gedanken
hineinzulegen.
Im Allgemeinen ist es bei den Sagen charakteristisch, wie wenig conséquent
durchdacht dieselben sind, und darin liegt gerade ein grösser Theil
des originellen Ausdrucks. Wenn man z . B . in der auch von B l e e k in die
genannte Sammlung aufgenommenen Mythe, welche den Titel führt »der
Sieg des Heitsi-Eibib«, liest: »Im Anfang (?) waren zwei, nämlich Heitsi-
Eibib und ein anderes böses Wesen; dies letztere brachte viel Me n s c h e n
um, indem es sie aufforderte, mit Steinen nach ihm zu werfen, die aber die
Werfenden selbst im Zurückprallen tödteten, bis Heitsi-Eibib diesen Mann (?)
im Kampfe durch List besiegte«, so muss man einen klaren Gedankengang
vermissen. War es der Anfang aller Dinge, wo kamen dann die Menschen
her? und soll doch Heitsi-Eibib sowie der Andere ursprünglich von derselben
Natur gewesen sein!
Man könnte nun anführen, das Wort »Anfang« dürfe nicht so scharf
gefasst werden, es bedeute überhaupt nur »früher, ehedem« und wolle
Nichts über den Anfang der Dinge aussagen, aber die Vergleichung von
ändern Mythen zeigt, dass solche Inconsequenzen des Gedankens häufiger
Vorkommen. Hierher gehört die vom »ersten« oder »einzigen Menschen«y
wie sie T h . H a h n 2) an genanntem Orte ausführlich wieder erzählt; dieser
»einziger Mensch« hat in der Sage nicht nur ein Haus und Hausthiere, ist
also alsbald sehr civilisirt, sondern er hat auch eine Mut t e r in seinem
Hause, er verdient daher gar nicht seinen Namen als »einziger Mensch«.
Aehnliche innere Widersprüche finden sich viele in den Mythen, sie sind
charakteristisch für die Denkweise der Eingeborenen und machen die Seltenheit
von Ideen, welche ja nur durch conséquentes Denkes in einer abstracten
Richtung gebildet werden können, erklärlich.
Was ist aber die Poesie ohne Ideen, sie ist ein tönendes Erz oder
eine klingende Schelle, und ich kann nicht umhin zu bekennen, das ich
vergeblich versucht habe mich für.das, was man als Hottentottenpoesie veröffentlicht
hat, zu begeistern, eben wegen des platt materiellen Inhaltes
ohne jeden höheren Gedanken, welcher eine Erhebung über den Boden der
Alltäglichkeit bezeichnete. Selbst wenn die Form eine gebundene ist, was
auch nur schwach hervortritt, kann man ein blosses Aneinanderreihen von
1) Wenn man z. B. im obigen Mythus über den Ursprung des Todes .anstatt:
«sterbend leben« sagt: »im Tode leben«.
2) A. a. 0 . Globus 1867 p. 277 die Sage vom Gcurikhoisib. Wie die Fussspuren
des Mo-nmo und der mit ihm zugleich aus der Höhle hervorgehenden Thiere noch im
Bu-koni—Lande zu sehen sein sollen, so sieht man auch auf der Felsplatte von Koaymms
die Fussspuren des Gcurikhoisib. Solche Sandsteinfelsen mit abgedrückten Fährten noch
jetzt lebender Thiere finden sich übrigens viel in Afrika; ich selbst habe welche bei Kho-
pong an der Ostgränze der Kalahari gesehen, wo die Spuren noch recht deutlich waren.
schmeichelhaften Ausdrücken, wenn das Ganze eiü Loblied, oder von Schimpfworten,
wenn es ein Schmäh- oder Eachelied darstellen soll, wohl nicht
eigentlich ein Gedicht nennen. Vielleicht sind andere Leser darin glücklicher
gewesen, ich selbst vermochte nicht, tiefere Gedanken aufzufinden
und schliesse mich den T in d a l L’schen Bemerkungen über die geistige Entwickelung
der Namaqua an.
Ausser dem Geisterglauben setzen sie auch ihr Vertrauen gern auf
Amulette und Zauberer, sowie allerhand Aberglauben, worüber die genannten
Autoren manche interessante Notizen bringen, welche unter »Sitten, Gebräuche
« kürz zu recapituliren sein werden.
2. Kleidung, Bewaffnung, Wohnungen, Geräthe.
Da die Namaqua als rechte Verwandte der eigentlichen Hottentotten
auch in ihrer Tracht und Lebensweise im Allgemeinen mit den Letzteren
übereinstimmen, so gilt das für diese Gesagte meist auch für jene, doch
erlaubt uns die Reichhaltigkeit der HAHN’schen Notizen eine Ergänzung und
Bestätigung der früheren Angaben.
Die Kleidung der Männer hat im Namaqua - Land bereits viel von dem
nationalen Charakter verloren, indessen lernen wir aus dem Bericht des P ie t e r
M e e r h o f p , dass sie in alten Zeiten den Fell -Ka ro ss wie die übrigen getragen
haben, sie gaben aber mehr auf Schmucksachen, wozu ihnen das Vorkommen
von reichlichem Kupfer in ihrem Lande (zuweilen gediegen in
gestrickten Massen) ein gutes Material bot. Die daraus dargestellten Perlen
dienten sowohl zum Ausputzen der Karosse, als auch flochten sie sich dieselben
in die Haare und trugen sie als Halsbänder,. von denen eben solche
Platten herunterhingen. An den Armen trugen sie Ringe von Elfenbein
und Kupfer durcheinander, aber auch um die Lenden mehrfache Schnüre
(Me e r h o f f sagt: 3 0 — 4 0 ) von Metallperlen, Eisen und Kupfer gemischt.
Ein flaches Stück Elfenbein hing vor den Geschlechtstheilen, diente
also wohl zur Zierde für den nationalen »Jackal«; um die Beine trugen sie
geflochtene Riemchen (plated thongs), ebenfalls mit Perlen verziert. Diese
geflochtenen Riemchen werden sonst bei den Koi-koin nicht erwähnt, wohl
aber finden wir sie in sehr ausgedehnter Anwendung bei den Herero; vielleicht
hat darin eine Beeinflussung durch die Nachbarschaft stattgefunden.
Damals trugen sie auch die nationale Bewaffnung, nämlich Wurfspiesse
von eigener Arbeit, Pfeil und Bogen, sowie Schilde von doppelter Rindshaut,
gross genug, um den ganzen Körper zu decken.