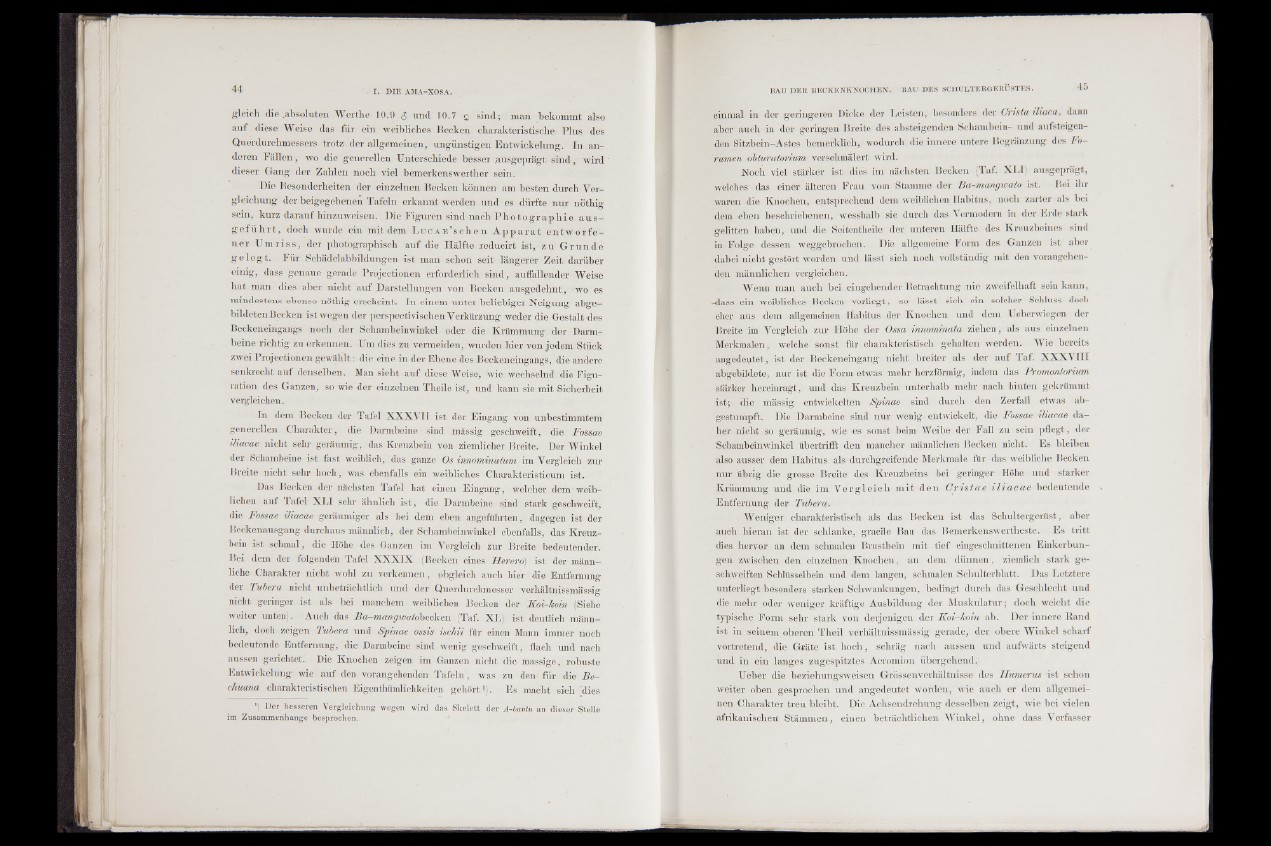
gleich die .absoluten Werthe 10.9 $ und 10.7 q sind; man bekommt also
auf diese Weise das für ein weibliches Becken charakteristische Plus des
Querdurchmessers trotz der allgemeinen, ungünstigen Entwickelung. In anderen
Fällen, wo die generellen Unterschiede besser .ausgeprägt sind, wird
dieser Gang der Zahlen noch viel hemerkenswerther sein.
Die Besonderheiten der einzelnen Becken können am besten durch Vergleichung
der beigegebenen Tafeln erkannt werden und es dürfte nur nöthig
sein, kurz darauf hinzuweisen. Die Figuren sind nach P h o t o g r a p h i e a u s g
e f ü h r t , doch wurde ein mit dem LüCAs ’s c h e n Ap p a r a t e n two r f e ner
Umr i s s , der photographisch auf die Hälfte reducirt ist, zu Grunde
g e l e g t . Für Schädelabbildungen is t man schon seit längerer Zeit, darüber
einig, dass genaue gerade Projectionen erforderlich sind, auffallender Weise
hat man dies aber nicht auf Darstellungen von Becken ausgedehnt, wo es
mindestens ebenso nöthig erscheint. In einem unter beliebiger Neigung abge—
bildeten Becken ist wegen der perspectivischen Verkürzung weder die Gestalt-des
Beckeneingangs noch der Schambeinwinkel oder die Krümmung der Darmbeine
richtig zu erkennen. Um dies zu vermeiden, wurden hier von jedem Stück
zwei Projectionen gewählt: die eine in der Ebene des Beckeneingangs, die andere
senkrecht auf denselben. Man sieht auf diese Weise, wie wechselnd die Figuration
des Ganzen, so wie der einzelnen Theile ist, und kann-sie mit Sicherheit
vergleichen.
In dem Becken der Tafel XXXVII ist der Eingang von unbestimmtem
generellen Charakter, die Darmbeine sind mässig geschweift, die Fos&cte
ihacae nicht sehr geräumig, das Kreuzbein von ziemlicher Breite; Der Winkel
der Schambeine ist fast weiblich, das ganze Os innominatum im Vergleich zur
Breite nicht sehr hoch, was ebenfalls ein weibliches* Charakteristicum ist.
Das Becken der nächsten Tafel hat einen Eingang, welcher dem'weiblichen
auf Tafel XLI sehr ähnlich ist, die Darmbeine sind stark geschweift,
die Fossae iliacae geräumiger als bei dem eben angeführten, dagegen ist der
Beckenausgang durchaus männlich, der Schambeinwinkel ebenfalls, das Kreuzbein
ist schmal, die Höhe des Ganzen im Vergleich zur Breite bedeutender.
Bei dem der folgenden Tafel XXXIX (Becken eines Herero) ist der männliche
Charakter nicht wohl zu verkennen, obgleich auch hier die Entfernung
der Tubera nicht unbeträchtlich und der Querdurchmesser verhältnissmässig
nicht geringer ist als bei manchem weiblichen Becken der Koi-hoin (Siehe
weiter unten]. Auch das Ba-mangwatohecken (Taf. XL) ist deutlich männlich,
doch zeigen Tubera und Spinae ossis isehii für einen Mann immer noch
bedeutende Entfernung, die Darmbeine sind wenig geschweift, flach und nach
aussen gerichtet. Die Knochen zeigen im Ganzen nicht die massige, robuste
Entwickelung wie auf den vorangehenden Tafeln, was zu den für die Be-
chuana charakteristischen Eigenthümlichkeiten gehört1). Es macht sich dies
') Der besseren Vergleichung wegen wird das Skelett der A-banlu an dieser Stelle
im Zusammenhänge besprochen.
einmal in der geringeren Dicke der Leisten, besonders der Crista iliaca, dann
aber auch in der geringen Breite des absteigenden Schambein- und aufsteigenden
Sitzbein-Astes bemerklieh, wodurch die innere untere Begränzung des Fo-
ramen obturatorium verschmälert wird.
Noch viel stärker ist dies im nächsten Becken (Taf. XLI) ausgeprägt,
welches das einer älteren Frau vom Stamme der Ba-mangwato ist. Bei ihr
waren die Knochen, entsprechend dem weiblichen Habitus, noch zarter als bei
dem eben beschriebenen, wesshalb sie durch das Vermodern in der Erde stark
gelitten haben, und die Seitentheile der unteren Hälfte des Kreuzbeines sind
in Folge dessen weggebrochen. Die allgemeine Form des Ganzen ist aber
dabei nicht gestört worden und lässt sich noch vollständig mit den vorangehenden
männlichen vergleichen.
Wenn man auch bei eingehender Betrachtung nie zweifelhaft sein kann,
-dass ein weibliches Becken vorliegt, so lässt sich ein solcher Schluss doch
eher aus dem allgemeinen Habitus der Knochen und dem Ueberwiegen der
Breite im Vergleich zur Höhe der Ossa innominata ziehen, als aus einzelnen
Merkmalen, welche sonst für charakteristisch gehalten werden. Wie bereits
angedeutet, ist der Beckeneingang nicht breiter als der auf Taf. XXXVIII
abgebildete, nur ist, die Form etwas mehr herzförmig, indem das Promontorium
stärker hereinragt, und das Kreuzbein unterhalb mehr nach hinten gekrümmt
ist; die mässig entwickelten Spinae sind durch den Zerfall etwas abgestumpft.
Die Darmbeine sind nur wenig entwickelt, die Fossae iliacae daher
nicht so geräumig, wie es sonst beim Weibe der Fall zu sein pflegt, der
Schambeinwinkel übertrifft den mancher männlichen Becken nicht. Es bleiben
also ausser dem Habitus als'durchgreifende Merkmale für das weibliche Becken
nur ührig die grosse Breite des Kreuzbeins bei geringer Höhe und starker
Krümmung und die im Ve r g l e i c h mit den C r is ta e i l i a c a e bedeutende
Entfernung der Tubera.
Weniger charakteristisch als das Becken ist das Schultergerüst, aber
auch hieran ist der schlanke, gracile Bau das Bemerkenswertheste. Es tritt
dies hervor an dem schmalen Brustbein mit tief eingeschnittenen Einkerbungen
zwischen den einzelnen Knochen, an dem dünnen, ziemlich stark geschweiften
Schlüsselbein und dem langen, schmalen Schulterblatt. Das Letztere
unterliegt besonders starken Schwankungen, bedingt durch das Geschlecht und
die mehr oder weniger kräftige Ausbildung der Muskulatur; doch weicht die
typische Form sehr stark von derjenigen der Koi—koi?i ab. Der innere Rand
ist in seinem oberen Theil verhältnissmässig gerade, der obere Winkel scharf
vortretend, die Gräte ist hoch, schräg nach aussen und aufwärts steigend
und in ein langes zugespitztes Acromion übergehend.
Ueber die beziehungsweisen Grössenverhältnisse des Humerus ist schon
weiter oben gesprochen und angedeutet worden, wie auch er dem allgemeinen
Charakter treu bleibt. Die Achsendrehung desselben zeigt, wie bei vielen
afrikanischen Stämmen, einen beträchtlichen Winkel, ohne dass Verfasser