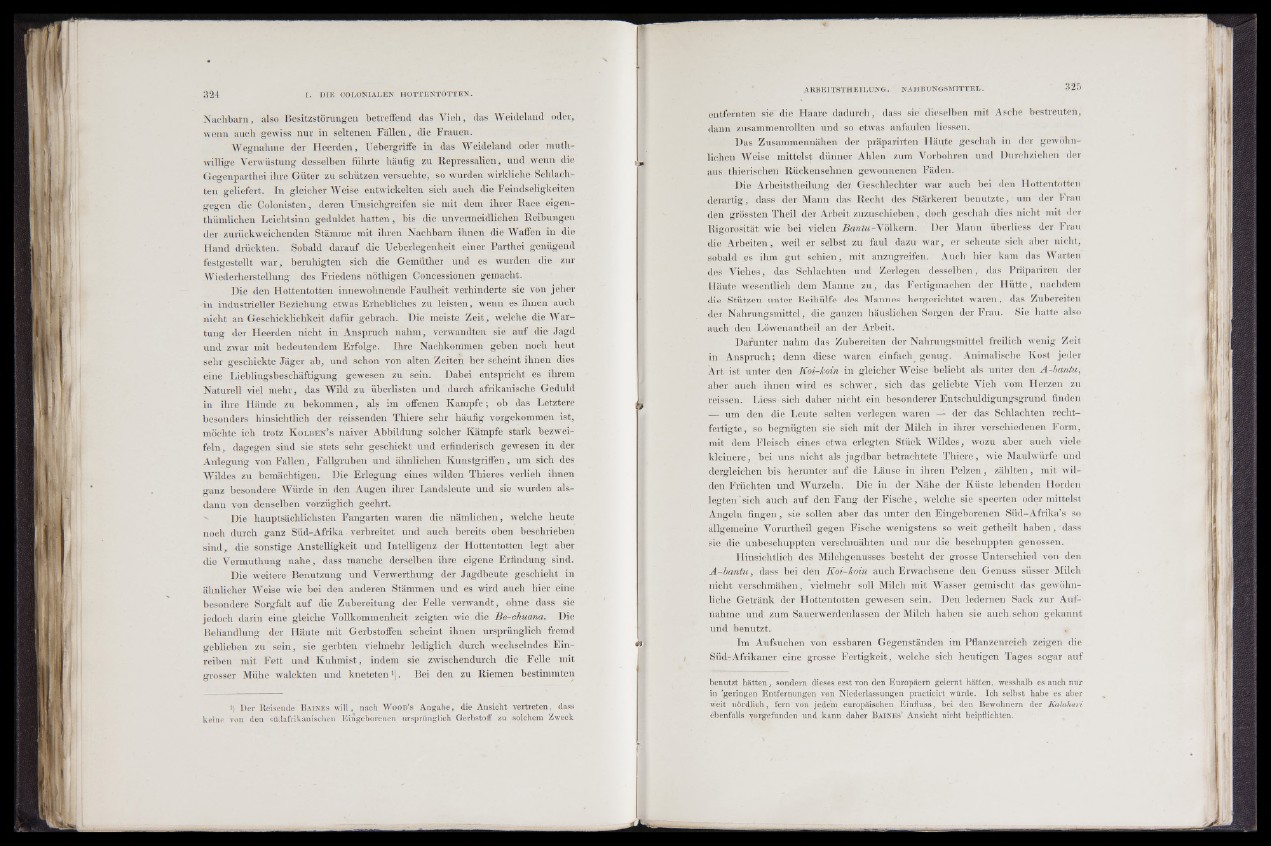
Nachbarn, also Besitzstörungen betreffend das Vieh, das Weideland oder,
wenn auch gewiss nur in seltenen Fällen, die Frauen.
Wegnahme der Heerden, Uebergriffe in das Weideland oder muth-
willige Verwüstung desselben führte häufig zu Repressalien, und wenn die
Gegenparthei ihre Güter zu schützen versuchte, so wurden wirkliche Schlachten
geliefert. In gleicher Weise entwickelten sich auch die Feindseligkeiten
gegen die Golonisten, deren Umsichgreifen sie mit dem ihrer Race eigen-
thümlichen Leichtsinn geduldet hatten, bis die unvermeidlichen Reibungen
der zurückweichenden Stämme mit ihren Nachbarn ihnen die Waffen in die
Hand drückten. Sobald darauf die Ueberlegenheit einer Parthei genügend
festgestellt war, beruhigten sich die Gemüther und es wurden die zur
Wiederherstellung des Friedens nöthigen Coneessionen gemacht.
Die den Hottentotten innewohnende Faulheit verhinderte sie von jeher
in industrieller Beziehung etwas Erhebliches zu leisten, wenn es ihnen auch
nicht an Geschicklichkeit dafür gebrach. Die meiste Zeit, welche die Wartung
der Heerden nicht in Anspruch nahm, verwandten sie auf die Jagd
und zwar mit bedeutendem Erfolge. Ihre Nachkommen geben noch heut
sehr geschickte Jäger ab, und schon von alten Zeiten her scheint ihnen dies
eine Lieblingsbeschäftigung gewesen zu sein. Dabei entspricht es ihrem
Naturell viel mehr, das Wild zu überlisten und durch afrikanische Geduld
in ihre Hände zu bekommen, als im offenen Kampfe; ob das Letztere
besonders hinsichtlich der reissenden Thiere sehr häufig vorgekommen ist,
möchte ich trotz K o l b e n ’s naiver Abbildung solcher Kämpfe stark bezweifeln,
dagegen sind sie stets hehr geschickt und erfinderisch gewesen in der
Anlegung von Fallen, Fallgruben und ähnlichen Kunstgriffen, um sich des
Wildes zu bemächtigen. Die Erlegung eines wilfien Thieres verlieh ihnen
ganz besondere Würde in den Augen ihrer Landsleute und sie wurden alsdann
von denselben vorzüglich geehrt.
Die hauptsächlichsten Fangarten waren die nämlichen, welche heute
noch durch ganz Süd-Afrika verbreitet und auch bereits oben beschrieben
sind, die sonstige Anstelligkeit und Intelligenz der Hottentotten legt aber
die Vermuthung nahe, dass manche derselben ihre eigene Erfindung sind.
Die weitere Benutzung und Verwerthung der Jagdbeute geschieht in
ähnlicher Weise wie bei den anderen Stämmen und es wird auch hier eine
besondere Sorgfalt auf die Zubereitung der Felle verwandt, ohne dass sie
jedoch darin eine gleiche Vollkommenheit zeigten wie die Be-chuana. Die
Behandlung der Häute mit Gerbstoffen scheint ihnen ursprünglich fremd
geblieben zu sein, sie gerbten vielmehr lediglich durch wechselndes Einreiben
mit Fett und Kuhmist, indem sie zwischendurch die Felle mit
grösser Mühe walckten und kneteten1). Bei den zu, Riemen bestimmten
i) Der Reisende B a i n e s will, nach W o o d ’s Angabe, die Ansicht vertreten, dass
keine von den südafrikanischen Eingeborenen ursprünglich Gerbstoff zu solchem Zweck
entfernten sie die Haare dadurch, dass sie dieselben mit Asche bestreuten,
dann zusammenrollten und so etwas anfaulen Hessen.
Das Zusammennähen der präparirten Häute geschah in der gewöhnlichen
Weise mittelst dünner Ahlen zum Vorbohren und Durchziehen der
aus thierischen Rückensehnen gewonnenen Fäden.
Die Arbeitstheilung der Geschlechter war auch bei den Hottentotten
derartig, dass der Mann das Recht des Stärkeren benutzte, um der Frau
den grössten Theil der Arbeit zuzuschieben, doch geschah dies nicht mit der
Rigorosität wie bei vielen Bantu-Völkern. Der Mann überliess der Frau
die Arbeiten, weil er selbst.zu faul dazu war, er scheute sich aber nicht,
sobald es ihm gut schien,- mit anzugreifen. Auch hier kam das Warten
des Viehes, das Schlachten und Zerlegen desselben, das Präpariren der
Häute wesentlich dem Manne -Z.u,_ das Fertigmachen der Hütte, nachdem
die Stützen unter Beihülfe des Mannes hergerichtet waren, das Zubereiten
der Nahrungsmittel, die ganzen häuslichen Sorgen der Frau. Sie hatte also
auch den Löwenantheil an der Arbeit.
Darunter nahm das Zubereiten der Nahrungsmittel freilich wenig Zeit
in Anspruch; denn diese waren einfach^ genug. Animalische Kost jeder
Art ist unter den Koi-koin in gleicherweise beliebt als unter den A-bantu,
aber auch ihnen wird es schwer, sich das geliebte Vieh vom Herzen zu
reissen. Liess sich daher nicht ein besonderer Entschuldigungsgrund finden
um den die Leute selten verlegen waren — der das Schlachten rechtfertigte,
so hegnügten sie sich mit der Milch in ihrer verschiedenen Form,
mit dem Fleisch eines etwa erlegten Stück Wildes, wozu aber auch viele
kleinere, bei uns nicht als jagdbar betrachtete Thiere, wie Maulwürfe und
dergleichen bis herunter auf die Läuse in ihren Pelzen, zählten, mit wilden
Früchten und Wurzeln. Die in der Nähe der Küste lebenden Horden
legten'sich auch auf den Fang der Fische, welche sie spee'rten oder mittelst
Angeln fingen, sie sollen aber das unter den Eingeborenen Süd-Afrika’s so
allgemeine Vorurtheil gegen Fische wenigstens so weit getheilt haben,'dass
sie die unbeschuppten verschmähten und nur die beschuppten genossen.
Hinsichtlich des Milchgenusses besteht der grosse Unterschied von den
A-bantu, dass bei den Koi-koin auch Erwachsene den Genuss süsser-Milch
nicht verschmähen, vielmehr soll Milch mit Wasser gemischt das gewöhnliche
.Getränk der Hottentotten gewesen sein. Den ledernen Sack zur Aufnahme
und zum Sauerwerdenlassen der Milch haben sie auch, schon gekannt
und benutzt. - ~ «
Im Aufsuchen von essbaren Gegenständen im Pflanzenreich zeigen die
Süd-Afrikaner eine grosse Fertigkeit, welche sich heutigen Tages sogar auf
benutzt hätten, sondern dieses erst von den Europäern gelernt hätten, wesshalb es auch nur
in ’geringen Entfernungen von Niederlassungen practicirt würde. Ich selbst habe es aber
weit nördlich, fern von jedem europäischen Einfluss, bei den Bewohnern der Kalahari
ebenfalls vorgefunden und kann daher B a i n e s ’ Ansicht nicht beipflichten.