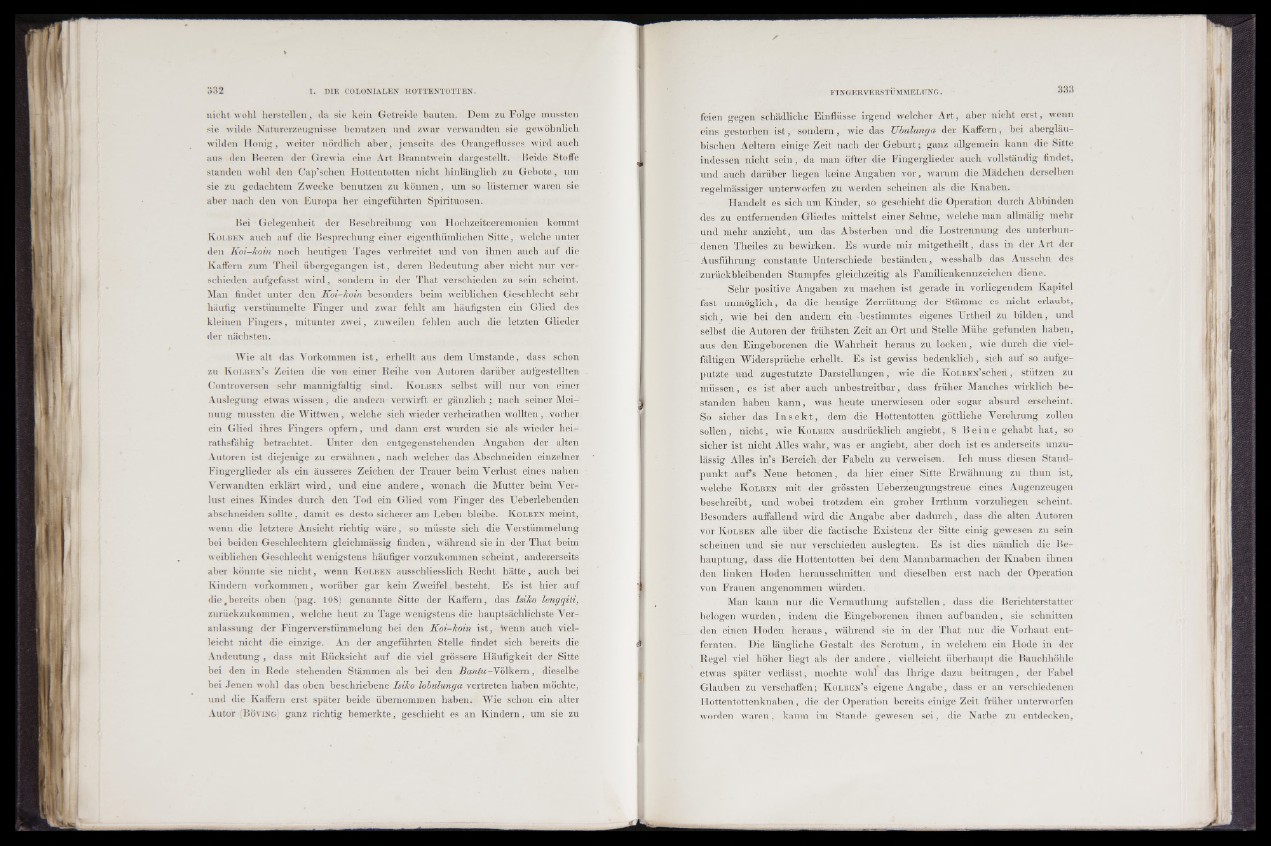
nicht wohl hersteilen, da sie kein Getreide bauten. Dem zu Folge mussten
sie wilde Naturerzeugnisse benutzen und zwar verwandten sie gewöhnlich
wilden Honig, weiter nördlich aber, jenseits des Orangeflusses wird auch
aus den Feeren der Grewia eine Art Branntwein dargestellt. Beide Stoffe
standen wohl den Cap’sehen Hottentotten nicht hinlänglich zu Gebote, um
sie zu gedachtem Zwecke benutzen zu können, um so lüsterner waren sie
aber nach den von Europa her eingeführten Spirituosen.
Bei Gelegenheit der Beschreibung von Hochzeitceremonien kommt
K o l b e n auch auf die Besprechung einer eigenthümlichen Sitte, welche unter
den Koi-koin noch heutigen Tages verbreitet und von ihnen auch auf die
Kaffern zum Theil übergegangen ist, deren Bedeutung aber nicht nur verschieden
aufgefasst wird, sondern in der That verschieden zu sein scheint.
Man findet unter den Koi-koin besonders beim weiblichen Geschlecht sehr
häufig verstümmelte Finger und zwar fehlt am häufigsten ein Glied des
kleinen Fingers, mitunter zwei, zuweilen fehlen auch die letzten Glieder
der nächsten.
W ie alt das Vorkommen is t, erhellt aus dem Umstande, dass schon
zu K o l b e n ’s Zeiten die von einer Reihe von Autoren darüber aufgestellten
Controversen sehr mannigfaltig sind. K o l b e n selbst will nur von einer
Auslegung etwas wissen, die ändern verwirft er gänzlich ; nach seiner Meinung
mussten die Wittwen, welche sich wieder verheirathen wollten, vorher
ein Glied ihres Fingers opfern, und dann erst wurden sie als wieder hei-
rathsfähig betrachtet. Unter den entgegenstehenden Angaben der alten
Autoren ist diejenige zu erwähnen, nach welcher das Abschneiden einzelner
Fingerglieder als ein äusseres Zeichen der Trauer beim Verlust eines nahen
Verwandten erklärt wird, und eine andere, wonach die Mutter beim Verlust
eines Kindes durch den Tod ein Glied vom Finger des Ueberlebenden
abschneiden sollte, damit es desto sicherer am Leben bleibe. K o l b e n meint,
wenn die letztere Ansicht richtig wäre, so müsste sich die Verstümmelung
bei beiden Geschlechtern gleichmässig finden, während sie in der That beim
weiblichen Geschlecht wenigstens häufiger vorzukommen scheint, andererseits
aber könnte sie nicht, wenn K o l b e n ausschliesslich Recht hätte, auch bei
Kindern Vorkommen, worüber gar kein Zweifel besteht. Es ist hier auf
die4bereits oben (pag. 108) genannte Sitte der Kaffern, das Isiko lengqiti,
zurückzukommen, welche heut zu Tage wenigstens die hauptsächlichste Veranlassung
der Fingerverstümmelung bei den Koi-koin ist, wenn auch vielleicht
nicht die einzige. An der angeführten Stelle findet sich bereits die
Andeutung, dass mit Rücksicht auf die viel grössere Häufigkeit der Sitte
bei den in Rede stehenden Stämmen als bei den Bantu-Völkern, dieselbe
bei Jenen wohl das oben beschriebene Isiko lobulunga vertreten haben möchte,
und die Kaffern erst später beide übernommen haben. Wie schon ein alter
Autor ( B ö v i n g ) ganz richtig bemerkte, geschieht es an Kindern, um sie zu
feien gegen schädliche Einflüsse irgend welcher Art, aber nicht erst, wenn
eins gestorben ist, sondern, wie das TJbulunga der Kaffern, bei abergläubischen
Aeltern einige Zeit nach der Geburt; ganz allgemein kann die Sitte
indessen nicht sein, da man öfter die Fingerglieder auch vollständig findet,
und auch darüber liegen keine Angaben vor, warum die Mädchen derselben
regelmässiger unterworfen zu werden scheinen als die Knaben.
Handelt es sich um Kinder, so geschieht die Operation durch Abbinden
des zu entfernenden Gliedes mittelst einer Sehne, welche man allmälig mehr
und mehr anzieht, um das Absterben und die Lostrennung des unterbundenen
Theiles zu bewirken. Es wurde mir mitgetheilt, dass in der Art der
Ausführung constante Unterschiede beständen, wesshalb das Aussehn des
zurückbleibenden Stumpfes gleichzeitig als Familienkennzeichen diene.
Sehr positive Angaben zu machen ist gerade in vorliegendem Kapitel
fast unmöglich, da die heutige Zerrüttung der Stämme es nicht erlaubt,
sich, wie bei den ändern ein -bestimmtes eigenes Urtheil zu bilden, und
selbst die Autoren der frühsten Zeit an Ort und Stelle Mühe gefunden haben,
aus den Eingeborenen die Wahrheit heraus zu locken, wie durch die vielfältigen
Widersprüche erhellt. Es ist gewiss bedenklich, sich auf so aufgeputzte
und zugestutzte Darstellungen, wie die KoLBEN’scheri, stützen zu
müssen, es ist aber auch unbestreitbar, dass früher Manches wirklich bestanden
haben kann, was heute unerwiesen oder sogar absurd erscheint.
So sicher das I n s e k t , dem die Hottentotten göttliche Verehrung zollen
sollen, nicht, wie K o l b e n ausdrücklich angiebt, 8 B e i n e gehabt hat, so
sicher ist nicht Alles wahr, was er angiebt, aber doch ist es anderseits unzulässig
Alles in’s Bereich^der Fabeln zu verweisen. Ich muss diesen Standpunkt
aufs Neue betonen, da hier einer Sitte Erwähnung zu thun ist,
welche K o l b e n mit der grössten Ueberzeugungstreue eines Augenzeugen
beschreibt, und wobei trotzdem ein grober Irrthum vorzuliegen scheint.
Besonders auffallend wird die Angabe aber dadurch, dass die alten Autoren
vor K o l b e n alle über die factische Existenz der Sitte einig gewesen zu sein
scheinen und sie nur verschieden auslegten. Es ist dies nämlich die Behauptung,
dass die Hottentotten bei dem Mannbarmachen der Knaben ihnen
den linken Hoden herausschnitten und dieselben erst nach der Operation
von Frauen angenommen würden.
Man kann nur die Vermuthung äufstellen, dass die Berichterstatter
helogen wurden, indem die Eingeborenen ihnen auf banden, sie schnitten
den einen Hoden heraus, während sie in der That nur die Vorhaut entfernten.
Die längliche Gestalt des Sero tum, in welchem ein Hode in der
Regel viel höher liegt als der andere, vielleicht überhaupt die Bauchhöhle
etwas später verlässt^ mochte wohl das Ihrige dazu beitragen, der Fabel
Glauben zu verschaffen; K o l b e n ’s eigene Angabe, dass er an verschiedenen
Hottentottenknaben, die der Operation bereits einige Zeit früher unterworfen
worden waren, kaum im Stande gewesen se i, die Narbe zu entdecken,