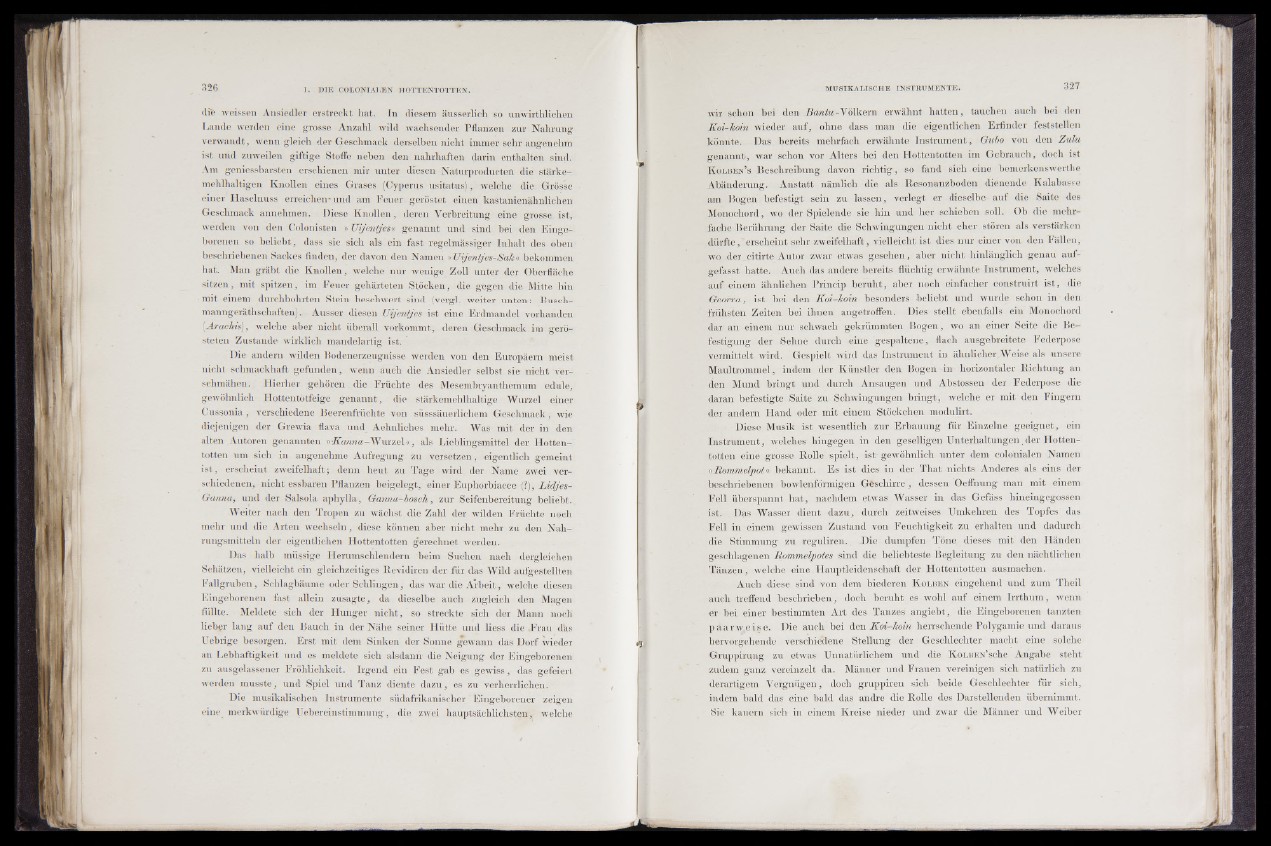
di'e weisf.en Ansiedler erstreckt hat. ln diesem äusserlich so unwirthlichen
Lande werden eine grosse Anzahl wild wachsender Pflanzen zur Nahrung
verwandt, wenn gleich der Geschmack derselben nicht immer sehr angenehm
ist uiid zuweilen giftige Stoffe neben den nahrhaften darin enthalten sind.
Am geniessbarsten erschienen mir unter diesen Naturproductefi die stärkemehlhaltigen
Knollen eines Grases (Cyperus usitatus), welche die Grösse
einer Haselnuss erreichen-und am Feuer geröstet einen kastanienähnlichen
Geschmack annehmen. Diese Knollen, deren Verbreitung eine grosse. ist,
werden von den Colonisten » Uijentjesi genannt und sind bei den Eingeborenen
so beliebt, dass sie sich als ein fast regelmässiger Inhalt des oben
beschriebenen Sackes finden, der davon den Namen »Uijentjes-Sak« bekommen
hat. Man gräbt die Knollen, welche nur wenige Zoll unter der Oberfläche
sitzen, mit spitzen, im Feuer gehärteten Stöcken, die gegen die Mitte hin
mit einem durchbohrten Stein beschwert sind (vergl. weiter unten: Busch-
manngeräthschaften). Ausser diesen TJijentjes ist eine Erdmandel vorhanden
(Arachts) , welche aber nicht überall vorkommt, deren Geschmack im gerösteten
Zustande wirklich mandelartig ist.
Die ändern wilden Bodenerzeugnisse weiden von den Europäern meist
nicht schmackhaft gefunden, wenn auch die Ansiedler selbst sie nicht verschmähen.
Hierher gehören die Früchte des Mesembryanthemum edule,
gewöhnlich Hottentötfeige genannt, die stärkemehlhaltige Wurzel einer
Cussonia, verschiedene Beerenfrüchte von süsssäuerlichem Geschmack, wie
diejenigen der Grewia flava und Aehnliches mehr. Was mit der in den
alten Autoren genannten »ATiwma-Wurzel«, als Lieblingsmittel der Hotten^
totten um sich in angenehme Aufregung zu versetzen, eigentlich gemeint
is t, erscheint zweifelhaft; denn heut zu Tage wird der Name zwei verschiedenen,
nicht essbaren Pflanzen beigelegt, einer Euphorbiacee (?), Lidjes-
Ganna, und der Salsola aphylla, Ganna-bosch, zur Seifenbereitung beliebt..
Weiter nach den Tropen zu wächst die Zahl der wilden Früchte , noch
mehr und die Arten wechseln, diese können aber nicht mehr zu den Nahrungsmitteln
der eigentlichen Hottentotten gerechnet werden.
Das halb müsjsige Herumschlendern beim Suchen nach dergleichen
Schätzen, vielleicht ein gleichzeitiges Revidiren der für das Wild aufgestellten
Fallgruben, Schlagbäume oder Schlingen, das war die Arbeit, welche diesen
Eingeborenen fast allein zusagte, da dieselbe auch Zugleich den Magen
füllte. Meldete sich der Hunger nicht, so streckte sich der Mann noch'
lieber lang auf den Bauch in der Nähe seiner Hütte und liess die .Frau dhs
Uebrige besorgen. Erst mit dem Sinken der Sonne gewann das Dorf wieder
an Lebhaftigkeit und es meldete sich alsdann die Neigung der Eingeborenen
zu ausgelassener Fröhlichkeit. Irgend ein Fest gab es gewiss, das gefeiert
werden musste, und Spiel und Tanz diente dazu, es zu verherrlichen.
Die musikalischen Instrumente südafrikanischer Eingeborener zeigen
eine merkwürdige Uebereinstimmung, die zwei hauptsächlichsten, welche
wir schon bei den Bantu-Völkern erwähnt hatten, tauchen auch bei den
Koi-Jcoin wieder auf, ohne dass man die eigentlichen Erfinder feststellen
könnte. Das bereits mehrfach erwähnte Instrument, Gubo von den Zulu
genannt-, war schon vor Alters bei den Hottentotten im Gebrauch, doch ist
K o l b e n ’s Beschreibung davon richtig, so fand sich.eine bemerkenswerthe
Abänderung. Anstatt nämlich die als Resonanzboden dienende Kalabasse
am Bogen befestigt sein zu lassen, verlegt er dieselbe- auf die Saite des
Monochord, wo der Spielende sie hin und her schieben soll. Ob die mehrfache
Berührung der Saite die Schwingungen nicht eher stören als verstärken
dürfte,'erscheint sehr zweifelhaft, vielleicht ist dies nur einer von den Fällen,
wo der_citirte Autor zwar etwas gesehen, aber nicht hinlänglich genau aufgefasst
hatte. Auch das andere bereits flüchtig erwähnte Instrument, welches
auf einem ähnlichen Princip beruht, aber noch einfacher construirt ist, die
Gcorra, ist bei den Koi-koin besonders beliebt und wurde schon in den
frühsten Zeiten bei ihnen angetroffen. Dies stellt ebenfalls ein Monochord
dar an einem nur schwach gekrümmten Bogen, wo an einer Seite die Befestigung
der Sehne durch eine gespaltene, flach ausgebreitete Federpose
vermittelt wird. Gespielt wird das Instrument in ähnlicher.Weise als unsere
Maultrommel, indem der Künstler den Bogen in horizontaler Richtung an
den Mund bringt und durch Ansaugen und Abstossen der Federpose die
daran befestigte Saite zu Schwingungen bringt, welche er mit den Fingern
der ändern Hand oder mit einem Stückchen modulirt.
Diese Musik ist wesentlich zur Erbauung für Einzelne geeignet, ein
Instrument, welches hingegen in den geselligen Unterhaltungen,der Hottentotten
eine grosse Rolle spielt, ist gewöhnlich unter dem colonialen Namen
»Rommelpot« bekannt. Es ist dies in der That nichts Anderes als eins der
beschriebenen bowlenförmigen Geschirre, dessen Oeffnung man mit einem
Fell überspannt hat, nachdem etwas Wasser in das Gefäss hineingegossen
ist. Das Wasser dient dazu, durch zeitweises Umkehren des Topfes das
Fell in einem gewissen Zustand von Feuchtigkeit zu erhalten und dadurch
die Stimmung zu reguliren. Die dumpfen Töne dieses mit den Händen
geschlagenen Rommelpotes sind die beliebteste Begleitung zu den nächtlichen
Tänzen, welche eine Hauptleidenschaft der Hottentotten ausmachen.
Auch diese sind -von dem biederen K o l b e n eingehend und zum Theil
auch treffend beschrieben, doch beruht es wohl auf einem Irrthum, wenn
er bei einer bestimmten Art des Tanzes angiebt, die Eingeborenen tanzten
pa a rwe i s e . Die auch bei den Koi-koin herrschende Polygamie und daraus
hervorgehende verschiedene Stellung der Geschlechter macht eine solche
Gruppirung zu etwas Unnatürlichem und' die KoLBEN’sche Angabe steht
zudem ganz veteinzelt da. Männer und Frauen vereinigen sich, natürlich zu
derartigem Vergnügen, doch gruppiren sich beide Geschlechter für sich,
indem bald das eine bald das andre die Rolle des Darstellenden übernimmt.
Sie kauern sich in einem Kreise nieder und zwar die Männer und Weiber