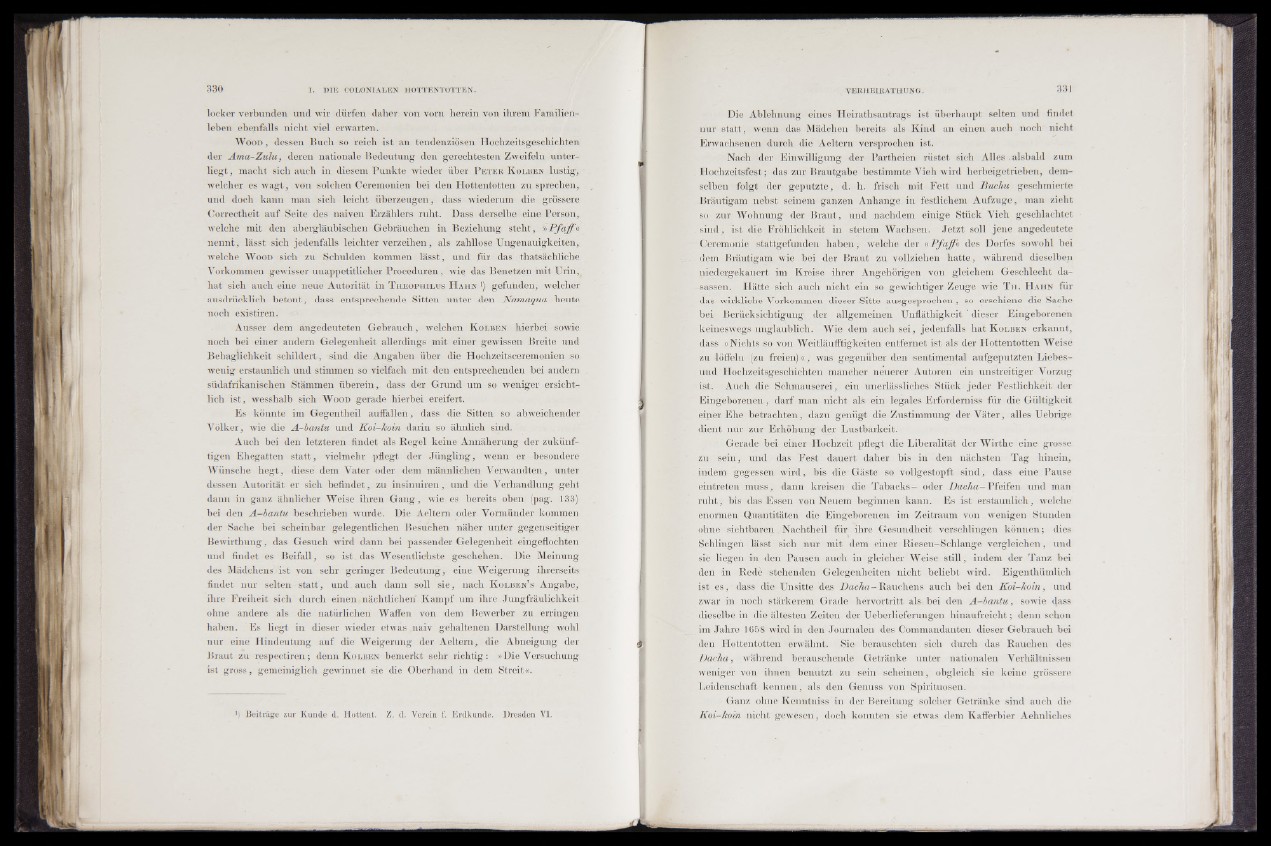
locker verbunden und wir dürfen daher von vorn herein von ihrem Familienleben
ebenfalls nicht viel erwarten.
W o o d , dessen Buch so reich ist an tendenziösen Hochzeitsgeschichten
der Ama-Zulu, deren nationale Bedeutung den gerechtesten Zweifeln unterlieg
t, macht sich auch in diesem Punkte wieder über P e t e r K o l b e n lustig,
welcher es wagt, von solchen Ceremonien bei den Hottentotten zu sprechen,
und doch kann man sich leicht überzeugen, dass wiederum die grössere
Correctheit auf Seite des naiven Erzählers ruht. Dass derselbe eine Person,
welche mit den abergläubischen Gebräuchen in Beziehung steht, »Pfaffa.
nennt, lässt sich jedenfalls leichter verzeihen, als zahllose Ungenauigkeiten,
welche W o o d sich zu Schulden kommen lässt, und für das thatsächliche
Vorkommen gewisser unappetitlicher Proceduren, wie das Benetzen mit Urin,
hat sich auch eine neue Autorität in T h e o p h i l u s H a h n l) gefunden, welcher
ausdrücklich betont, dass entsprechende Sitten unter den Namaqua heute
noch existiren.
Ausser dem angedeuteten Gebrauch, welchen K o l b e n hierbei sowie
noch bei einer ändern Gelegenheit allerdings mit einer gewissen Breite und
Behaglichkeit schildert, sind die Angaben über die Hochzeitsceremonien so
wenig erstaunlich und stimmen so vielfach mit den entsprechenden bei ändern
südafrikanischen Stämmen überein, dass der Grund um so weniger ersichtlich
ist, wesshalb sich W o o d gerade hierbei ereifert.
Es könnte im Gegentheil auffallen, dass die Sitten so abweichender
Völker, wie die A-bantu und Koi-koin darin so ähnlich sind.
Auch bei den letzteren findet als Regel keine Annäherung der zukünftigen
Ehegatten statt, vielmehr pflegt der Jüngling, wenn er besondere
Wünsche hegt, diese dem Vater oder dem männlichen Verwandten, unter
dessen Autorität er sich befindet, zu insinuiren, und die Verhandlung geht
dann in ganz ähnlicher Weise ihren Gang, wie es bereits oben (pag. 133)
bei den A-bantu beschrieben wurde. Die Aeltern oder Vormünder kommen
der Sache bei scheinbar gelegentlichen Besuchen näher unter gegenseitiger
Bewirthung, das Gesuch wird dann bei passender Gelegenheit eingeflochten
und findet es Beifall, so ist das Wesentlichste geschehen. Die Meinung
des Mädchens ist von sehr geringer Bedeutung, eine Weigerung ihrerseits
findet nur selten statt, und auch dann soll sie, nach K o l b e n ’s Angabe,
ihre Freiheit sich durch einen nächtlichen Kampf um ihre Jungfräulichkeit
ohne andere als die natürlichen Waffen von dem Bewerber zu erringen
haben. Es liegt in dieser wieder etwas naiv gehaltenen Darstellung wohl
nur eine Hindeutung auf die Weigerung der Aeltern, die Abneigung der
Braut zu respectiren; denn K o l b e n bemerkt sehr richtig: »Die Versuchung
ist gross, gemeiniglich gewinnet sie die Oberhand in dem Streit«.
Beiträge zur Kunde d. Hottent. Z. d. Verein f. Erdkunde. Dresden VI.
Die Ablehnung eines Heirathsantrags ist überhaupt selten und findet
nur statt, wenn das Mädchen bereits als Kind an einen auch noch nicht
Erwachsenen durch die Aeltern versprochen ist.
Nach der Einwilligung der Partheien rüstet sich Alles . alsbald zum
Hochzeitsfest; das zur Brautgabe bestimmte Vieh wird herbeigetrieben, demselben
folgt der geputzte, d. h. frisch mit Fett und Buchu geschmierte
Bräutigam nebst seinem ganzen Anhänge in festlichem Aufzuge, man zieht
so zur Wohnung der Braut, und nachdem einige Stück Vieh geschlachtet
sind, ist die Fröhlichkeit in stetem Wachsen. Jetzt soll jene angedeutete
Ceremonie stattgefunden haben, welche der »P f aff« des Dorfes sowohl bei
dem Bräutigam wie bei der Braut zu vollziehen hatte, während dieselben
niedergekauert im Kreise ihrer Angehörigen von gleichem Geschlecht da-
sassen. Hätte sich auch nicht ein so gewichtiger Zeuge wie T h . H a h n für
das wirkliche Vorkommen dieser Sitte ausgesprochen, so erschiene die Sache
bei Berücksichtigung der allgemeinen Unfläthigkeit dieser Eingeborenen
keineswegs unglaublich. Wie dem auch sei, jedenfalls hat K o l b e n erkannt,
dass »Nichts so von Weitläufftigkeiten entfernet ist als der Hottentotten Weise
zu löffeln (zu freien)«, was gegenüber den sentimental aufgeputzten Liebesund
Hochzeitsgeschichten mancher neuerer Autoren ein unstreitiger Vorzug
ist. Auch die Schmauserei, ein unerlässliches Stück jeder Festlichkeit der
Eingeborenen, darf man nicht als ein legales Erforderniss für die Gültigkeit
einer Ehe betrachten, dazu genügt die Zustimmung der Väter, alles Uebrige
dient nur zur Erhöhung der Lustbarkeit.
Gerade bei einer Hochzeit pflegt die Liberalität der Wirthe eine grosse
zu sein, und das Fest dauert daher bis in den nächsten Tag hinein,
indem gegessen wird, bis die Gäste so vollgestopft sind, dass eine Pause
eintreten muss, dann kreisen die Tabacks— oder JDacha- Pfeifen und man
ruht, bis das Essen von Neuem beginnen kann. Es ist erstaunlich, welche
enormen Quantitäten die Eingeborenen im Zeitraum von wenigen Stunden
ohne sichtbaren Nachtheil für ihre Gesundheit verschlingen können; dies
Schlingen lässt sich nur mit dem einer Riesen-Schlange vergleichen, und
sie liegen in den Pausen auch in gleicher Weise still, indem der Tanz bei
den in Rede stehenden Gelegenheiten nicht beliebt wird. Eigenthümlich
ist es, dass die Unsitte des Dacha - Rauchens auch bei den Koi-koin, und
zwar in noch stärkerem Grade hervortritt als bei den A-bantu, sowie dass
dieselbe in die ältesten Zeiten der Ueberlieferungen hinaufreicht; denn schon
im Jahre 1658 wird in den Journalen des Commandanten dieser Gebrauch bei
den Hottentotten erwähnt. Sie berauschten sich durch das Rauchen des
Dacha, während berauschende Getränke unter nationalen Verhältnissen
weniger von ihnen benutzt zu sein scheinen, obgleich sie keine grössere
Leidenschaft kennen, als den Genuss von Spirituosen.
Ganz ohne Kenntniss in der Bereitung solcher Getränke sind auch die
Koi-koin nicht gewesen, doch konnten sie etwas dem Kafferbier Aehnliches