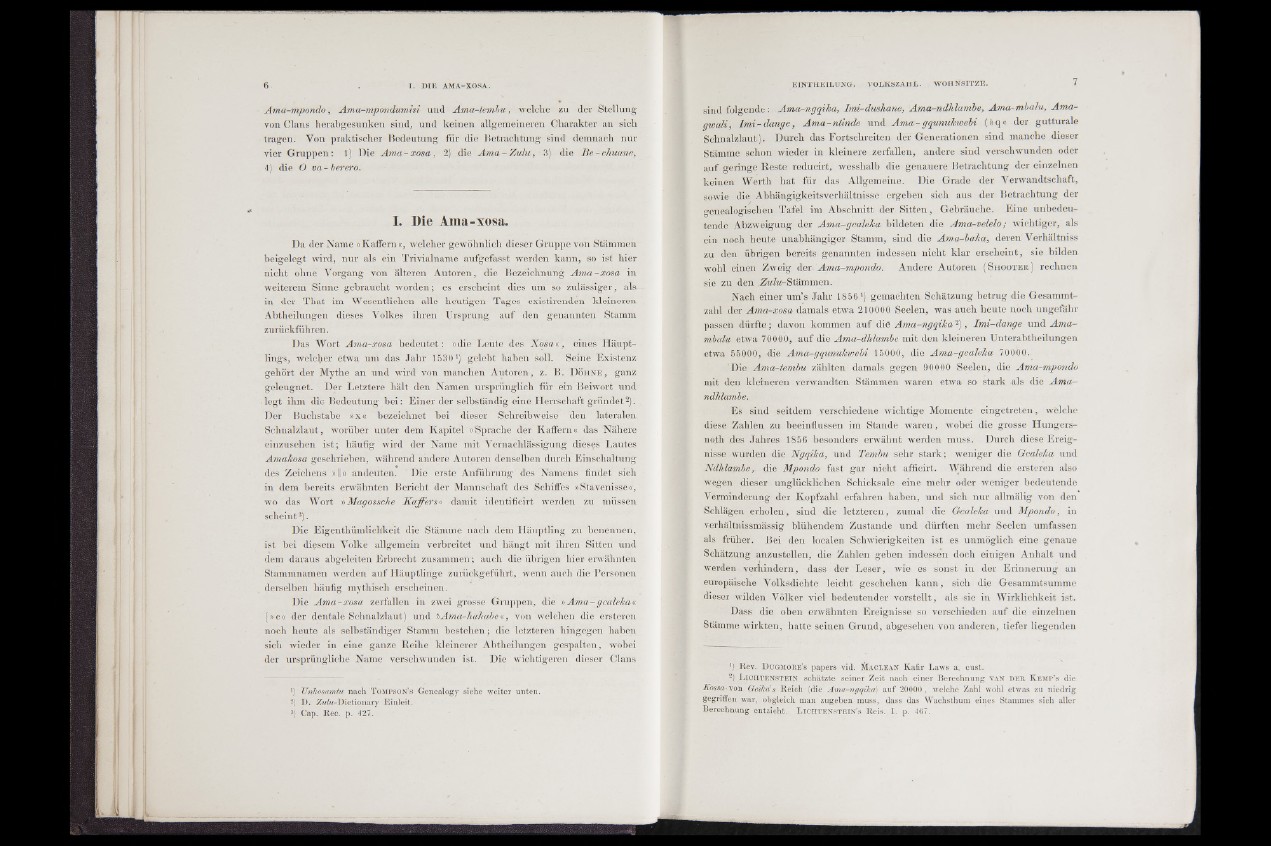
Ama-mpondo, Ama-mpondumisi und Ama-temhu, welche zu der Stellung
von Clans herabgesunken sind, und keinen allgemeineren Charakter an sich
tragen. Von praktischer Bedeutung für die Betrachtung sind demnach nur
vier Gruppen: 1) Die Am a -x o sa , 2) die Am a -Z u lu , 3) die Be-chuane,
4) die 0 vq,- herero.
I. Die Ama-xosa.
Da der Name »Kaffern«, welcher gewöhnlich dieser Gruppe von Stämmen
beigelegt wird, nur als ein Trivialname aufgefasst werden kann, so ist hier
nicht ohne Vorgang von älteren Autoren, die Bezeichnung Ama-xosa in
weiterem Sinne gebraucht worden; es erscheint dies um so zulässiger, als
in der That im Wesentlichen alle heutigen Tages existirenden kleineren
Abtheilungen dieses Volkes ihren Ursprung auf den genannten Stamm
zurückführen.
Das Wort Ama-xosa bedeutet: »die Leute des Xo sa«,, eines Häuptlings,
welcher etwa um das Jahr 1530 ^ gelebt haben soll. Seine Existenz
gehört der Mythe an und wird von manchen Autoren, z. B. Döhne, ganz
geleugnet. Der Letztere hält den Namen ursprünglich für ein Beiwort und
legt ihm die Bedeutung bei: Einer der selbständig eine Herrschaft gründet2)!
Der Buchstabe »x« bezeichnet bei dieser Schreibweise den lateralen
Schnalzlaut, worüber unter dem Kapitel »Sprache der Kaifern« das Nähere
einzusehen ist; häufig wird der Name mit Vernachlässigung dieses Lautes
Amakosa geschrieben, während andere Autoren denselben durch Einschaltung
des Zeichens »||« andeilten. Die erste Anführung des Namens findet sich
in dem bereits erwähnten Bericht der Mannschaft des Schiffes »Stavenisse«,
wo das Wort »Magossche Kaffers« damit identificirt werden zu müssen
scheint3).
Die Eigenthümlichkeit die Stämme nach dem Häuptling zu benennen,
ist bei diesem Volke allgemein verbreitet und hängt mit ihren Sitten und
dem daraus abgeleiten Erbrecht zusammen ; auch die übrigen hier erwähnten
Stammnamen werden auf Häuptlinge zurückgeführt, wenn auch die Personen
derselben häufig mythisch erscheinen.
Die Ama-xosa zerfallen in zwei grosse Gruppen, die »Ama-gcalekaa.
(»c« der dentale Schnalzlaut) und ^Ama-hahabe«, von welchen die ersteren
noch heute als selbständiger Stamm bestehen; die letzteren hingegen haben
sich wieder in eine ganze Reihe kleinerer Abtheilungen gespalten, wobei
der ursprüngliche Name verschwunden ist. Die wichtigeren dieser Clans
0 TJnkosamtu nach T om p so n ’s Genealogy siehe weiter unten.
2) D. Zw/w-Dictionary Einleit.
3) Cap. Rec. p. 427.
sind folgende: Ama-ngqika, Imi-dushane, Ama-ndhlambe, Ama-mbalu, Ama-
gwali, lm i-d a n g e , Ama-ntinde und Ama - gqunukwebi (»q« der gutturale
Schnalzlaut). Durch das Fortschreiten der Generationen sind manche dieser
Stämme schon wieder in kleinere zerfallen, andere sind verschwunden oder
auf geringe Reste reducirt, wesshalb die genauere Betrachtung der einzelnen
keinen Werth hat für das Allgemeine. Die Grade der Verwandtschaft,
sowie die Abhängigkeitsverhältnisse ergeben sich aus der Betrachtung der
genealogischen Tafel im Abschnitt der Sitten, Gebräuche. Eine unbedeutende
Abzweigung, der Ama-gcaleka bildeten die Ama-velelo; wichtiger, als
ein noch heute unabhängiger Stamm, sind die Ama-baka, deren Verhältniss
zu den übrigen bereits genannten indessen nicht klar erscheint, sie bilden
wohl einen Zweig der Ama-mpondo. Andere Autoren ( S h o o t e r ) rechnen
sie zu den Zw/w-Stämmen.
Nach einer um’s Jahr 1856 -1) gemachten Schätzung betrug die Gesammt-
zalil der Ama-xosa damals etwa 210000 Seelen, was auch heute noch ungefähr
passen dürfte; davon kommen auf die Ama-ngqika2) , lmi-dange und Ama-
mbalu etwa 70000, auf die Ama-dhlambe mit den kleineren Unterabtheilungen
etwa 55000, die Ama-gqunukwebi 15000, die Ama-gcaleka 70000.
'Die Ama-tembu zählten damals gegen 90000 Seelen, die Ama-mpondo
mit den kleineren verwandten Stämmen waren etwa so stark als die Am a -
ndhlambe.
Es sind seitdem verschiedene wichtige Momente eingetreten, welche
diese Zahlen zu beeinflussen im Stande waren, wobei die grosse Hungers-
noth des Jahres 1856 besonders erwähnt werden muss. Durch diese Ereignisse
wurden die Ngqika, und Tembu sehr stark; weniger die Gcaleka und
Ndhlambe, die Mpondo fast gar nicht afficirt. Während die ersteren also
wegen dieser unglücklichen Schicksale eine mehr oder weniger bedeutende
Verminderung der Kopfzahl erfahren haben, und sich nur allmälig von den
Schlägen erholen, sind die letzteren, zumal die Gcaleka und Mpondo, in
verhältnissmässig blühendem Zustande und dürften mehr Seelen umfassen
als früher. Bei den localen Schwierigkeiten ist es unmöglich eine genaue
Schätzung anzustellen, die Zahlen geben indessen doch einigen Anhalt und
werden verhindern, dass der Leser, wie es sonst in der Erinnerung an
europäische Volksdichte leicht geschehen kann, sich die Gesammtsumme
dieser wilden Völker viel bedeutender vorstellt, als sie in Wirklichkeit ist.
Dass die oben erwähnten Ereignisse so verschieden auf die einzelnen
Stämme wirkten, hatte seinen Grund, abgesehen von anderen, tiefer liegenden
q Rev. D u gm o r e ’s papers vid. I^ a c l e a n Kafir Laws a. cust.
2) L ic h t e n s t e in schätzte seiner Zeit nach einer Berechnung van d e r K em p ’s die
Kossa- von Geika's Reich (die Ama-ngqika) auf 20000, welche Zahl wohl etwas zu niedrig
gegriffen war, obgleich man zugeben muss, dass das Wachsthum eines Stammes sich aller
Berechnung entzieht. L ic h t e n s t e in ’s Reis. I. p. 467.