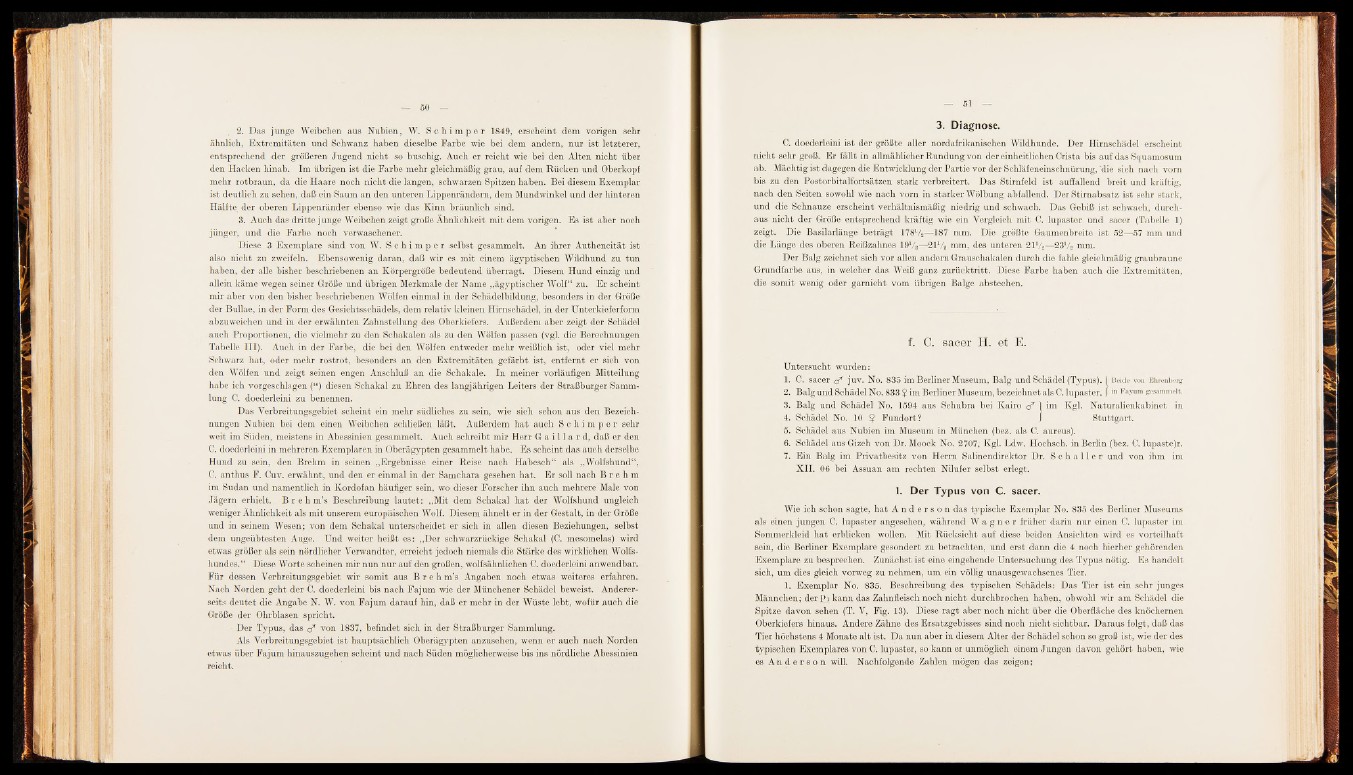
2. Das junge Weibchen aus Nubien, W. S c h im p e r 1849, erscheint dem vorigen sehr
ähnlich, Extremitäten und Schwanz haben dieselbe Farbe wie bei dem ändern, nur ist letzterer,
entsprechend der größeren Jugend nicht so buschig. Auch er reicht wie bei den Alten nicht über
den Hacken hinab. Im übrigen ist die Farbe mehr gleichmäßig grau, auf dem Rücken und Oberkopf
mehr rotbraun, da die Haare noch nicht die langen, schwarzen Spitzen haben. Bei diesem Exemplar
ist deutlich zu sehen, daß ein Saum an den unteren Lippenrändern, dem Mundwinkel und der hinteren
Hälfte der oberen Lippenränder ebenso wie das Kinn bräunlich sind.
3. Auch das dritte junge Weibchen zeigt große Ähnlichkeit mit dem vorigen. Es ist aber noch
jünger, und die Farbe noch verwaschener.
Diese 3 Exemplare sind von W. S c h im p e r selbst gesammelt. An ihrer Authencität ist
also nicht zu zweifeln. Ebensowenig daran, daß wir es mit einem ägyptischen Wildhund zu tun
haben, der alle bisher beschriebenen an Körpergröße bedeutend überragt. Diesem Hund einzig und
allein käme wegen seiner Größe und übrigen Merkmale der Name „ägyptischer Wolf“ zu. Er scheint
mir aber von den bisher beschriebenen Wölfen einmal in der Schädelbildung, besonders in der Größe
der Bullae, in der Form des Gesichtsschädels, dem relativ kleinen Hirnschädel, in der Unterkieferform
abzuweichen und in der erwähnten Zahnstellung des Oberkiefers. Außerdem aber zeigt der Schädel
auch Proportionen, die vielmehr zu den Schakalen als zu den Wölfen passen (vgl. die Berechnungen
Tabelle III). Auch in der Farbe, die bei den Wölfen entweder mehr weißlich ist, oder viel mehr
Schwarz hat, oder mehr rostrot, besonders an den Extremitäten gefärbt ist, entfernt er sich von
den Wölfen und zeigt seinen engen Anschluß an die Schakale. In meiner vorläufigen Mitteilung
habe ich vorgeschlagen (16) diesen Schakal zu Ehren des langjährigen Leiters der Straßburger Sammlung
C. doederleini zu benennen.
Das Verbreitungsgebiet scheint ein mehr südliches zu sein, wie sich schon aus den Bezeichnungen
Nubien bei dem einen Weibchen schließen läßt. Außerdem hat auch S c h im p e r sehr
weit im Süden, meistens in Abessinien gesammelt. Auch schreibt mir Herr G a i l l a r d , daß er den
C. doederleini in mehreren. Exemplaren in Oberägypten gesammelt habe. Es scheint das auch derselbe
Hund zu sein, den Brehm in seinen „Ergebnisse einer Reise nach Habesch“ als „Wolfshund“ ,
C. anthus F. Cu v. erwähnt, und den er einmal, in der Samchara gesehen hat. Er soll nach B r e hm
im Sudan und namentlich in Kordofan häufiger sein, wo dieser Forscher ihn auch mehrere Male von
Jägern erhielt. B r e hm’s Beschreibung lautet: „Mit dem Schakal hat der Wolfshund ungleich
weniger Ähnlichkeit als mit unserem europäischen Wolf. Diesem ähnelt er in der Gestalt, in der Größe
und in seinem Wesen; von dem Schakal unterscheidet er sich in allen diesen Beziehungen, selbst
dem ungeübtesten Auge. Und weiter heißt es: „Der schwarzrückige Schakal (C. mesomelas) wird
etwas größer als sein nördlicher Verwandter, erreicht jedoch niemals die Stärke des wirklichen Wolfshundes.“
Diese Worte scheinen mir nun nur auf den großen, wolfsähnlichen C. doederleini anwendbar.
Für dessen Verbreitungsgebiet wir somit aus B r e h m’s Angaben noch etwas weiteres erfahren.
Nach Norden geht der C. doederleini bis nach Fajum wie der Münchener Schädel beweist. Andererseits
deutet die Angabe N. W. von Fajum darauf hin, daß er mehr in der Wüste lebt, wofür auch die
Größe der Ohrblasen spricht.
Der Typus, das <3* von 1837, befindet sich in der Straßburger Sammlung.
Als Verbreitungsgebiet ist hauptsächlich Oberägypten anzusehen, wenn er auch nach Norden
etwas über Fajum hinauszugehen scheint und nach Süden möglicherweise bis ins nördliche Abessinien
reicht.
3. Diagnose.
C. doederleini ist der größte aller nordafrikanischen Wildhunde. Der Hirnschädel erscheint
nicht sehr groß. Er fällt in allmählicher Rundung von der einheitlichen Crista bis auf das Squamosum
ab. Mächtig ist dagegen die Entwicklung der Partie vor der Schläfeneinschnürung, 'die sich nach vorn
bis zu den Postorbitalfortsätzen stark verbreitert. Das Stirnfeld ist auffallend breit und kräftig,
nach den Seiten sowohl wie nach vorn in starker Wölbung abfallend. Der Stirnabsatz ist sehr stark,
und die Schnauze erscheint verhältnismäßig niedrig und schwach. Das Gebiß ist schwach, durchaus
nicht der Größe entsprechend kräftig wie ein Vergleich mit C. lupaster und sacer (Tabelle 1)
zeigt. Die Basilarlänge beträgt 178x/2— 187 mm. Die größte Gaumenbreite ist 52— 57 mm und
die Länge des oberen Reißzahnes 1972—2172 mm, des unteren 2172—2372 mm.
Der Balg zeichnet sich vor allen ändern Grauschakalen durch die fahle gleichmäßig graubraune
Grundfarbe aus, in welcher das Weiß ganz zurücktritt. Diese Farbe haben auch die Extremitäten,
die somit wenig oder garnicht vom übrigen Balge abstechen.
f. 0. sacer H. et E.
Untersucht wurden:
1. C. sacer q* juv. No. 835 im Berliner Museum, Balg und Schädel (Typus). ) Beide von Ehrenberg
2. Balg und Schädel No. 833 ? im Berliner Museum, bezeichnet als C. lupaster. J in Fayum gesammelt.
3. Balg und Schädel No. 1594 aus Schubra bei Kairo o* \ ini Kgl. Naturalienkabinet in
4. Schädel No. 10 $ Fundort? j Stuttgart.
5. Schädel aus Nubien im Museum in München (bez. als C. aureus).
6. Schädel aus Gizeh von Dr. Moock No. 2707, Kgl. Ldw. Hochsch. in Berlin (bez. C. lupaste)r.
7. Ein Balg im Privatbesitz von Herrn Salinendirektor Dr. S c h a l l e r und von ihm im
XII. 06 bei Assuan am rechten Nilufer selbst erlegt.
1. Der Typus von C. sacer.
Wie ich schon sagte, hat A n d e r s o n das typische Exemplar No. 835 des Berliner Museums
als einen jungen C. lupaster angesehen, während Wa g n e r früher darin nur einen C. lupaster im
Sommerkleid hat erblicken wollen. Mit Rücksicht auf diese beiden Ansichten wird es vorteilhaft
sein, die Berliner Exemplare gesondert zu betrachten, und erst dann die 4 noch hierher gehörenden
Exemplare zu besprechen. Zunächst ist eine eingehende Untersuchung des Typus nötig. Es handelt
sich, um dies gleich vorweg zu nehmen, um ein völlig unausgewachsenes Tier.
1. Exemplar No. 835. Beschreibung des typischen Schädels: Das Tier ist ein sehr junges
Männchen; der Pi kann das Zahnfleisch noch nicht durchbrochen haben, obwohl wir am Schädel die
Spitze davon sehen (T. V, Fig. 13). Diese ragt aber noch nicht über die Oberfläche des knöchernen
Oberkiefers hinaus. Andere Zähne des Ersatzgebisses sind noch nicht sichtbar. Daraus folgt, daß das
Tier höchstens 4 Monate alt ist. Da nun aber in diesem Alter der Schädel schon so groß ist, wie der des
typischen Exemplares von C. lupaster, so kann er unmöglich einem Jungen davon gehört haben, wie
es A n d e r s o n will. Nachfolgende Zahlen mögen das zeigen;