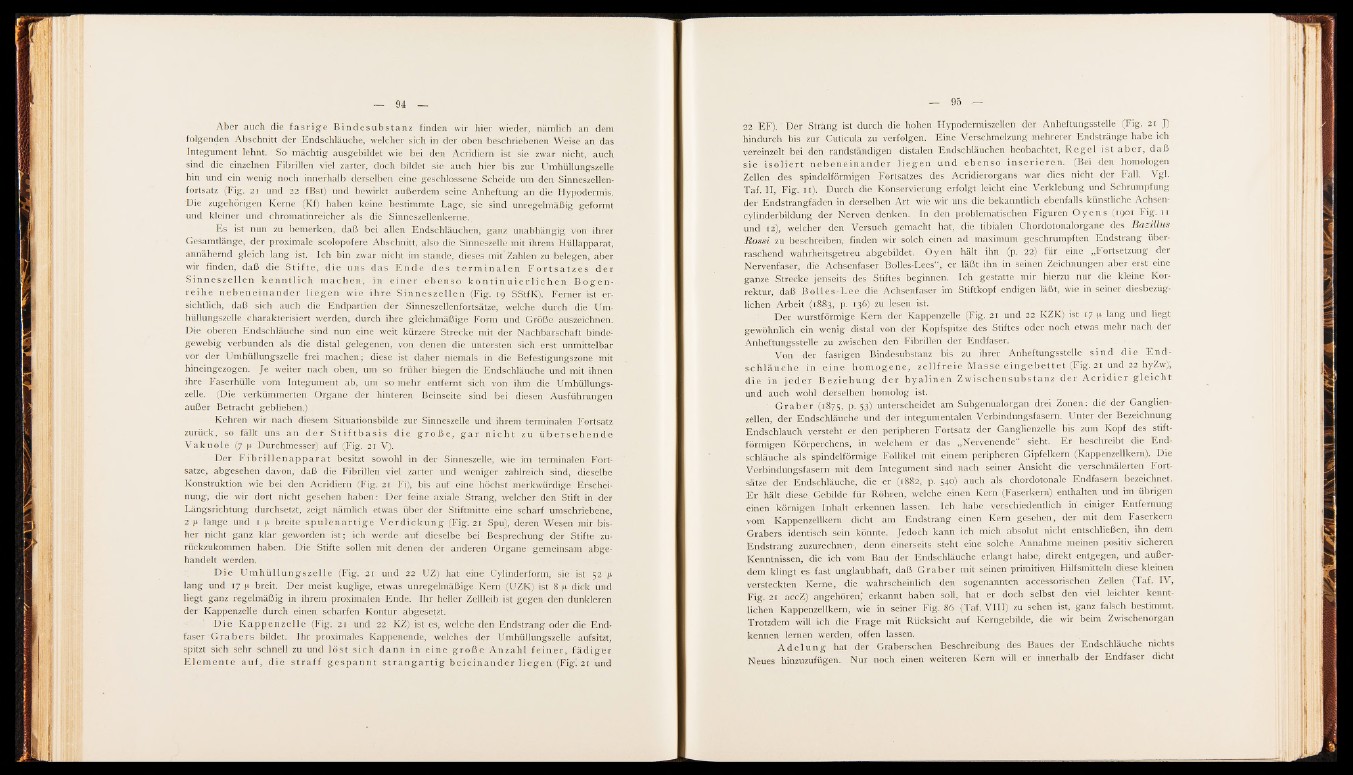
Aber auch die f a s r ig e B in d e s u b s ta n z finden wir hier wieder, nämlich an dem
folgenden Abschnitt der Endschläuche, welcher sich in der oben beschriebenen Weise an das
Integument lehnt. So mächtig ausgebildet wie bei den Acridiern ist sie zwar nicht, auch
sind die einzelnen Fibrillen viel zarter, doch bildet sie auch hier bis zur Umhüllungszelle
hin und ein wenig noch innerhalb derselben eine geschlossene Scheide um den Sinneszellenfortsatz
(Fig. 21 und 22 fBst) und bewirkt außerdem seine Anheftung an die Hypodermis.
Die zugehörigen Kerne (Kf) haben keine bestimmte Lage, sie sind unregelmäßig geformt
und kleiner und chromatinreicher als die Sinneszellenkeme.
Es ist nun zu bemerken, daß bei allen Endschläuchen, ganz unabhängig von ihrer
Gesamtlänge, der proximale scolopofere Abschnitt, also die Sinneszelle mit ihrem Hüllapparat,
annähernd gleich lang ist. Ich bin zwar nicht im Stande, dieses mit Zahlen zu belegen, aber
wir finden, daß die S t i f t e , die uns das E n d e d e s t e rm in a le n F o r t s a t z e s d e r
S in n e s z e lle n k e n n t lic h m a ch e n , in e in e r e b en so k o n t in u i e r l i c h e n B o g e n r
e ih e n e b e n e in a n d e r l ie g e n w ie ih r e S in n e s z e lle n (Fig. 19 SStfKjJlFerner ist ersichtlich,
daß sich auch die Endpartien der Sinneszellenfortsätze, welche durch die Umhüllungszelle
charakterisiert werden, durch ihre gleichmäßige Form und Größe auszeichnen.
Die oberen Endschläuche sind nun eine weit kürzere Strecke mit der Nachbarschaft bindegewebig
verbunden als die distal gelegenen, von denen die untersten sich erst unmittelbar
vor der Umhüllungszelle frei machen; diese ist daher niemals in die Befestigungszone mit
hineingezogen. Je weiter nach oben, um so früher biegen die Endschläuche und mit ihnen
ihre Faserhülle vom Integument ab, um so mehr entfernt sich von ihm die Umhüllungszelle.
(Die verkümmerten Organe der hinteren Beinseite sind bei diesen Ausführungen
außer Betracht geblieben.)
Kehren wir nach diesem Situationsbilde zur Sinneszelle und ihrem terminalen Fortsatz
zurück, so fällt uns an d e r S t i f t b a s i s d ie g r o ß e , g a r n i c h t zu ü b e r s e h e n d e
V a k u o le (7 fx Durchmesser) auf (Fig. 21 V).
Der F ib r i l l e n a p p a r a t besitzt sowohl in der Sinneszelle, wie im terminalen Fortsatze,
abgesehen davon, daß die Fibrillen viel zarter und weniger zahlreich sind, dieselbe
Konstruktion wie bei den Acridiern (Fig. 21 Fi), bis auf eine höchst merkwürdige Erscheinung,
die wir dort nicht gesehen haben: Der feine axiale Strang, welcher den Stift in der
Längsrichtung durchsetzt, zeigt nämlich etwas über der Stiftmitte eine scharf umschriebene,
2 p lange und 1 h- breite .s p u le n a r t ig e V e r d i c k u n g (Fig. 21 Spu), deren Wesen mir bisher
nicht ganz klar geworden ist; ich werde auf dieselbe bei Besprechung der Stifte zurückzukommen
haben. Die Stifte sollen mit denen der anderen Organe gemeinsam abgehandelt
werden.
D ie U m h ü llu n g s z e lle (Fig. 21 und 22 UZ) hat eine Cylinderform, sie ist 52 fx
lang und 17 jx breit. Der meist kuglige, etwas unregelmäßige Kern (UZK) ist 8 |x dick und
liegt ganz regelmäßig in ihrem proximalen Ende. Ihr heller Zellleib ist gegen den dunkleren
der. Kappenzelle durch einen scharfen Kontur abgesetzt.
D ie K a p p e n z e l le (Fig. 21 und 22 KZ) ist es,-welche den Endstrang oder die Endfaser
G r ä b e r s bildet. Ihr proximales Kappenende, welches der Umhüllungszelle aufsitzt,
spitzt sich sehr schnell zu und lö s t s ich dan n in e in e g r o ß e A n z a h l fe in e r , fä d ig e r
E lem e n te a u f , d ie s t r a f f g e sp a n n t s t r a n g ä r t ig b e ie in a n d e r l ie g e n (Fig! 21 und
22 EF). ‘ Der Sträng ist durch die hohen Hypode'rmiszellen der Anheftungsstélle (Fig. 21 J)
hindurch bis zur Cuticula zu verfolgen. Eine Verschmelzung mehrerer Endstränge habe ich
vereinzelt bei den randständigen distalen Endschläuchen béobachtet, R e g e l is t a b e r , d aß
s ie i s o l ie r t n e b e n e in a n d e r l ie g e n und e b en so in s e r ie r e n . (Bei den homologen
Zellen des spindelförmigen Fortsatzes des Acridierorgans war dies nicht der Fall. Vgl.
Taf. II, Fig. 11). Durch die Konservierung erfolgt leicht eine Verklebung und Schrumpfung
der Endstrangfäden in derselben Art wie wir uns die bekanntlich ebenfalls künstliche Achsen-
cylinderbildung der Nerven denken. In den problematischen Figüren O y e n s (1901 Fig. 11
und 12), welcher den Versuch gemacht hat, die tibialen Chordotonalorgane des Bazillus
Rossi zu beschreiben, finden wir solch einen ad máximum geschrumpften Endstrang überraschend
wahrheitsgetreu abgebildet. O y en hält ihn (p. 22) für eine „Fortsetzung der
Nervenfaser, die Achsenfaser Bolles-Lees“ , er läßt ihn in seinen Zeichnungen aber erst eine
ganze Strecke jenseits des Stiftes beginnen. Ich gestatte mir hierzu nur die kleine Korrektur,
daß B o l le s -L e e die Achsenfaser im Stiftkopf endigén läßt, wie in seiner diesbezüglichen
Arbeit (1883, p. 136) zu lesen ist.
Der würstförmige Kern der Kappenzelle (Fig. 21 und 22 KZK) ist 17 M- lang und liegt
gewöhnlich ein wenig distal von der Kopfspitze des Stiftes oder noch etwas mehr nach: der
Anheftungsstelle zu zwischen den Fibrillen der Endfaser.
Von der fasrigen Bindesubstanz bis zu ihrer Anheftungsstelle s in d d ie E h d-
s c h lä u c h e in e in e h om o g en e , z e l l f r e i e M a s s e e in g e b e t t e t (Fig. 21 und 22 hyZw);
d ie in je d e r B e z ie h u n g d er h y a lin e n Z w is c h e n su b s ta n z d er A c r id ie r g le i c h t
und auch wohl derselben homolog ist.
•- G r ä b e r » 5:5, p. 53} untersiäheidet am Subgsáualorgan drei Zonen: die der Ganglien:
gellen, d i f Endschläuche und der integumentalen Vcrbinriungsfascrn. Unter der Bezeichnung
Endschlauch «ersteht er den peripheren f|irtsatz den .Ganglienzelte:- bis. zum Kopf des stiftförmigen
Körperchens, in welchem er das „Nervenende sieht. Er beschreibt die End-
Äh läuch e als spindelförmige Follikel mit einem peripheren Gipfelkern (Kappenzellkern).,||ie
Verbindungsfasern mit dem Integument sind nach seiner Ansicht die verschmälerten Fort-
säfze der Endschläuche, die er (1882,. p. 540) auch als chordotonaleppndfasem bezeichnet.
Er hält diese...Gebilde für Röhren, welche einen Kern (Easerkern) enthalten und im übrigen
einen körnigen Inhalt erkennen lassen. Ich habe verschiedentlich in einiger Entfernung
vom Kappenzellkern dicht am Endstrang einen Kern gesehen, der mit dem Faserkern
Gräbers identisch sein könnte.4: Jedoch kann ich mich absolut nicht entschließen, ihn dem
Endstrang zuzurechnen', denn einerseits: steht, eine solche Annahme meinen positiv sicheren
Kenntnissen, die ich vom Bau der Endschläuche erlangt habe, direkt entgegen, und außerdem
klingt es fast unglaubhaft, daß g r a b er mit seinen primitiven Hilfsmitteln diese kleinen
versteckten Kerne, die wahrscheinlich den Hpgenannten accessprischen Zellen (Taf. IV,
Fig. 21 aceZ) angehören; erkannt haben soll, hat er doch gelbst den viel leichter kenntlichen
Kappenzellkern, wie in seiner Fig.* 86 (Taf. VIII) zu sehen ist, ganz falsch bestimmt.
Trotzdem will ich die Frage mit Rücksicht auf Kerngebilde, die wir beim Zwischenorgan
kennen lernen werden, offen lassen.
A d e lu n g hat der Graberschen Beschreibung des Baues der Endschläuche nichts
Neues hinzuzufügen. Nur noch einen weiteren Kern will er innerhalb der Endfaser dicht