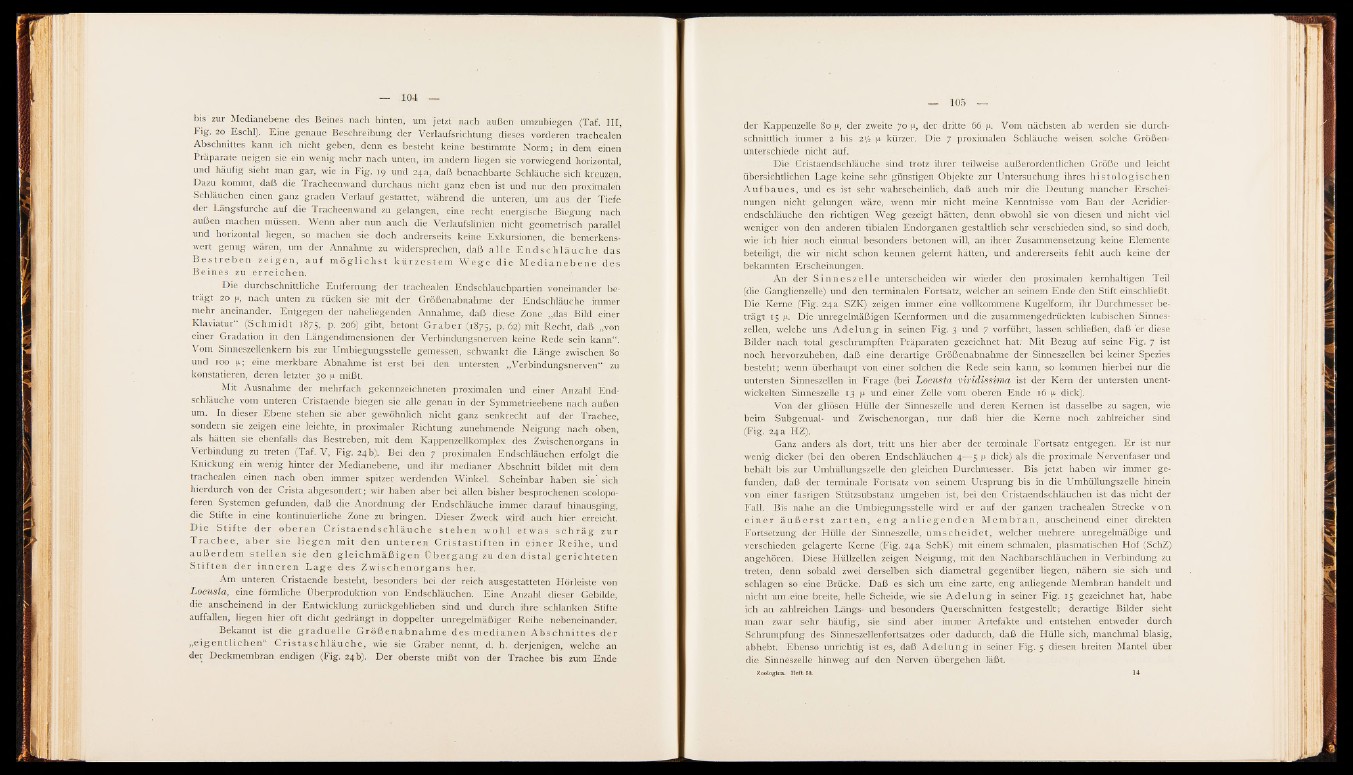
bis zur Medi'anèbene dés Beines, nach hinten, um jetzt nach außen umzubiêg-én K i . i l l j
Fig. 20 Eschl). Eine genaue B||ÊMreibung der Verlaufsrichtung dieses vorderen trachealen
Abschnittes kann ich nicht geben, denn es besteht keine béstimmté'vNorm ; in dem einen
Präparate neigen s.^e ein wenig mehr nach unten, im ändern liegen sie . vorwiegend horizontal,
und häufig sieht man gar, wie in Fig. 19? und 24a, daß benachbarte Schläuche sich' kreuzen.
Dazu kommt, daß die Tracheenwand durchaus? nicht ganz eben..St und nur den proximalen
Schläuchen einen ganz graden Verlauf gesittet; während die'? unteren, um äus, der Tiefe?
der Längsfurche auf die Traeheenwand zu gelangen, eine | |® t energische B ie g u n g nach
außen machen müssen. Wehn aber nun auch die Verlaufslinien nicht geometrisch parallel?
und horizontal liegen, so machen sie doch andrersêits_ keine Exkursionen, die bemerkenswert
genug wären, uni der Annahme zu widersprechen, daß a l l e E n d s c h lä u e rh e d i s
B e s t r e b e n z e ig e n , a u f m ö g l i c h s t k ü r z e s t em Weg.e d ie M ed iä n e b ? e n e d e s
Beines- zu errei?chen.
Die durchschnittliche Entfernung der trachealen Endschlauchpartien voneinander beträgt
2S P, nach unten zu rücken sie mit der SrÖßenabnahme der. V.ndschläuehe immer
mehr aneinander. Entgegen der naheliegenden Annahme, daß diese Zone „das Bild einer
Klaviatur“ .'{Schmidt 1875, P- gibt, betont G r ä b e r (1875, p ÿ | | mit RaMt, d aM ;^ -
einer Gradation in den Längeridimensionen' der Verbindungsnerven keine Berjejllfjin kann“ .
Vom Sinneszellenkern bis zräjHmbiegungsstelle g enasen, schwankt die Langé?.' iwïsêhen f t
und 100 [x- eine merkbare Abnahme ist erst bei den. untersten „Verbindungsnerven“ zu
konstatieren, deren letzter 30 a mißt.?,.; ;
Mit Ausnahme der mehrfach gekennzffÿhnetéàr proximalen und einer Anzatti End-
schläüche vom unteren Gristaende ibiegen sie alle genau in der: Symmefpssäbene nach außen
um. In dieser Ebene stehen sie aber gewöhnlich nicht ganz senkrecht auf der ijjäöbiis;
sondern sie zeigen einsideïchte,. in proximaler Richtung zunehmende Neigung nach oben,
als hätten sie ebenfalls das Bestreben, mit dem Kappenzellkomplex des ?Zwischenö"r.gans in
Verbindung zu treten (ÎFaf. V, Fig. 24b), Be isfen 7 proximalen En^schläuchen erfolgt die
Knickung ein wenig hinter der Medianebene, und ihr medianer Abschnitt bildet mit dem
trachealen einen nach oben immer spitzer werdenden Winkel. ¿¡¡Scheinbar habenggie'sich
hierdurch, von der Crista abgesondert ; wir haben aber bei allen bisher besprochenem scolopo-
feren. Systemen gefunden, daß die Anordnung dercindsehîauche. immer darauf' hinausgiing,
die Stifte in eine kontinuierliche Zone zu bringen. Dieser Zweck wird?jauch hier erreicht:
D ie S t ifte , d er o b e r e n C r is ta e n d s c h lä u c h e s t e h e n w o h l e tw a s s c h r ä g zu r
T r a c h e e , a b e r s ie l ie g e n m it d en unterem .C r is ta s t i f te n in e in e r R e ih e ,, und
a u ß e r d em s t e lle n s ie den g le i c h m ä ß ig e n .Ü b e r g a n g zu den d is ta l g e r ic h t e t e n
S t i f t e n de-i in n e r e n L a g o des Z w ijg jh e n o r g a n s her.
Am unteren Cfisfaende besteht, besonders. bei der reich ausgestatteten Hörlei$te von
Locusta, eine förmliche Überproduktion von Endschläuchen. Eine Anzahl diese#? Gebilde;
die anscheinend in der Entwicklung zurückgeblieben sind und durch ihrei-schlanken Stifte
auffallen, liegen hier oft dicht gedrängt in doppelter unregelmäßiger Reihe nebeneinander:
Bekannt ist die g r a d u e l l e G r ö ß e n a b n a hm e i- ie s m ed ia n en A b s c h n i t t e s der
¿ e ig e n t l ic h e n Cri?sta s c h lä u c h e , wie sie Gräber nennt, d. h. derjenigen, welche an
der Dëckmembran endigen (Fig. 24 h-). Der oberste mißt von der Trachee bis zum Ende
der Kappenzelle 80 y, der zweite 70 y, der dritte 66 y.. Vom nächsten ab werden sie durchschnittlich
immer 2 bis 2% y kürzer. Die 7 proximalen Schläuche weisen solche Größenunterschiede
nicht auf.
Die Cristaendschläuche sind trotz ihrer teilweise außerordentlichen Größe und leicht
übersichtlichen Lage keine sehr günstigen Objekte zur Untersuchung ihres h is to lo g is c h e n
A u fb a u e s , und es ist sehr wahrscheinlich, daß auch mir die Deutung mancher Erscheinungen
nicht gelungen wäre, wenn mir nicht meine Kenntnisse vom Bau der Acridier-
endschläuche den richtigen Weg gezeigt hätten, denn obwohl sie von diesen und nicht viel
weniger von den anderen tibialen Endorganen gestaltlich sehr verschieden sind, so sind doch,
wie ich hier noch einmal besonders betonen will, an ihrer Zusammensetzung keine Elemente
beteiligt, die wir nicht schon kennen gelernt hätten,; und andererseits fehlt auch keine der
bekannten Erscheinungen.
An der S in n e s z e l l e unterscheiden wir wieder den proximalen kernhaltigen Teil
(die Ganglienzelle) und den terminalen Fortsatz, welcher an seinem Ende den Stift einschließt.
Die Kerne (Fig. 24 a SZK) zeigen immer eine vollkommene Kugelform, ihr Durchmesser beträgt
15 y. Die unregelmäßigen Kernformen und die zusammengedrückten kubischen Sinneszellen,
welche uns A d e lu n g in seinen Fig. 3 und 7 vorführt, lassen schließen, daß er diese
Bilder nach total geschrumpften Präparaten gezeichnet hat: Mit Bezug auf seine Fig. 7 ist
noch hervorzuheben, daß eine derartige Größenabnahme der Sinneszellen bei keiner Spezies
besteht; wenn überhaupt von einer solchen die Rede sein kann, so kommen hierbei nur die
untersten Sinneszellen in Frage (bei Locusta viridissima ist der Kern der untersten unentwickelten
Sinneszelle 13 y und einer Zelle vom oberen Ende 16 y dick).
Von der gliösen Hülle der Sinneszelle und deren Kernen ist dasselbe zu sagen, wie
beim Subgenual- und Zwischenorgan, nur daß hier die Kerne noch zahlreicher sind
(Fig. 24 a HZ).
Ganz anders als dort, tritt uns hier aber der terminale Fortsatz entgegen. Er ist nur
wenig dicker (bei den oberen Endschläuchen 4^-5 y dick) als die proximale Nervenfaser und
behält bis zur Ümhüllungszelle den gleichen Durchmesser. Bis jetzt haben wir immer gefunden,
daß der terminale Fortsatz von seinem Ursprung bis in die Umhüllungszelle hinein
von einer fasrigen Stützsubstanz umgeben ist, bei den Cristaendschläuchen ist das nicht der
Fall. Bis nahe an die^Wmbiegungsstelle wird er auf der ganzen trachealen Strecke v o n
e in e r ä u ß e r s t z a r t e n , e n g a n l i e g e n d e n M em b r a n , anscheinend einer direkten
Fortsetzung der Hülle der Sinneszelle, um s c h e id e t, welcher mehrere unregelmäßige und
verschieden gelagerte Kerne (Fig. 24a SchK) mit einem schmalen, plasmatischen Hof (SchZ)
angehören. Diese Hüllzellen zeigen Neigung, mit den Nachbarschläuchen in Verbindung zu
treten, denn sobald zwei derselben sich diametral gegenüber liegen, nähern sie sich und
schlagen so eine Brücke. Daß es sich um eine zarte, eng anliegende Membran handelt und
nicht um.eine breite, helle Scheide, wie sie A d e lu n g in seiner Fig. 15 gezeichnet hat, habe
ich än zahlreichen Längs- und besonders Querschnitten festgestellt; derartige Bilder sieht
man zwar sehr häufig, sie ‘ sind aber immer Artefakte und entstehen entweder durch
Schrumpfung des Sinneszellenfortsatzes oder dadurch, daß die Hülle sich, manchmal blasig,
abhebt. Ebenso unrichtig ist es, daß A d e lu n g in seiner Fig. 5 diesen breiten Mantel über
die Sinneszelle hinweg auf den Nerven übergehen läßt.
Zoologica. H e ft 60. 1 4