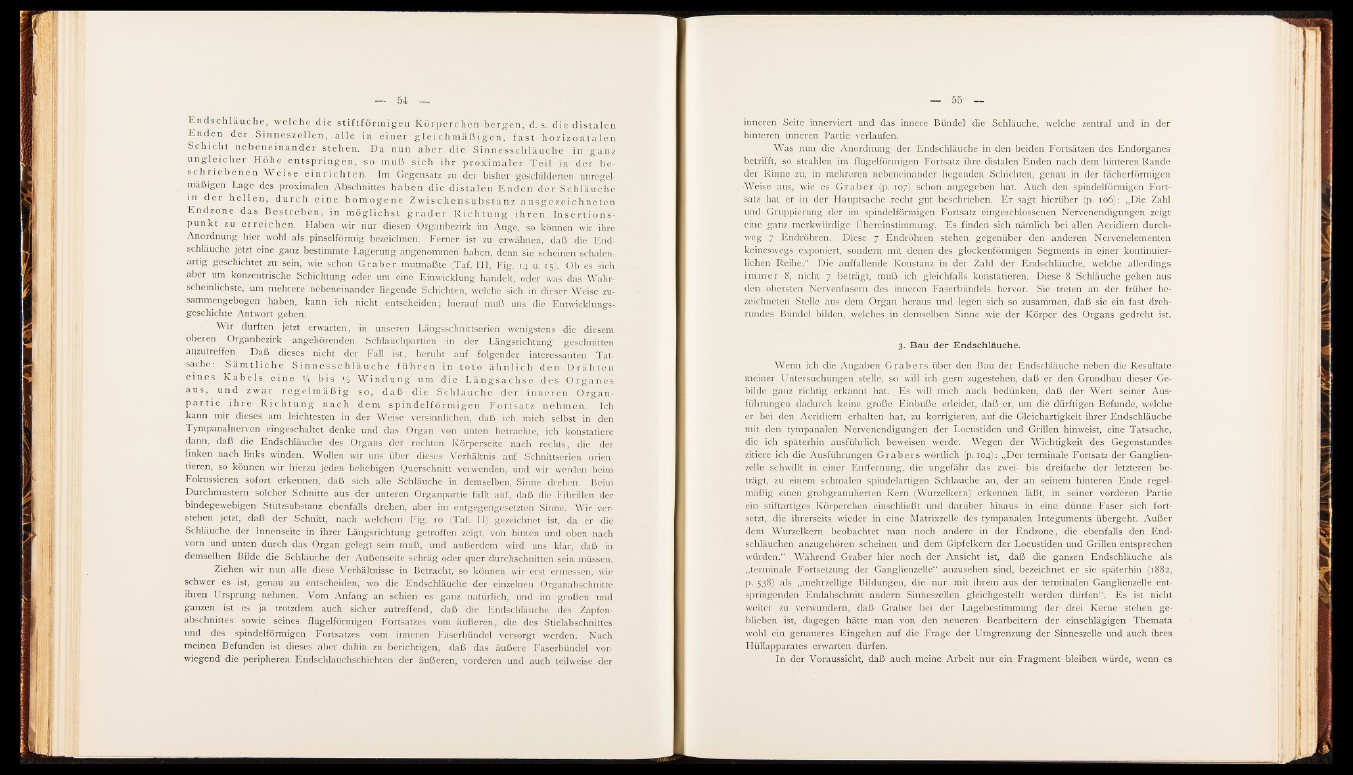
E n d s c h lä u c h e , w e lc h e d ie s t i f t fö rm ig e n K ö r 'p e rch en b e r g e n , d. s:. d ie d is ta le n
E n d e n d er S in n e s z e lle n , a lle in e in e r g le i c h m ä ß ig e n , | | g ä # t■ horSpttSiaälfei
S c h ic h t n e b e n e in a n d e r s teh en . D a nun a b e r d ie ® in n e Ä h l ä u Ä : e ' dn gattzj
u n g le ic h e r H öh e e n t s p r in g e n *® 1 m u ß S i c h ih r p r o x im a le r T e i l in dä# b e s
c h r i e b e n e n W e i s e n in r i c l i ! nn. Im Gegensatz zu der bisher geschilderten unreg'eh
mäßigen Lage des proximalen Abschnittes h a b e n d ie d is ta le n E n d e n "de# S Ä K i i c h e
in d e r h e l l e n , d u r c h e in e i iom ö g e n u ^ Zw i's ch e r .su b s i a nz ausg efz'Vich neten
E n d z o n e das B e s t r e | i |n , in m ö g lic iis t g r a d e r R i c h t u n g ih r e n S Ä e r t io n s -
p u n k t zu e r r e ic h e n . Haben wir nur diesen Organbezirk im Auge, ‘sb können wir ihre
Anordnung hier wohl als pinselförmig bezeichnt!® Ferner ist zu erwähnen, daß die Endschläuche
jetzt eine ganz bestimmte' I.agertrug angenommen haben, denn sie scheinen slljfalen-
artig geschichtet zu |ein, wiegghpn G r ä b e r mutmaßte,(Tafi III, S l i cM u. iM ^ b § 1 Sich
aber um konzentrische Schichtung oder um eine Einwiekhmgfijändelt, oder wäs '$&> Wahrscheinlichste,
um mehrere nebeneinander liegende Bhichten, welche r th . in di&fc WelsH B l
sammengebogen haben, kann ich nicht e%|%cheidsn; hierauf muß uns die Entwicklung!.':
geschichte Antwort geben.
Wir durften jetzt erwarten, in unseren Längsschnittserien wenigstens die diesem
oberen Organbezirk angehörenden Schlauchpartien in der Längsrichtung geschnitten
anzutreffen. Daß dieses nicht der Fall ist, beruht auf folgender interessanten Tatsache
: S äm t l i c h e S in n e s s c h lä u c h e fü h r e n in t o t o ä h n l i c h de n D r ä h t e n
e in e s K a b e l s e in e y* b is % W in d u n g um d ie L ä n g s a c h s e , d e s O r g a n e s
a u s , u n d zw a r r e g e lm ä ß i g so , d a ß d ie S c h lä u c h e d er in n e re n O r g a n p
a r t i e ih r e R i c h t u n g n a c h d em s p in d e l fö rm ig e n F o r t s a t z nehmen. Ich
kann mir dieses am leichtesten in der Weise versinnlichen, daß_ ich mich selbst in den
1 ympanalnerven eingeschaltet denke und das Organ von unten, betrachte, ich konstatiere
dann, daß die Endschläuche des Organs der rechten Körperseite nach rechts, die der
linken nach links winden. Wollen wir uns über dieses Verhältnis auf Schnittserien orientieren,
so können wir hierzu jeden beliebigen Querschnitt verwenden, und wir werden beim
Fokussieren sofort erkennen, daß sich alle Schläuche in demselben Sinne drehen. Beim
Durchmustern solcher Schnitte aus der unteren Organpartie fällt auf, daß die Fibrillen der
bindegewebigen Stützsubstanz ebenfalls drehen, aber im entgegengesetzten Sinne. Wir verstehen
jetzt, daß der Schnitt, nach welchem Fig. io (Taf. II) gezeichnet ist, da er die
Schläuche der Innenseite in ihrer Längsrichtung getroffen zeigt, von hinten Und oben nach
vorn und unten durch das Organ gelegt sein muß, und außerdem wird uns klar, daß in
demselben Bilde die Schläuche der Außenseite schräg oder quer durchschnitten sein müssen.
Ziehen wir nun alle diese Verhältnisse in Betracht, so können wir erst ermessen, wie
schwer es ist, genau zu entscheiden, wo die Endschläuche der einzelnen Organabschnitte
ihren Ursprung nehmen. Vom Anfang an schien es ganz natürlich, und im großen und
ganzen ist es ja trotzdem auch sicher zutreffend, daß die Endschläuche des Zapfenabschnittes
sowie seines flügelförmigen Fortsatzes vom äußeren, die des Stielabschnittes
und des spindelförmigen Fortsatzes vom inneren Faserbündel versorgt werden. Nach
meinen Befunden ist dieses aber dahin zu berichtigen, daß das äußere Faserbündel vorwiegend
die peripheren Endschlauchschichten der äußeren, vorderen und auch teilweise der
inneren Seite innerviert und das innere Bünde! die Schläuche, welche zentral und in der
hinteren inneren Partie verlaufen.
Was nun die Anordnung der Endschläuche in den beiden Fortsätzen des Endorganes
betrifft, so strahlen im flügelförmigen Fortsatz ihre distalen Enden nach dem hinteren Rande
der Rinne zu, in mehreren nebeneinander liegenden Schichten, genau in der fächerförmigen
Weise aus, wie es G r ä b e r (p. 107) . schon angegeben hat. Auch den spindelförmigen Fortsatz
hat er in der Hauptsache recht gut beschrieben. Er sägt hierüber (p. 106): „Die Zahl
und Gruppierung der im spindelförmigen Fortsatz eingeschlossenen Nervenendigungen zeigt
eine ganz merkwürdige Übereinstimmung. Es finden sich nämlich bei allen Acridiern durchweg
7 Endröhren. Diese .7 Endröhren stehen gegenüber den anderen Nervenelementen
keineswegs exponiert, sondern mit denen des glockenförmigen Segments in einer kontinuierlichen
Reihe.“ Die auffallende Konstanz in der Zahl der Endschläuche, welche allerdings
im me r 8y nicht 7 beträgt, muß ich gleichfalls konstatieren. Diese 8 Schläuche gehen aus
den obersten Nervenfasern des inneren Faserbündels hervor. Sie treten an der früher be-
zeichneten Stelle aus dem Organ heraus und legen sich so zusammen, daß sie ein fast drehrundes
Bündel bilden, welches in demselben Sinne wie der Körper des Organs gedreht ist.
3. Bau der Endschläuche.
Wenn ich die Angaben G r ä b e r s über den Bau der Endschläuche neben die Resultate
meiner Untersuchungen stelle, so will ich gern zugestehen, daß er den Grundbau dieser Gebilde
ganz richtig erkannt hat. Es will mich auch' bedünken, daß der Wert seiner Ausführungen
dadurch keine große Einbuße erleidet, daß er, um die dürftigen Befunde, welche
er bei den Acridiern erhalten hat, zu korrigieren, auf die Gleichartigkeit ihrer Endschläuche
mit den tympanalen Nervenendigungen der Locustiden und Grillen hinweist, eine Tatsache,
die ich späterhin ausführlich beweisen werde. Wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes
zitiere ich die Ausführungen G r ä b e r s wörtlich (p. 104): „Der terminale Fortsatz der Ganglienzelle
schwillt in einer Entfernung, die ungefähr das zwei- bis dreifache der letzteren beträgt,
zu einem schmalen spindelartigen Schlauche an, der an seinem hinteren Ende regelmäßig
einen grobgranulierten Kern (Wurzelkern) erkennen läßt, in seiner vorderen Partie
ein stiftartiges Körperchen einschließt und darüber hinaus in eine dünne Faser sich fortsetzt,
die ihrerseits wieder in eine Matrixzelle des tympanalen Integuments übergeht. Außer
dem Wurzelkern beobachtet man noch andere in der Endzone, die ebenfalls den Endschläuchen
anzugehören scheinen und dem Gipfelkern der Locustiden und Grillen entsprechen
würden.“ Während Gräber hier noch der Ansicht ist, daß die ganzen Endschläuche als
„terminale Fortsetzung der Ganglienzelle“ anzusehen sind, bezeichnet er sie späterhin (1882,
p. 538) als „mehrzellige Bildungen, die nur mit ihrem aus der terminalen Ganglienzelle entspringenden
Endabschnitt ändern Sinneszellen gleichgestellt werden dürfen“ . Es ist nicht
weiter zu verwundern, daß Gräber bei der Lagebestimmung der drei Kerne stehen geblieben
ist, dagegen hätte man von den neueren Bearbeitern der einschlägigen Themata
wohl ein genaueres Eingehen auf diö Frage der Umgrenzung der Sinneszelle und auch ihres
Hüllapparates erwarten dürfen.
In der Voraussicht, daß auch meine Arbeit nur ein Fragment bleiben würde, wenn es