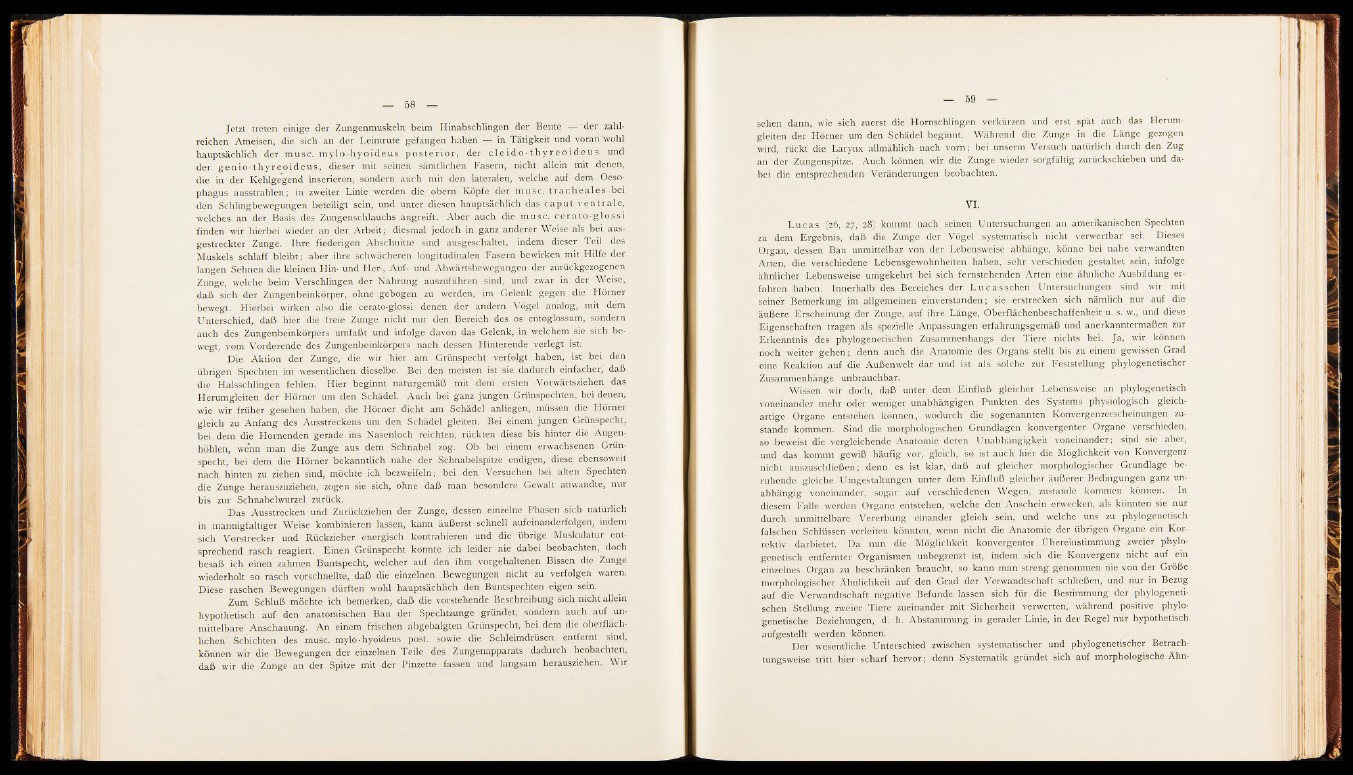
Jetzt treten einige der Zungenmuskeln beim Hinabschlingen der Beute — .'der zahlreichen
Ameisen, die sich an der Leimrute gefangen haben — in Tätigkeit und voran “wohl
hauptsächlich der musc. m y lo -h y o id e u s p o s te r io r , der c l e id o - t h y r e o id e u s und
der g e n io - th y r e o id e u s , dieser mit seinen sämtlichen Fasern, nicht allein mit denen,
die in der Kehlgegend inserieren, sondern auch mit den lateralen, welche auf dem Oesophagus
ausstrahlen; in zweiter Linie werden die obern Köpfe der musc. t r a c h e a le s bei
den Schlingbewegungen beteiligt sein, und unter diesen hauptsächlich das cap u t v e n t r a le ,
welches an der Basis des Zungenschlauchs angreift. Aber auch die musc. c e r a to - g lo s s i
finden wir hierbei wieder an der Arbeit; diesmal jedoch in ganz anderer Weise als bei ausgestreckter
Zunge. Ihre fiederigen Abschnitte sind ausgeschaltet, indem dieser Teil des
Muskels schlaff bleibt; aber ihre schwächeren longitudinalen Fasern bewirken mit Hilfe der
langen Sehnen die kleinen Hin- und Her-, Auf- und Abwärtsbewegungen der zurückgezogenen
Zunge, welche beim Verschlingen der Nahrung auszuführen sind, und zwar in der Weise,
daß sich der Zungenbeinkörper, ohne gebogen zu werden, im Gelenk gegen die Hörner
bewegt. Hierbei wirken also die cerato-glossi denen der ändern Vögel analog, mit dem
Unterschied, daß hier die freie Zunge nicht nur den Bereich des os entoglossum, sondern
auch des Zungenbeinkörpers umfaßt und infolge davon das Gelenk, in welchem sie sich bewegt,
vom Vorderende des Zungenbeinkörpers nach dessen Hinterende verlegt ist.
Die Aktion der Zunge, die wir hier am Grünspecht verfolgt habenlwst bei den
übrigen Spechten im wesentlichen dieselbe. Bei den meisten ist sie dadurch einfacher, daß
die Halsschlingen fehlen. Hier beginnt naturgemäß mit dem ersten Vorwärtsziehen das
Herumgleiten der Hörner um den Schädel. Auch bei ganz jungen Grünspechten, bei denen,
wie wir früher gesehen haben, die Hörner dicht am Schädel anliegen, müssen die Hörner
gleich zu Anfang des Ausstreckens um den Schädel gleiten. Bei einem jungen Grünspecht,
bei dem die Hornenden gerade ins Nasenloch reichten, rückten diese bis hinter die Augenhöhlen,
wenn man die Zunge aus dem Schnabel zog. Ob bei einem erwachsenen Grünspecht,
bei dem die Hörner bekanntlich nahe der Schnabelspitze endigen, diese ebensoweit
nach hinten zu ziehen sind, möchte ich bezweifeln; bei den Versuchen bei alten Spechten
die Zunge herauszuziehen, zogen sie sich, ohne daß man besondere Gewalt anwandte, nur
bis zur Schnabelwurzel zurück.
Das Ausstrecken und Zurückziehen der Zunge, dessen einzelne Phasen sich natürlich
in mannigfaltiger Weise kombinieren lassen, kann äußerst schnell aufeinanderfolgen, indem
sich Vorstrecker Und Rückzieher energisch kontrahieren und die übrige Muskulatur entsprechend
rasch reagiert. Einen Grünspecht konnte ich leider nie dabei beobachten, doch
besaß ich einen zahmen Buntspecht, welcher auf den ihm vorgehaltenen Bissen die Zunge
wiederholt so rasch vorschnelle, daß die einzelnen Bewegungen nicht zu verfolgen waren.
Diese raschen Bewegungen dürften wohl hauptsächlich den Buntspechten eigen sein.
Zum Schluß möchte ich bemerken, daß die vorstehende Beschreibung sich nicht allein
hypothetisch auf den anatomischen Bau der Spechtzunge gründet, sondern auch auf unmittelbare
Anschauung. An einem frischen abgebalgten Grünspecht, bei dem die oberflächlichen"
Schichten des musc. mylo-hyoideus post, sowie die Schleimdrüsen entfernt sind,
können wir die Bewegungen der einzelnen Teile des Zungenapparats dadurch beobachten,
daß wir die Zunge an der Spitze mit der Pinzette fassen und langsam herausziehen. Wir
sehen dann, wie sich zuerst die Hornschlingen verkürzen und erst spät auch das Herumgleiten
der Hörner um den Schädel beginnt. Während die Zunge in die Länge gezogen
wird, rückt die Larynx allmählich nach vorn ; bei unserm Versuch natürlich durch den Zug
an der Zungenspitze. Auch können wir die Zunge wieder sorgfältig zurückschieben und dabei
die entsprechenden Veränderungen beobachten.
VI.
L u c a s (26, 27, 28) kommt nach seinen Untersuchungen an amerikanischen Spechten
zu dem Ergebnis, daß die Zunge der Vögel systematisch nicht verwertbar sei. Dieses
Organ, dessen Bau unmittelbar von der Lebensweise abhänge, könne bei nahe verwandten
Arten, die verschiedene Lebensgewohnheiten haben, sehr verschieden gestaltet sein, infolge
ähnlicher Lebensweise umgekehrt bei sich fernstehenden Arten eine ähnliche Ausbildung erfahren
haben. Innerhalb des Bereiches der L u c a s sehen Untersuchungen sind wir mit
seiner Bemerkung im allgemeinen einverstanden; sie erstrecken sich nämlich nur auf die
äußere Erscheinung der Zunge, auf ihre Länge, Oberflächenbeschaffenheit u. s. w., und diese
Eigenschaften tragen als spezielle Anpassungen erfahrungsgemäß und anerkanntermaßen zur
Erkenntnis des phylogenetischen Zusammenhangs der Tiere nichts bei. Ja, wir können
noch weiter gehen; denn auch die Anatomie des Organs stellt bis zu einem gewissen Grad
eine Reaktion auf die Außenwelt dar und ist als solche zur Feststellung phylogenetischer
Zusammenhänge unbrauchbar.
Wissen wir doch, daß unter dem Einfluß gleicher Lebensweise an phylogenetisch
voneinander mehr oder weniger unabhängigen Punkten des Systems physiologisch gleichartige
Organe entstehen können, wodurch die sogenannten Konvergenzerscheinungen zustande
kommen. Sind die morphologischen Grundlagen konvergenter Organe verschieden,
so beweist die vergleichende Anatomie deren Unabhängigkeit voneinander; sind sie aber,
und das kommt gewiß häufig vor, gleich, so ist auch hier die Möglichkeit von Konvergenz
nicht auszuschließen; denn es ist klar, daß auf gleicher morphologischer Grundlage beruhende
gleiche Umgestaltungen unter dem Einfluß gleicher äußerer Bedingungen ganz unabhängig
voneinander, sogar auf verschiedenen Wegen, zustande kommen können. In
diesem Falle werden Organe entstehen, welche den Anschein erwecken, als könnten sie nur
durch unmittelbare Vererbung einander gleich sein, und welche uns zu phylogenetisch
falschen Schlüssen verleiten könnten, wenn nicht die Anatomie der übrigen Organe ein Korrektiv
darbietet. Da nun die Möglichkeit konvergenter Übereinstimmung zweier phylogenetisch
entfernter Organismen unbegrenzt ist, indem sich die Konvergenz nicht auf ein
einzelnes Organ zu beschränken braucht, so kann man streng genommen nie von der Größe
morphologischer Ähnlichkeit auf den Grad der Verwandtschaft schließen, und nur in Bezug
auf die Verwandtschaft negative Befunde lassen sich für die Bestimmung der phylogenetischen
Stellung zweier Tiere zueinander mit Sicherheit verwerten, während positive phylogenetische
Beziehungen, d . h. Abstammung in g e r a d e r Linie, in der Regel nur hypothetisch
aufgestellt werden können.
Der wesentliche Unterschied zwischen systematischer und phylogenetischer Betrachtungsweise
tritt hier scharf hervor; denn Systematik gründet sich auf morphologische Ähn