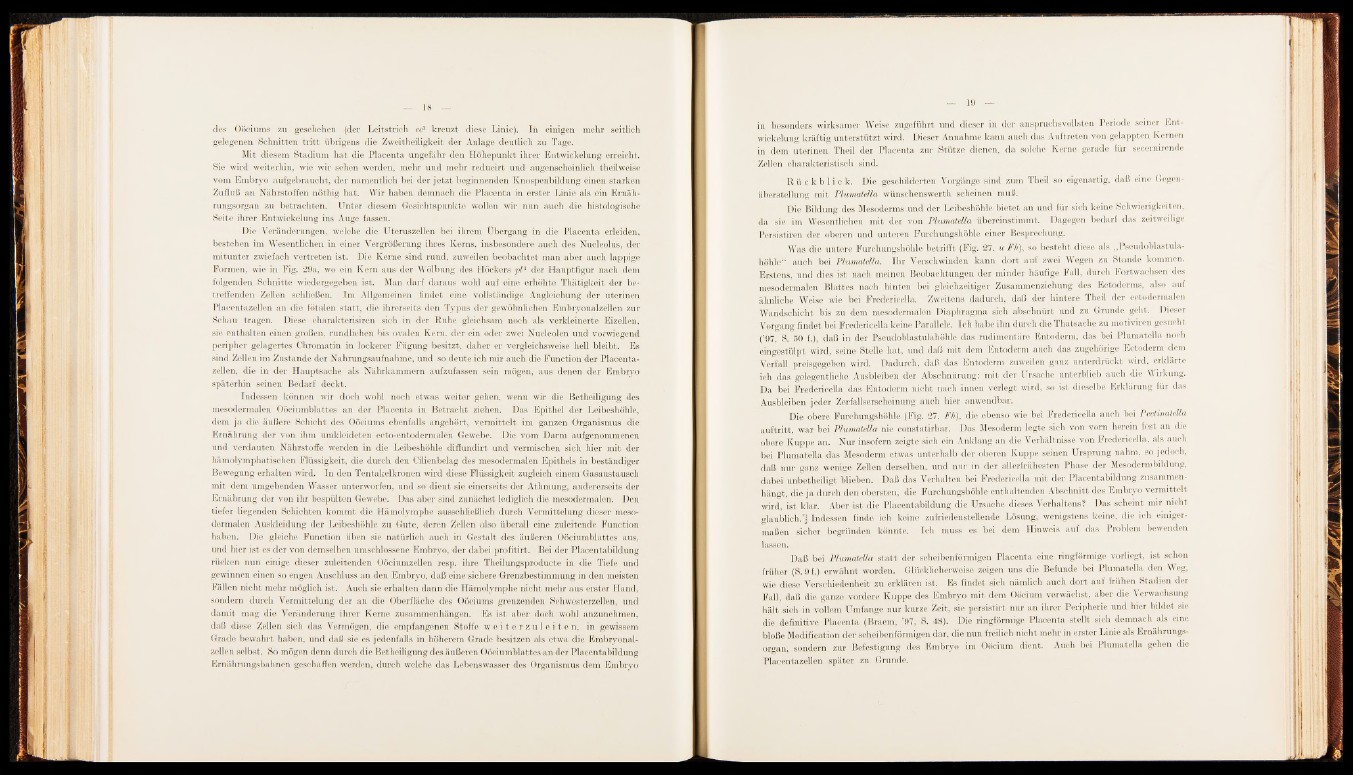
des Oöciums zu geschehen (der Leitstrich ec1 kreuzt diese Linie). In einigen mehr seitlich
gelegenen Schnitten tritt übrigens die Zweitheiligkeit der Anlage deutlich zu Tage.
Mit diesem Stadium hat die Placenta ungefähr den Höhepunkt ihrer Entwickelung erreicht.
Sie wird weiterhin, wie wir sehen werden, mehr und mehr reducirt und augenscheinlich theilweise
vom Embryo aufgebraucht, der namentlich bei der jetzt beginnenden Knospenbildung einen starken
Zufluß an Nährstoffen nöthig hat. Wir haben demnach die Placenta in erster Linie als ein Ernährungsorgan
zu betrachten. Unter diesem Gesichtspunkte wollen wir nun auch die histologische
Seite ihrer Entwickelung ins Auge fassen.
Die Veränderungen, welche die Uteruszellen bei ihrem Übergang in die Placenta erleiden,
bestehen im Wesentlichen in einer Vergrößerung ihres Kerns, insbesondere auch des Nucleolus, der
mitunter zwiefach vertreten ist. Die Kerne sind rund, zuweilen beobachtet man aber auch lappige
Formen, wie in Fig. 29a, wo ein Kern aus der Wölbung des Höckers jjl1 der Hauptfigur nach dem
folgenden Schnitte wiedergegeben ist. Man darf daraus wohl auf eine erhöhte Thätigkeit der betreffenden
Zellen schließen. Im Allgemeinen findet eine vollständige Angleichung der uterinen
Placentazellen an die fötalen statt, die ihrerseits den Typus der gewöhnlichen Embryonalzellen zur
Schau tragen. Diese charakterisiren sich in der Ruhe gleichsam noch als verkleinerte Eizellen,
sie enthalten einen großen, rundlichen bis ovalen Kern, der ein oder zwei Nucleolen und vorwiegend
peripher gelagertes Chromatin in lockerer Fügung besitzt, daher er vergleichsweise hell bleibt. Es
sind Zellen im Zustande der Nahrungsaufnahme, und so deute ich mir auch die Function der Placentazellen,
die in der Hauptsache als Nährkammern aufzufassen sein mögen, aus denen der Embryo
späterhin seinen Bedarf deckt.
Indessen können wir doch wohl noch etwas weiter gehen, wenn wir die Betheiligung des
mesodermalen Oöciumblattes an der Placenta in Betracht ziehen. Das Epithel der Leibeshöhle,
dem ja die äußere Schicht des Oöciums ebenfalls angehört, vermittelt im ganzen Organismus die
Ernährung der von ihm umkleideten ecto-entodermalen Gewebe. Die vom Darm aufgenommenen
und verdauten Nährstoffe werden in die Leibeshöhle diffundirt und vermischen sich hier mit der
hämolymphatischen Flüssigkeit, die durch den Cilienbelag des mesodermalen Epithels in beständiger
Bewegung erhalten wird. In den Tentakelkronen wird diese Flüssigkeit zugleich einem Gasaustausch
mit dem umgebenden Wasser unterworfen, und so dient sie einerseits der Athmung, andererseits der
Ernährung der von ihr bespülten Gewebe. Das aber sind zunächst lediglich die mesodermalen. Den
tiefer liegenden Schichten kommt die Hämolymphe ausschließlich durch Vermittelung dieser meso-
dermalen Auskleidung der Leibeshöhle zu Gute, deren Zellen also überall eine zuleitende Function
haben. Die gleiche Function üben sie natürlich auch in Gestalt des äußeren Oöciumblattes aus,
und hier ist es der von demselben umschlossene Embryo, der dabei profitirt. Bei der Placentabildung
rücken nun einige dieser zuleitenden Oöciumzellen resp. ihre Theilungsproducte in die Tiefe und
gewinnen einen so engen Anschluss an den Embryo, daß eine sichere Grenzbestimmung in den meisten
Fällen nicht mehr möglich ist. Auch sie erhalten dann die Hämolymphe nicht mehr aus erster Hand,
sondern durch Vermittelung der an die Oberfläche des Oöciums grenzenden Schwesterzellen, und
damit mag die Veränderung ihrer Kerne Zusammenhängen. Es ist aber doch wohl anzunehmen,
daß diese Zellen sich das Vermögen, die empfangenen Stoffe w e i t e r z u l e i t e n , in gewissem
Grade bewahrt haben, und daß sie es jedenfalls in höherem Grade besitzen als etwa die Embryonalzellen
selbst. So mögen denn durch die Betheiligung des äußeren Oöciumblattes an der Placentabildung
Ernährungsbahnen geschaffen werden, durch welche das Lebenswasser des Organismus dem Embryo
in besonders wirksamer Weise zugeführt und dieser in der anspruchsvollsten Periode seiner Entwickelung
kräftig unterstützt wird. Dieser Annahme kann auch das Auftreten von gelappten Kernen
in dem uterinen. Theil der Placenta zur Stütze dienen, da solche Kerne gerade für secernirende
Zellen charakteristisch sind.
R ü c k b l i c k . Die geschilderten Vorgänge sind zum Theil so eigenartig, daß eine Gegenüberstellung
mit Plumatdla wünschenswerth scheinen muß.
Die Bildung des Mesoderms .und der Leibeshöhle bietet an und für sich keine Schwierigkeiten,
da sie im Wesentlichen mit der von Plumatdla übereinstimmt. Dagegen bedarf das zeitweilige
Persistiren der oberen und unteren Furchungshöhle einer Besprechung.
Was die untere Furchungshöhle betrifft (Fig. 27, u Fh), so besteht diese als „Pseudoblastula-
höhle“ auch bei Plumatdla. Ihr Verschwinden kann dort auf zwei Wegen zu Stande kommen.
Erstens, und dies ist nach meinen Beobachtungen der minder häufige Fall, durch Fortwachsen des
mesodermälen Blattes nach hinten bei gleichzeitiger Zusammenziehung des Ectoderms, also auf
ähnliche Weise wie bei Fredericella. Zweitens dadurch, daß der hintere Theil der ectodermalen
Wandschicht bis zu dem mesodermalen Diaphragma sich abschnürt und zu Grunde geht. Dieser
Vorgang findet bei Fredericella keine Parallele. Ich habe ihn durch die Thatsache zu motiviren gesucht
(’97, S. 50 f.), daß in der Pseudoblastulahöhle das rudimentäre Entoderm, das bei Plumatella noch
eingestülpt wird, seine Stelle hat, und daß mit dem Entoderm auch das zugehörige Ectoderm dem
Verfall preisgegeben wird. Dadurch, daß das Entoderm zuweilen ganz unterdrückt wird, erklärte
ich das gelegentliche Ausbleiben der Abschnürung: mit der Ursache unterblieb auch die Wirkung.
Da bei Fredericella das Entoderm nicht nach innen verlegt wird, so ist dieselbe Erklärung für das
Ausbleiben jeder Zerfallserscheinung auch hier anwendbar.
Die obere Furchungshöhle (Fig. 27, Fh), die ebenso wie bei Fredericella auch bei Pectinatella
auftritt, war bei Plumatdla nie constatirbar. Das Mesoderm legte sich von vorn herein fest an die
obere Kuppe an. Nur insofern zeigte sich ein Anklang an die Verhältnisse von Fredericella, als auch
bei Plumatella das Mesoderm etwas unterhalb der oberen Kuppe seinen Ursprung nahm, so jedoch,
daß nur ganz wenige Zellen derselben, und nur in der allerfrühesten Phase der Mesodermbildung,
dabei unbetheiligt blieben. Daß das Verhalten bei Fredericella mit der Placentabildung zusammenhängt,
die ja durch den obersten, die Furchungshöhle enthaltenden Abschnitt des Embryo vermittelt
wird, ist klar. Aber ist die Placentabildung die Ursache dieses Verhaltens? Das scheint mir nicht
glaublich.*] Indessen finde ich keine zufriedenstellende Lösung, wenigstens keine, die ich einigermaßen
sicher begründen könnte. Ich muss es bei dem Hinweis auf das Problem bewenden
lassen.
Daß bei Plumatella statt der scheibenförmigen Placenta eine ringförmige vorliegt, ist schon
früher (S. 9 f.) erwähnt worden. Glücklicherweise zeigen uns die Befunde bei Plumatella den Weg,
wie diese Verschiedenheit zu erklären ist. Es findet sich nämlich auch dort auf frühen Stadien der
Pall, daß die ganze vordere Kuppe des Embryo mit dem Oöcium verwächst, aber die Verwachsung
hält'sich in vollem Umfange nur kurze Zeit, sie persistirt nur an ihrer Peripherie und hier bildet sie
die. definitive Placenta (Braem, ’97, S. 48). Die ringförmige Placenta stellt sich demnach als eine
bloße Modification der scheibenförmigen dar, die nun freilich nicht mehr in erster Linie als Ernährungsorgan,
sondern zur Befestigung des Embryo im Oöcium dient. Auch bei Plumatella gehen die
Placentazellen später zu Grunde.