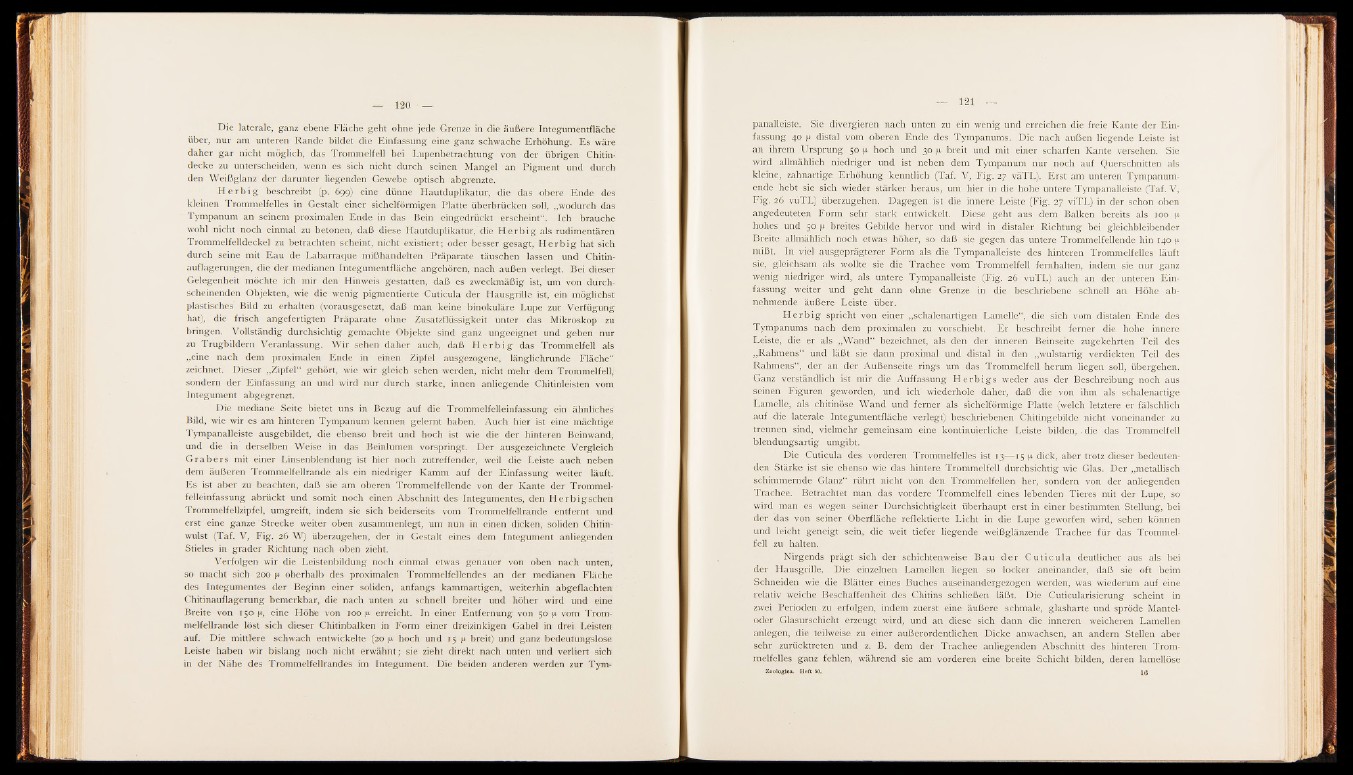
Die laterale, ganz ebene Fläche geht ohne jede Grenze in die äußere Integumentfläche
über, nur am unteren Rande bildet die Einfassung eine ganz schwache Erhöhung. Es wäre
daher gar nicht möglich, das Trommelfell bei Lupenbetrachtung von der übrigen Chitindecke
zu unterscheiden, wenn es sich nicht durch seinen Mangel an Pigment und durch
den Weißglanz der darunter liegenden Gewebe optisch abgrenzte.
H e r b i g beschreibt (p. 699) eine dünne Hautduplikatur, die das obere Ende des
kleinen Trommelfelles in Gestalt einer sichelförmigen Platte überbrücken soll, „wodurch das
Tympanum an seinem proximalen Ende in das Bein eingedrückt erscheint“ . Ich brauche
wohl nicht noch einmal zu betonen, daß diese Hautduplikatur, die H e rb ig als rudimentären
Trommelfelldeckel zu betrachten scheint, nicht existiert; oder besser gesagt, H e r b ig hat sich
durch seine mit Eau de Labarraque mißhandelten Präparate täuschen lassen und Chitinauflagerungen,
die der medianen Integumentfläche angehören, nach außen verlegt. Bei dieser
Gelegenheit möchte ich mir den Hinweis gestatten, daß es zweckmäßig ist, um von durchscheinenden
Objekten, wie die wenig pigmentierte Cuticula der Hausgrille, ist, ein möglichst
plastisches Bild zu erhalten (vorausgesetzt, daß man keine binokuläre Lupe zur Verfügung
hat), die frisch angefertigten Präparate ohne Zusatzflüssigkeit unter das Mikroskop zu
bringen. Vollständig durchsichtig gemachte Objekte sind ganz ungeeignet und geben nur
zu Trugbildern Veranlassung. Wir sehen daher auch, daß H e r b i g das Trommelfell als
„eine nach dem proximalen Ende in einen Zipfel ausgezogene, länglichrunde Fläche“
zeichnet. Dieser „Zipfel“ gehört, wie wir gleich sehen werden, nicht mehr dem Trommelfell,
sondern der Einfassung an und wird nur durch starke, innen anliegende Chitinleisten vom
Integument abgegrenzt.
Die mediane Seite bietet uns in Bezug auf die Trommelfelleinfassung ein ähnliches
Bild, wie wir es am hinteren Tympanum kennen gelernt haben. Auch hier ist eine mächtige
Tympanalleiste ausgebildet, die ebenso breit und hoch ist wie die der hinteren Beinwandj;
und die in derselben Weise in das Beinlumen vorspringt. Der ausgezeichnete Vergleich
G r ä b e r s mit einer Linsenblendung ist hier noch zutreffender, weil die Leiste auch neben
dem äußeren Trommelfellrande als ein niedriger Kamm auf der Einfassung weiter läuft.
Es ist aber zu beachten, daß sie am oberen Trommelfellende von der Kante der Trommelfelleinfassung
abrückt und somit noch einen Abschnitt des Integumentes, den Herbigscheh
Trommelfellzipfel, umgreift, indem sie sich beiderseits vom Trommelfellrande entfernt und
erst eine ganze' Strecke weiter oben zusammenlegt, um nun in einen dicken, soliden Chitinwulst
(Taf. V, Fig. 26 W) überzugehen, der in Gestalt eines dem Integument anliegenden
Stieles in grader Richtung nach oben zieht.
Verfolgen wir die Leistenbildung noch einmal etwas genauer von oben nach unteny
so macht sich 200 n oberhalb des proximalen Trommelfellendes an der medianen Fläche
des Integumentes der Beginn einer soliden, anfangs kammartigen, weiterhin abgeflachten
Chitinauflagerung bemerkbar, die nach unten zu schnell breiter und höher wird und eine
Breite von 150 n, eine Höhle von 100 f* erreicht. In einer Entfernung von 50 ft vom Trommelfellrande
lost sich dieser Chitinbalken in Form einer dreizinkigen Gabel in drei Leisten
auf. Die mittlere schwach entwickelte (20 ft hoch und 15 |t breit) und ganz bedeutungslose
Leiste haben wir bislang noch nicht erwähnt; sie zieht direkt nach unten und verliert sich
in der Nähe des Trommelfellrandes im Integument. Die beiden anderen werden zur Tym*-
panalleiste. Sie divergieren nach unten zu ein wenig und erreichen die freie Kante der Einfassung
40 ft distal vom oberen Ende des Tympanums. Die nach außen liegende Leiste ist
an ihrem Ursprung 50 ft hoch und 30 ft breit und mit einer scharfen Kante versehen. Sie
wird allmählich niedriger und ist neben dem Tympanum nur noch auf Querschnitten als
kleine, zahnartige Erhöhung kenntlich (Taf. V, Fig. 27 väTL). Erst am unteren Tympanum-
ende hebt sie sich wieder stärker heraus, um hier in die hohe untere Tympanalleiste (Taf. V,
Fig. 26 vüTL) überzugehen. Dagegen ist die innere Leiste (Fig. 27 viTL) in der schon oben
angedeuteten Form sehr stark entwickelt. Diese geht aus dem Balken bereits als 100 ft
hohes und 50 ft breites Gebilde hervor und wird in distaler Richtung bei gleichbleibender
Breite allmählich noch etwas höher, so daß sie gegen das untere Trommelfellende hin 140 ft
mißt. In viel ausgeprägterer Form als die Tympanalleiste des hinteren Trommelfelles läuft
sie, gleichsam als wollte sie die Trachee vom Trommelfell fernhalten, indem sie nur ganz
wenig niedriger wird, als untere Tympanalleiste (Fig. 26 vuTL) auch an der unteren Einfassung
weiter und geht dann ohne Grenze in die beschriebene schnell an Höhe abnehmende
äußere Leiste über.
H e r b ig spricht von einer „schalenartigen Lamelle“ , die sich vom distalen Ende des
Tympanums nach dem proximalen zu vorschiebt. Er beschreibt ferner die hohe innere
Leiste, die er als „Wand“ bezeichnet, als den der inneren Beinseite zugekehrten Teil des
„Rahmens“ und läßt sie dann proximal und distal in den „wulstartig verdickten Teil des
Rahmens“, der an der Außenseite rings um das Trommelfell herum liegen soll, übergehen.
Ganz verständlich ist mir die Auffassung H e r b ig s weder aus der Beschreibung noch aus
seinen Figuren geworden, und ich' wiederhole daher, daß die von ihm als schalenartige
Lamelle, als chitinöse Wand und ferner als sichelförmige Platte (welch letztere er fälschlich
auf die laterale Integumentfläche verlegt) beschriebenen Chitingebilde nicht voneinander zu
trennen sind, vielmehr gemeinsam eine kontinuierliche Leiste bilden, .die das Trommelfell
blendungsartig umgibt.
Die Cuticula des vorderen Trommelfelles ist 13^— 15 fi dick, aber trotz dieser bedeutenden
Stärke ist sie ebenso wie das hintere Trommelfell durchsichtig wie Glas. Der „metallisch
schimmernde Glanz“ rührt nicht von den Trommelfellen her, sondern von der anliegenden
Trachee. Betrachtet man das vordere Trommelfell eines lebenden Tieres mit der Lupe, so
wird man es wegen seiner Durchsichtigkeit überhaupt erst in einer bestimmten Stellung, bei
der das von seiner Oberfläche reflektierte Licht in die Lupe geworfen wird, sehen können
und leicht geneigt sein, die weit tiefer liegende weißglänzende Trachee für das Trommelfell
zu halten;
Nirgends prägt sich der schichtenweise B au d e r C u t ic u la deutlicher aus als bei
der Hausgrille. Die einzelnen Lamellen liegen so locker aneinander, daß sie oft beim
Schneiden wie die Blätter eines Buches auseinandergezogen werden, was wiederum auf eine
relativ weiche Beschaffenheit des Chitins schließen läßt. Die Cuticularisierung scheint in
zwei Perioden zu erfolgen, indem zuerst eine äußere schmale, glasharte und spröde Manteloder
Glasurschicht erzeugt wird, und an diese sich dann die inneren weicheren Lamellen
anlegen, die teilweise zu einer außerordentlichen Dicke anwachsen, an ändern Stellen aber
sehr zurücktreten und .z. B. dem der Trachee anliegenden Abschnitt des hinteren Trommelfelles
ganz fehlen, während sie am vorderen eine breite Schicht bilden, deren lamellöse
Zoologica. Heft 60. jg