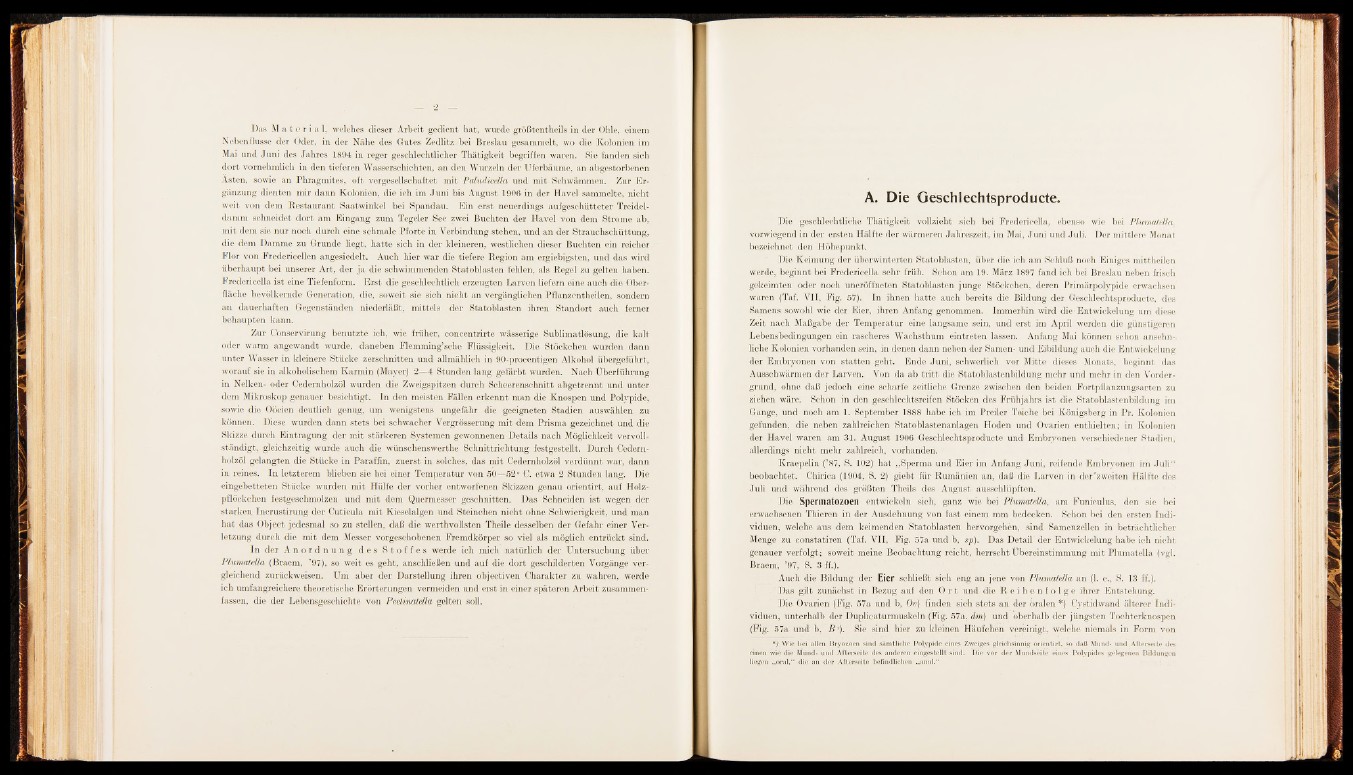
Das Mat e r i a l , welches dieser Arbeit gedient hat, wurde größtentheils in der Ohle, einem
Nebenflüsse der Oder, in der Nähe des Gutes Zedlitz bei Breslau gesammelt, wo die Kolonien im
Mai und Juni des Jahres 1894 in reger geschlechtlicher Thätigkeit begriffen waren. Sie fanden sich
dort vornehmlich in den tieferen Wasserschichten, an den Wurzeln der Uferbäume, an abgestorbenen
Ästen, sowie an Phragmites, oft vergesellschaftet mit Pcdudicella und mit Schwämmen. Zur Ergänzung
dienten mir dann Kolonien, die ich im Juni bis August 1906 in der Havel sammelte, nicht
weit von dem Restaurant Saatwinkel bei Spandau. Ein erst neuerdings aufgeschütteter Treideldamm
schneidet dort am Eingang zum Tegeler See zwei Buchten der Havel von dem Strome ab,
mit dem sie nur noch durch eine schmale Pforte in Verbindung stehen, und an der Strauchschüttung,
die dem Damme zu Grunde liegt, hatte sich in der kleineren, westlichen dieser Buchten ein reicher
Flor von Fredericellen angesiedelt. Auch hier war die tiefere Region am ergiebigsten, und das wird
überhaupt bei unserer Art, der ja die schwimmenden Statoblasten fehlen, als Regel zu gelten haben.
Fredericella ist eine Tiefenform. Erst die geschlechtlich erzeugten Larven liefern eine auch die Oberfläche
bevölkernde Generation, die, soweit sie sich nicht an vergänglichen Pflanzentheilen, sondern
an dauerhaften Gegenständen niederläßt, mittels der Statoblasten ihren Standort auch ferner
behaupten kann.
Zur Conservirung benutzte ich, wie früher, concentrirte wässerige Sublimatlösung, die kalt
oder warm angewandt wurde, daneben Flemming’sche Flüssigkeit. Die Stöckchen wurden dann
unter Wasser in kleinere Stücke zerschnitten und allmählich in 90-procentigen Alkohol übergeführt,
worauf sie in alkoholischem Karmin (Mayer) 2—4 Stunden lang gefärbt wurden. Nach Überführung
in Nelken- oder Cedernholzöl wurden die Zweigspitzen durch Scheerenschnitt abgetrennt und unter
dem Mikroskop genauer besichtigt. In den meisten Fällen erkennt man die Knospen und Polypide,
sowie die Oöcien deutlich genug, um wenigstens ungefähr die geeigneten Stadien auswählen zu
können. Diese wurden dann stets bei schwacher Vergrösserung mit dem Prisma gezeichnet und die
Skizze durch Eintragung der mit stärkeren Systemen gewonnenen Details nach Möglichkeit vervollständigt,
gleichzeitig wurde auch die wünschenswerthe Schnittrichtung festgestellt. Durch Cedernholzöl
gelangten die Stücke in Paraffin, zuerst in solches, das mit Cedernholzöl verdünnt war, dann
in reines. In letzterem blieben sie bei einer Temperatur von 50— 520 C. etwa 2 Stunden lang. Die
eingebetteten Stücke wurden mit Hülfe der vorher entworfenen Skizzen genau orientirt, auf Holz-
pflöckchen festgeschmolzen und mit dem Quermesser geschnitten. Das Schneiden ist wegen der
starken Incrustirung der Cuticula mit Kieselalgen und Steinchen nicht ohne Schwierigkeit, und man
hat das Object jedesmal so zu stellen, daß die werthvollsten Theile desselben der Gefahr einer Verletzung
durch die mit dem Messer vorgeschobenen Fremdkörper so viel als möglich entrückt sind.
In der A n o r d n u n g de s S t o f f e s werde ich mich natürlich der Untersuchung über
Plumatella (Braem, ’97), so weit es geht, anschließen und auf die dort geschilderten Vorgänge vergleichend
zurückweisen. Um aber der Darstellung ihren objectiven Charakter zu wahren, werde
ich umfangreichere theoretische Erörterungen vermeiden und erst in einer späteren Arbeit zusammenfassen,
die der Lebensgeschichte von Pectinatella gelten soll.
A. Die Geschiechtsproducte.
Die geschlechtliche Thätigkeit vollzieht sich bei Fredericella, ebenso wie bei Plumatella.
vorwiegend in der ersten Hälfte der wärmeren Jahreszeit, im Mai, Juni und Juli. Der mittlere Monat
bezeichnet den Höhepunkt.
Die Keimung der überwinterten Statoblasten, über die ich am Schluß noch Einiges mittheilen
werde, beginnt bei Fredericella sehr früh. Schon am 19. März 1897 fand ich bei Breslau neben frisch
gekeimten oder noch uneröffneten Statoblasten junge Stöckchen, deren Primärpolypide erwachsen
waren (Taf. VII, Fig. 57). In ihnen hatte auch bereits die Bildung der Geschiechtsproducte, des
Samens sowohl wie der Eier, ihren Anfang genommen. Immerhin wird die'Entwickelung um diese
Zeit nach Maßgabe der Temperatur eine langsame sein, und erst im April werden die günstigeren
Lebensbedingungen ein rascheres Wachsthum eintreten lassen. Anfang Mai können schon ansehn-,
liehe Kolonien vorhanden sein, in denen dann neben der Samen- und Eibildung auch die Entwickelung
der Embryonen von statten geht. Ende Juni, schwerlich vor Mitte dieses Monats, beginnt das
Ausschwärmen der Larven. Von da ab tritt die Statoblastenbildung mehr und mehr in den Vordergrund,
ohne daß jedoch eine scharfe zeitliche Grenze zwischen den beiden Fortpflanzungsarten zu
ziehen wäre. Schon in den geschlechtsreifen Stöcken des Frühjahrs ist die Statoblastenbildung im
G;ange, und noch am 1. September 1888 habe ich im Preiler Teiche bei Königsberg in Pr. Kolonien
gefunden, die neben zahlreichen Statoblastenanlagen Hoden und Ovarien enthielten; in Kolonien
der Havel waren am 31. August 1906 Geschiechtsproducte und Embryonen verschiedener Stadien,
allerdings nicht mehr zahlreich, vorhanden.
Kraepelin (’87, S. 102) hat „Sperma und Eier im Anfang Juni, reifende Embryonen im Juli“
beobachtet. Chirica (1904, S. 2) giebt für Rumänien an, daß die Larven in der'zweiten Hälfte des
Juli und während des größten Theils des August ausschlüpften.
Die Spennatozoen entwickeln sich, ganz wie bei Plumatella, am Funiculus, den sie bei
erwachsenen Thieren in der Ausdehnung von fast einem mm bedecken. Schon bei den ersten Individuen,
welche aus dem keimenden Statoblasten hervorgehen, sind Samenzellen in beträchtlicher
Menge zu constatiren (Taf. VII, Fig. 57a und b, sp). Das Detail der Entwickelung habe ich nicht
genauer verfolgt; soweit meine Beobachtung reicht, herrscht Übereinstimmung mit Plumatella (vgl.
Braem, ’97, S. 3 ff.).
Auch die Bildung der Eier schließt sich eng an jene von Plumatella an (1. c., S. 13 ff.).
Das gilt zunächst in Bezug auf den O r t und die R e i h e n f o 1 g e ihrer Entstehung.
Die Ovarien (Fig. 57a und b, Ov) finden sich stets an der oralen *) Cystidwand älterer Individuen,
unterhalb der Duplicaturmuskeln (Fig. 57a, dm) und oberhalb der jüngsten Tochterknospen
(Fig. 57a und b, B l). Sie sind hier zu kleinen Häufchen vereinigt, welche niemals in Form von
*/ Wie bei allen Bryozoen sind sämtliche Polypide eines Zweiges gleichsinnig orientirt, so daß Mund- und Afterseite des
einen wie die Mund- und Afterseite des anderen eingestellt sind. Die vor der Mundseite eineis Polypides gelegenen Bildungen
liegen „ora l,“ die an der Afterseite befindlichen „anal.“