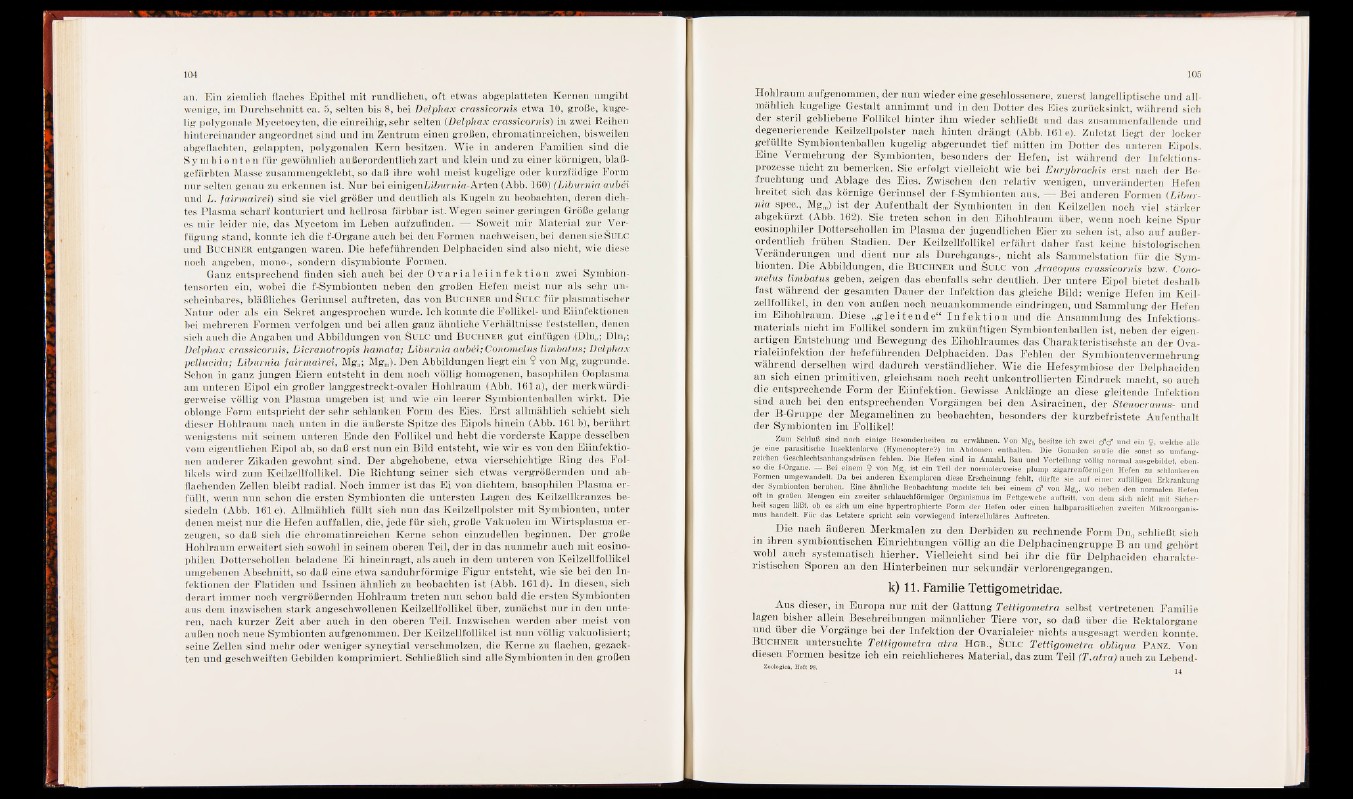
an. Bin ziemlich flaches Epithel mit rundlichen, oft etwas abgeplatteten Kernen umgibt
wenige, im Durchschnitt ca. 5, selten bis 8, hei Delphax crassicornis etwa 10, große, kugelig
polygonale Mycetocyten, die einreihig, sehr selten (Delphax crassicornis) in zwei Reihen
hintereinander angeordnet sind und im Zentrum einen großen, chromatinreichen, bisweilen
abgeflachten, gelappten, polygonalen Kern besitzen. Wie in anderen Familien sind die
S ymb i o n t e n für gewöhnlich außerordentlich zart und klein und zu einer körnigen, blaßgefärbten
Masse zusammengeklebt, so daß ihre wohl meist kugelige oder kurzfädige Form
nur selten genau zu erkennen ist. Nur bei einigen Liburnia-Arten (Abb. 160) (Liburhia aubei
und L. fairmairei) sind sie viel größer und deutlich als Kugeln zu beobachten, deren dichtes
Plasma scharf konturiert und hellrosa färbbar ist. Wegen seiner geringen Größe gelang
es mir leider nie, das Mycetom im Leben aufzu fin d en |^S Soweit mir Material zur Verfügung
stand, konnte ich die f-Organe auch bei den Formen nachweisen, bei denen sie S u l c
und B ü c h n e r entgangen waren. Die hefeführenden Delphaciden sind also nicht, wie diese
noch angeben, mono-, sondern disymbionte Formen.
Ganz entsprechend finden sich auch bei der O v a r i a l e i i n f e k t i o n zwei Symbion-
tensorten ein, wobei die f-Symbionten neben den großen Hefen meist nur als sehr unscheinbares,
bläßliches Gerinnsel auf treten, das von B ü c h n e r und Si.'i.c für pläsmatiseher
Natur oder als ein Sekret angesprochen wurde. Ich konnte die Follikel-und Eiinfektionen
bei mehreren Formen verfolgen und bei allen ganz ähnliche Verhältnisse feststellen, denen
sieh auch die Angaben und Abbildungen von SSirix: und BuCHNER gut einfügen (Dln„; Din,;
Delphax crassicornis, Dicranotropis hamata; Liburnia aubei; C&nomelus Ihn bat ns; Delphax
pellucida; Liburnia fairmairei, Mga; Mg,„), Den Abbildungen liegt ein®von Mga zugrunde.
Schon in ganz jungen Eiern entsteht in dem noch Völlig homogenen, basophilen Ooplasma
am unteren Eipol ein großer langgestreckt-ovaler Hohlraum (Abb. 161 a), der merkwürdigerweise
völlig von Plasma umgeben ist und wie ein leerer Symbiontenballen wirkt. Die
oblonge Form entspricht der sehr schlanken Form des Eies. E rst allmählich schiebt sieh
dieser Hohlraum nach unten in die äußerste Spitze des Eipöls hinein (Abb. 161 bj), berührt
wenigstens mit seinem unteren Ende den Follikel und hebt die vorderste Kappe desselben
vom eigentlichen Eipol ab, so daß erst nun ein Bild entsteht, wie wir es von den Eiinfektionen
anderer Zikaden gewohnt sind. Der abgehobene, etwa vierschichtige Ring des Follikels
wird zum Keilzellfollikel. Die Richtung seiner sich etwas vergrößernden und abflachenden
Zellen bleibt radial. Noch immer ist das Ei von dichtem, basophilen Plasma erfüllt,
wenn nun schon die ersten Symbionten die untersten Lagen des Keilzellkranzes besiedeln
(Abb. 161 c), Allmählich füllt sich nun das Keilzellpolster mit Symbionten, unter
denen meist nur die Hefen auffallen, die, jede für sich, große Vakuolen im Wirtsplasma erzeugen,
so daß sich die chromatinreichen Kerne schon einzudellen beginnen. Der große
Hohlraum erweitert sich sowohl in seinem oberen Teil, der in das nunmehr auch mit eosinophilen
Dotterschollen beladene Ei hineinragt, als auch in dem unteren von Keilzellfollikel
umgebenen Abschnitt, so daß eine etwa sanduhrförmige Figur entsteht, wie sie bei den In fektionen
der Flatiden und Issinen ähnlich zu beobachten ist (Abb. 161 d). In diesen, sich
derart immer noch vergrößernden Hohlraum treten nun schon Jhald die ersten Symbionten
aus dem inzwischen stark angeschwollenen Keilzellfollikel über, zunächst nur in den unteren,
nach kurzer Zeit aber auch in den oberen Teil. Inzwischen werden aber meist von
außen noch neue Symbionten aufgenommen. Der Keilzellfollikel ist nun völlig vakuolisiert;
seine Zellen sind mehr oder weniger syncytial verschmolzen, die Kerne zu flachen, gezackten
und geschweiften Gebilden komprimiert. Schließlich sind alle Symbionten in den großen
Hohlraum aufgenommen, der nun wieder eine geschlossenere, zuerst langelliptisehe und allmählich
kugelige Gestalt annimmt und in den Dotter des Eies zurücksinkt, während sich
der steril gebliebene Follikel hinter ihm wieder schließt und das zusammenfallende und
degenerierende Keilzellpolster nach hinten drängt (Abb. 161 e). Zuletzt liegt der locker
gefüllte Symbiontenballen kugelig abgerundet tief mitten im Dotter des unteren Eipols.
Eine Vermehrung der Symbionten, besonders der Hefen, ist während der Infektionsprozesse
nicht zu bemerken. Sie erfolgt vielleicht wie bei Eurybrachis erst nach der Befruchtung
und Ablage des Eies. Zwischen den relativ wenigen, unveränderten Hefen
breitet sich das körnige Gerinnsel der f-Symbionten aus. — Bei anderen Formen (Liburnia
spee., M g ijis t der Aufenthalt der Symbionten in den Keilzellen noch viel stärker
abgekürzt (Abb. 162). Sie treten schon in den Eihohlraum über, wenn noch keine Spur
eosinophiler Dotterschollen im Plasma der jugendlichen Eier zu sehen ist, also auf außerordentlich
frühen Stadien. Der Keilzellfollikel erfährt daher fast keine histologischen
Veränderungen und dient nur als Durchgangs-, nicht als Sammelstation für die Symbionten.
Die Abbildungen, die B ü c h n e r und S u l c von Araeopus crassicornis bzw. Cono-
melus limbatus geben, zeigen das ebenfalls sehr deutlich. Der untere Eipol bietet deshalb
fast während der gesamten Dauer der Infektion das gleiche Bild: wenige Hefen im Keilzellfollikel,
in den von außen noch neuankommende eindringen, und Sammlung der Hefen
im Eihohlraum. Diese „ g l e i t e n d e “ I n f e k t i o n und die Ansammlung des Infektionsmaterials
nicht im Follikel sondern im zukünftigen Symbiontenballen ist, neben der eigenartigen
Entstehung und Bewegung des Eihohlraumes das Charakteristischste an der Ova-
rialiginfektion der hefeführenden Delphaciden. Das Fehlen der Symbiontenvermehrung
während derselben wird dadutgh verständlicher. Wie die Hefesymbiose der Delphaciden
an sich einen primitiven, gleichsam noch recht unkontrollierten Eindruck macht, so auch
die entsprechende Form der Eiinfektion. Gewisse Anklänge an diese gleitende Infektion
sind auch bei den entsprechenden Vorgängen bei den Asiracinen, der Stenocranus- und
der B-Gruppe der Megamelinen zu beobachten, besonders der kurzbefristete Aufenthalt
der Symbionten im Follikel!
Zum Schluß sind noch einige Besonderheiten zu erwähnen. Von Mgb besitze ich zwei <S<S und ein $, welche alle
je eine parasitische Insektenlarve (Hymenoptere?) im Abdomen enthalten. Die Gonaden sowie die sonst * so umfangreichen
Geschlechtsanhangsdrüsen fehlen. Die Hefen sind in Anzahl, Bau und Verteilung völlig normal ausgebildet, ebenso
die f-Organe. — Bei einem $ von Mgc ist ein Teil der normalerweise plump zigarrenförmigen Hefen zu schlankeren
Formen umgewandelt. Da bei anderen Exemplaren diese Erscheinung fehlt, dürfte sie auf einer zufälligen Erkrankung
der Symbionten beruhen. Eine ähnliche Beobachtung machte ich bei einem <J von Mg0, wo neben den normalen Hefen
oft in großen Mengen ein zweiter schlauchförmiger Organismus im Fettgewebe auftritt, von dem sich nicht mit Sicherheit
sagen läßt, ob es sich um eine hypertrophierte Form der Hefen oder einen halbparasitischen zweiten Mikroorganismus
handelt. Für das Letztere spricht sein vorwiegend interzelluläres Auftreten.
Die nach äußeren Merkmalen zu den Derbiden zu rechnende Form Dnq schließt sich
in ihren symbiontischen Einrichtungen völlig an die Delphacinengruppe B an und gehört
wohl auch systematisch hierher. Vielleicht sind bei ihr die für Delphaciden charakteristischen
Sporen an den Hinterbeinen nur sekundär verlorengegangen.
k) 11. Familie Tettigometridae.
Aus dieser, in Europa nu r mit der Gattung Tettigometra selbst vertretenen Familie
lagen bisher allein Beschreibungen männlicher Tiere vor, so daß über die Rektalorgane
und über die Vorgänge bei der Infektion der Ovarialeier nichts ausgesagt werden konnte.
B ü c h n e r untersuchte Tettigometra atra Hgb., S u l c Tettigometra obliqua P a n z . Von
diesen Formen besitze ich ein reichlicheres Material, das zum Teil (T.atra) auch zu Lebend-
Zoologica, Heft 98.