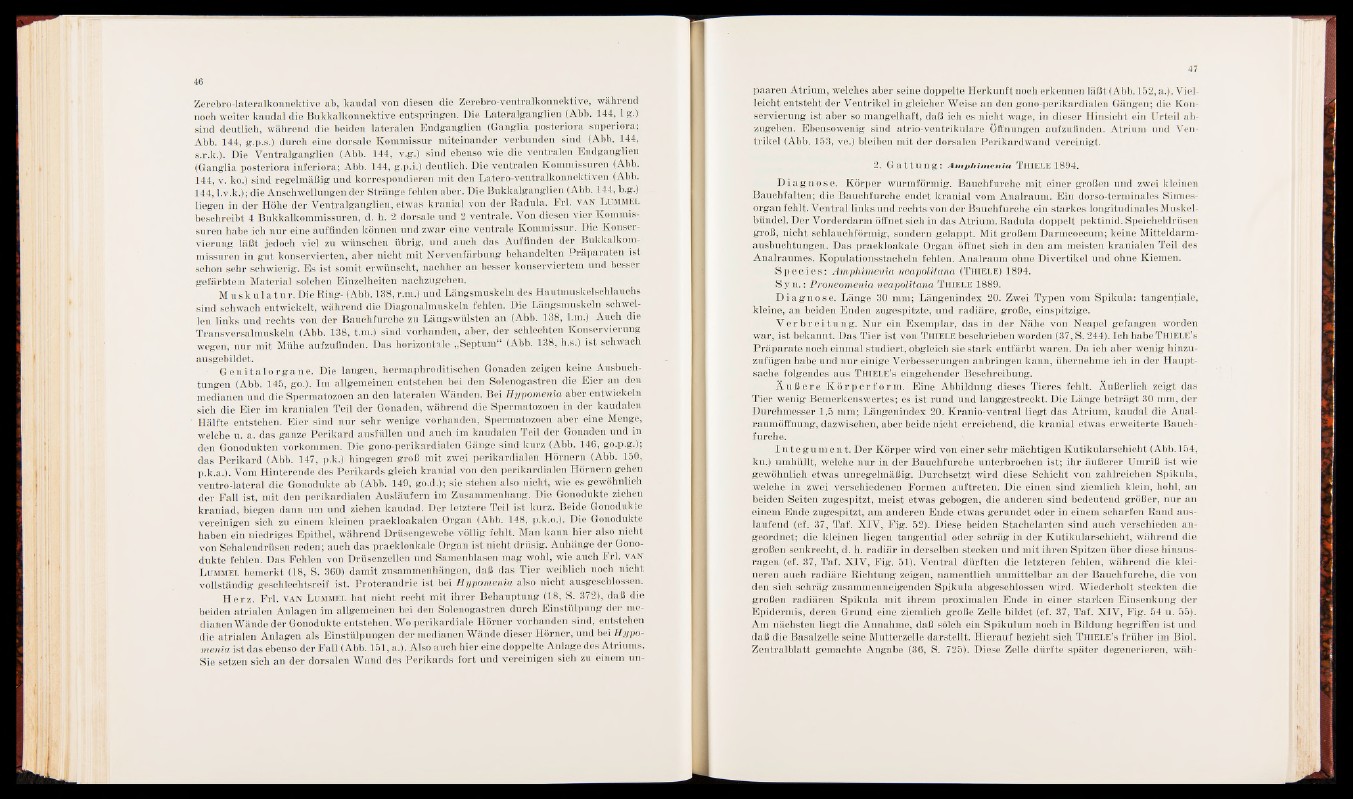
Zerebro-lateralkonnektive ab, kaudal von diesen die Zerebro-ventralkonnektive, während
noch weiter kaudal die Bukkalkonnektive entspringen. Die Lateralganglien (Abb. 144, l g.)
sind deutlich, während die beiden lateralen Endganglien (Ganglia posteriora superiora;
Abb. 144, g.p.s.) durch eine dorsale Kommissur miteinander verbunden sind (Abb. 144,
s.r.k.). Die Ventralganglien (Abb. 144, v.g.) sind ebenso wie die ventralen Endganglien
(Ganglia posteriora inferiora; Abb. 144, g.p.i.) deutlich. Die ventralen Kommissuren (Abb.
144, v. ko.) sind regelmäßig und korrespondieren mit den Latero-ventralkonnektiven (Abb.
144, l.v.k.); die Anschwellungen der Stränge fehlen aber. Die Bukkalganglien (Abb. 144, b.g.)
liegen in der Höhe der Ventralganglien, etwas kranial von der Radula. Frl. v a n L um m e l
beschreibt 4 Bukkalkommissuren, d. h. 2 dorsale und 2 ventrale. Von diesen vier Kommissuren
habe ich nur eine auf finden können und zwar eine ventrale Kommissur. Die Konservierung
läßt jedoch viel zu wünschen übrig, und auch das Auffinden der Bukkalkommissuren
in gut konservierten, aber nicht mit Nervenfärbung behandelten Präparaten ist
schon sehr schwierig. Es ist somit erwünscht, nachher an besser konserviertem und besser
gefärbtem Material solchen Einzelheiten nachzugehen.
M u s k u l a t u r . Die Ring- (Abb. 138, r.m.) und Längsmuskeln des Hautmuskelschlauehs
sind schwach entwickelt, während die Diagonalmuskeln fehlen. Die Längsmuskeln schwellen
links und rechts von der Bauchfurche zu Längswülsten an (Abb. 138, l.m.) Auch die
Transversalmuskeln (Abb. 138, t.m.) sind vorhanden, aber, der schlechten Konservierung
wegen, nur mit Mühe aufzufinden. Das horizontale „Septum“ (Abb. 138, h.s.) ist schwach
ausgebildet.
G e n i t a l o r g a n e . Die langen, hermaphroditischen Gonaden zeigen keine Ausbuchtungen
(Abb. 145, go.). Im allgemeinen entstehen bei den Solenogastren die Eier an den
medianen und die Spermatozoen an den lateralen Wänden. Bei Hypomenia aber entwickeln
sich die Eier im kranialen Teil der Gonaden, während die Spermatozoen in der kaudalen
Hälfte entstehen. Eier sind nur sehr wenige vorhanden, Spermatozoen aber eine Menge,
welche u. a. das ganze Perikard ausfüllen und auch im kaudalen Teil der Gonaden und in
den Gonodukten Vorkommen. Die gono-perikardialen Gänge sind kurz (Abb. 146, go.p.g.);
das Perikard (Abb. 147, p.k.) hingegen groß mit zwei perikardialen Hörnern (Abb. 150,
p.k.a.). Vom Hinterende des Perikards gleich kranial von den perikardialen Hörnern gehen
ventro-lateral die Gonodukte ab (Abb. 149, go.d.); sie stehen also nicht, wie es gewöhnlich
der Fall ist, mit den perikardialen Ausläufern im Zusammenhang. Die Gonodukte ziehen
kraniad, biegen dann um und ziehen kaudad. Der letztere Teil ist kurz. Beide Gonodukte
vereinigen sich zu einem kleinen praekloakalen Organ (Abb. 148, p.k.o.). Die Gonodukte
haben ein niedriges Epithel, während Drüsengewebe völlig fehlt. Man kann hier also nicht
von Schalendrüsen reden; auch das praekloakale Organ ist nicht drüsig. Anhänge der Gonodukte
fehlen. Das Fehlen von Drüsenzellen und Samenblasen mag wohl, wie auch Frl. v a n
L ummel bemerkt (18, S. 360) damit Zusammenhängen, daß das Tier weiblich noch nicht
vollständig geschlechtsreif ist. Proterandrie ist bei Hypomenia also nicht ausgeschlossen.
He r z . Frl. v a n L um m e l hat nicht recht mit ihrer Behauptung (18, S. 372), daß die
beiden atrialen Anlagen im allgemeinen bei den Solenogastren durch Einstülpung der medianen
Wände der Gonodukte entstehen. Wo perikardiale Hörner vorhanden sind, entstehen
die atrialen Anlagen als Einstülpungen der medianen Wände dieser Hörner, und bei Hypomenia
ist das ebenso der Fall (Abb. 151, a.). Also auch hier eine doppelte Anlage des Atriums.
Sie setzen sich an der dorsalen Wand des Perikards fort und vereinigen sich zu einem unpaaren
Atrium, welches aber seine doppelte Herkunft noch erkennen läßt (Abb. 152, a.). Vielleicht
entsteht der Ventrikel in gleicher Weise an den gono-perikardialen Gängen; die Konservierung
ist aber so mangelhaft, daß ich es nicht wage, in dieser Hinsicht ein Urteil abzugeben.
Ebensowenig sind atrio-ventrikuläre Öffnungen aufzufinden. Atrium und Ventrikel
(Abb. 153, ve.) bleiben mit der dorsalen Perikardwand vereinigt.
2. G a t t u n g : Amphiinenia THIELE 1894.
Di a g n o s e . Körper wurmförmig. Bauchfurche mit einer großen und zwei kleinen
Bauchfalten; die Bauchfurche endet kranial vom Analraum. Ein dorso-terminales Sinnesorgan
fehlt. Ventral links und rechts von der Bauchfurche ein starkes longitudinales Muskelbündel.
Der Vorderdarm öffnet sich in das Atrium. Radula doppelt pektinid. Speicheldrüsen
groß, nicht schlauchförmig, sondern gelappt. Mit großem Darmcoecum; keine Mitteldarmausbuchtungen.
Das praekloakale Organ öffnet sich in den am meisten kranialen Teil des
Analraumes. Kopulationsstacheln fehlen. Analraum ohne Divertikel und ohne Kiemen.
S p e c i e s : Amphimenia neapolitana (T h i e l e ) 1894.
Syn . : Proneomenia neapolitana T h i e l e 1889.
D i a g n o s e . Länge 30 mm; Längenindex 20. Zwei Typen vom Spikula: tangentiale,
kleine, an beiden Enden zugespitzte, und radiäre, große, einspitzige.
V e r b r e i t u n g . Nur ein Exemplar, das in der Nähe von Neapel gefangen worden
war, ist bekannt. Das Tier ist von T i i i e l e beschrieben worden (37, S. 244). Ich habeTHiELE’s
Präparate noch einmal studiert, obgleich sie stark entfärbt waren. Da ich aber wenig hinzuzufügen
habe und nur einige Verbesserungen anbringen kann, übernehme ich in der Hauptsache
folgendes aus T h i e l e ’s eingehender Beschreibung.
Ä u ß e r e K ö r p e r f o rm . Eine Abbildung dieses Tieres fehlt. Äußerlich zeigt das
Tier wenig Bemerkenswertes; es ist rund und langgestreckt. Die Länge beträgt 30 mm, der
Durchmesser 1,5 mm; Längenindex 20. Kranio-ventral liegt das Atrium, kaudal die Anair
raumöffnung, dazwischen, aber beide nicht erreichend, die kranial etwas erweiterte Bauchfurche.
I n t e g um e n t . Der Körper wird von einer sehr mächtigen K utikularschicht (Abb. 154,
ku.) umhüllt, welche nur in der Bauchfurche unterbrochen ist; ihr äußerer Umriß ist wie
gewöhnlich etwas unregelmäßig. Durchsetzt wird diese Schicht von zahlreichen Spikula,
welche in zwei verschiedenen Formen auf treten. Die einen sind ziemlich klein, hohl, an
beiden Seiten zugespitzt, meist etwas gebogen, die anderen sind bedeutend größer, nur an
einem Ende zugespitzt, am anderen Ende etwas gerundet oder in einem scharfen Rand auslaufend
(cf. 37, Taf. XIV, Fig. 52). Diese beiden Stachelarten sind auch verschieden angeordnet;
die kleinen liegen tangential oder schräg in der Kutikularschicht, während die
großen senkrecht, d. h. radiär in derselben stecken und mit ihren Spitzen über diese hinausragen
(cf. 37, Taf. XIV, Fig. 51). Ventral dürften die letzteren fehlen, während die kleineren
auch radiäre Richtung zeigen, namentlich unmittelbar an der Bauchfurche, die von
den sich schräg zusammenneigenden Spikula abgeschlossen wird. Wiederholt steckten die
großen radiären Spikula mit ihrem proximalen Ende in einer starken Einsenkung der
Epidermis, deren Grund eine ziemlich große Zelle bildet (cf. 37, Taf. XIV, Fig. 54 u. 55).
Am nächsten liegt die Annahme, daß solch ein Spikulum noch in Bildung begriffen ist und
daß die Basalzelle seine Mutterzelle darstellt. Hierauf bezieht sich T h i e l e ’s früher im Biol.
Zentralblatt gemachte Angabe (36, S. 725). Diese Zelle dürfte später degenerieren, wäh