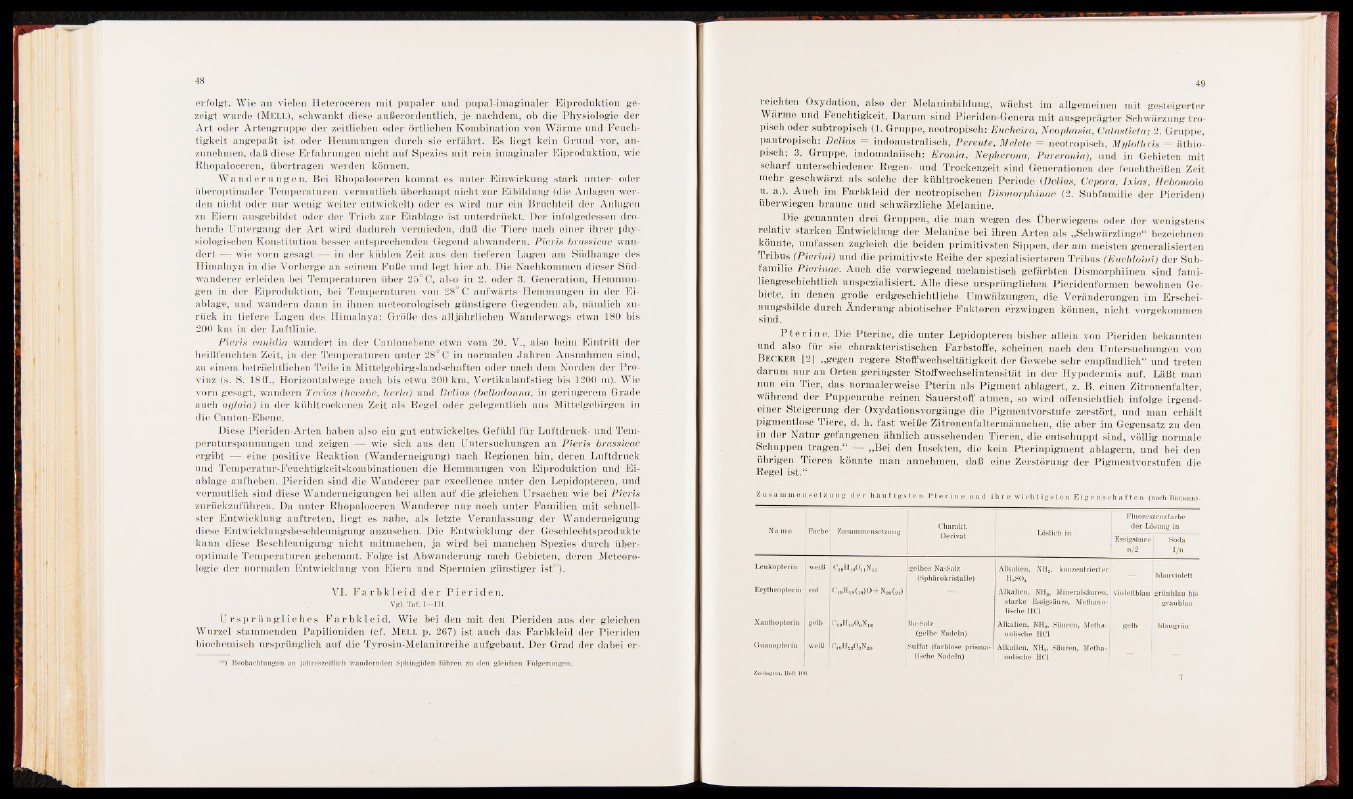
erfolgt. Wie an vielen Heteroceren mit pupaler und pupal-imaginaler Eiproduktion gezeigt
wurde (M e l l ) , schwankt diese außerordentlich, je nachdem, ob die Physiologie der
Art oder Artengruppe der zeitlichen oder örtlichen Kombination von Wärme und Feuchtigkeit
angepaßt ist oder Hemmungen durch sie erfährt. Es liegt kein Grund vor, anzunehmen,
daß diese Erfahrungen nicht auf Spezies mit rein imaginaler Eiproduktion, wie
Rhopaloceren, übertragen werden können.
Wa n d e r u n g e n . Bei Rhopaloceren kommt es unter Einwirkung stark unter- oder
überoptimaler Temperaturen vermutlich überhaupt nicht zur Eibildung (die Anlagen werden
nicht oder nur wenig weiter entwickelt) oder es wird nur ein Bruchteil der Anlagen
zu Eiern ausgebildet oder der Trieb zur Eiablage ist unterdrückt. Der infolgedessen drohende
Untergang der Art wird dadurch vermieden, daß die Tiere nach einer ihrer physiologischen
Konstitution besser entsprechenden Gegend abwandern. Pieris brassicae wandert
— wie vorn gesagt —*idn der kühlen Zeit aus den tieferen Lagen am Südhange des
Himalaya in die Vorberge an seinem Fuße und legt hier ab. Die Nachkommen dieser Südwanderer
erleiden bei Temperaturen über 25° C, also in 2 . oder 3. Generation, Hemmungen
in der Eiproduktion, bei Temperaturen von 28° C aufwärts Hemmungen in der Eiablage,
und wandern dann in ihnen meteorologisch günstigere Gegenden ab, nämlich zurück
in tiefere Lagen des Himalaya: Größe des alljährlichen Wanderwegs etwa 180 bis
200 km in der Luftlinie.
Pieris canidia wandert in der Cantonebene etwa vom 20. V., also beim E in tritt der
heißfeuchten Zeit, in der Temperaturen unter 28° C in normalen Jahren Ausnahmen sind,
zu einem beträchtlichen Teile in Mittelgebirgslandschaften oder nach dem Norden der Provinz
(s. S. 18.ff., Horizontalwege auch bis etwa 200 km, Vertikalaufstieg bis 1200 m). Wie
vorn gesagt, wandern Terias (hecabe, herla) und Delias (belladonna, in geringerem Grade
auch aglaia) in der kühltrockenen Zeit als Regel oder gelegentlich ans Mittelgebirgen in
die Canton-Ebene.
Diese Pieriden-Arten haben also ein gut entwickeltes Gefühl fü r Luftdruck- und Temperaturspannungen
und zeigen — wie sich aus den Untersuchungen an Pieris brassicae
e rg ib t^H e in e positive Reaktion (Wanderneigung) nach Regionen hin, deren Luftdruck
und Temperatur-Feuchtigkeitskombinationen die Hemmungen von Eiproduktion und Eiablage
aufheben. Pieriden sind die Wanderer par excellence unter den Lepidopteren, und
vermutlich sind diese Wanderneigungen bei allen auf die gleichen Ursachen wie bei Pieris
zurückzuführen. Da unter Rhopaloceren Wanderer nur noch unter Familien mit schnellster
Entwicklung auf treten, liegt es nahe, als letzte Veranlassung der Wanderneigung
diese Entwicklungsbeschleunigung anzusehen. Die Entwicklung der Geschlechtsprodukte
kann diese Beschleunigung nicht mitmachen, ja wird bei manchen Spezies durch überoptimale
Temperaturen gehemmt. Folge ist Abwanderung nach Gebieten, deren Meteorologie
der normalen Entwicklung von Eiern und Spermien günstiger ist39).
VI. F a r b k l e i d d e r P i e r i d e n .
Vgl. Taf. I—III.
U r s p r ü n g l i c h e s F a r b k l e i d . Wie bei den mit den Pieriden aus der gleichen
Wurzel stammenden Papilioniden (cf. Mell p. 267) ist auch das Farbkleid der Pieriden
biochemisch ursprünglich auf die Tyrosin-Melaninreihe aufgebaut. Der Grad der dabei er-
3!)) Beobachtungen an jahreszeitlich wandernden Sphingiden führen zu den gleichen Folgerungen.
reichten Oxydation, also der Melaninbildung, wächst im allgemeinen mit gesteigerter
Wärme und Feuchtigkeit. Darum sind Pieriden-Genera mit ausgeprägter Schwärzung tro-
pisch oder subtropisch (1 . Gruppe, neotropisch: Eucheira, Neophasia, Catasticta; 2. Gruppe,
pan tropisch: Delias ä in d o au stralisch , Pereute, Melete = neotropisch, Mylothris = äthiopisch;.
3:,. Gruppjjlindomalaiiseh: Eronia, Nepherona, Pareronia), und in Gebieten mit
scharf unterschiedener Eegen- und Trockenzeit sind Generationen der feuchtheißen Zeit
mehr geschwärzt als solche der kühltrockenen Periode (Delias, Cepora, Ixias, Hebomoia
u. a.). Auch im. Farbkleid der neotropischen Dismorphinae (2. Subfamilie der Pieriden)
überwiegen braune und schwärzliche Melanine.
Die genannten drei Gruppen, die man wegen des Überwiegens oder der wenigstens
relativ starken Entwicklung der Melanine bei ihren Arten als „Schwärzlinge“ bezeichnen
könnte, umfassen zugleich die beiden primitivsten Sippen, der am meisten generalisierten
Tribus (Pierini) und die primitivste Reihe der spezialisierteren Tribus (Euchloini) der Subfamilie
Pierinae. Auch die vorwiegend melanistisch gefärbten Dismorphiinen sind familiengeschichtlich
unspezialisiert. Alle diese ursprünglichen Pieridenformen bewohnen Gebiete,
in denen große erdgeschichtliche Umwälzungen, die Veränderungen im Erscheinungsbilde
durch Änderung abiotischer Faktoren erzwingen können, nicht vorgekommen
sind.
P t e r i n e. Die Pterine, die unter Lepidopteren bisher allein von Pieriden bekannten
und also für sie charakteristischen Farbstoffe, scheinen nach den Untersuchungen von
B e ck e r [2] „gegen regere Stoff Wechsel tätigkeit der Gewebe sehr empfindlich“ und treten
darum nur an Orten geringster Stoffwechselintensität in der Hypodermis auf. Läßt man
nun ein Tier, das normalerweise Pterin als Pigment ablagert, z. B. einen Zitronenfalter,
während der Puppenruhe reinen Sauerstoff atmen, so wird offensichtlich infolge irgendeiner
Steigerung der Oxydationsvorgänge die Pigmentvorstufe zerstört, und man erhält
pigmentlose Tiere, d. h. fast weiße Zitronenfaltermännchen, die aber im Gegensatz zu den
in der Natur gefangenen ähnlich aussehenden Tieren, die entschuppt sind, völlig normale
Schuppen tragen.“ jS H B e i den Insekten, die kein Pterinpigment ablagern, und bei den
übrigen Tieren könnte man annehmen, daß eine Zerstörung der Pigmentvorstufen die
Regel ist.“
Z u s a m m e n s e t z u n g d e r h ä u f i g s t e n P t e r i n e u n d i h r e w i c h t i g s t e n E i g e n s c h a f t e n ( n a c h B e c k e r ) .
Name Farbe Charakt.
Derivat Löslich in
Fluoreszenzfarbe
der Lösung in
n/2 | . 1/n
Leukopterin weiß gelbes Na-Salz
(Sphärokristalle)
Alkalien, NH3, konzentrierter
• h 2so4 blauviolett
Erythropterin rot Cioil,8(io)0+N30(2l) Alkalien, NHS, Mineralsäuren,
starke Essigsäure, Methano-
lische HCl
violettblau! grünblau bis
graublau
Xanthopterin gelb Ci 0H18O6N16 Ba-Salz
(gelbe Nadeln)
Alkalien, NH3, Säuren, Metha-
nolische HCl
gelb blaugrün
Guanopterin weiß C1öH22O3N20 Sulfat (farblose prismatische
Nadeln)
Alkalien, NH3, Säuren, Metha-
nolische HCl