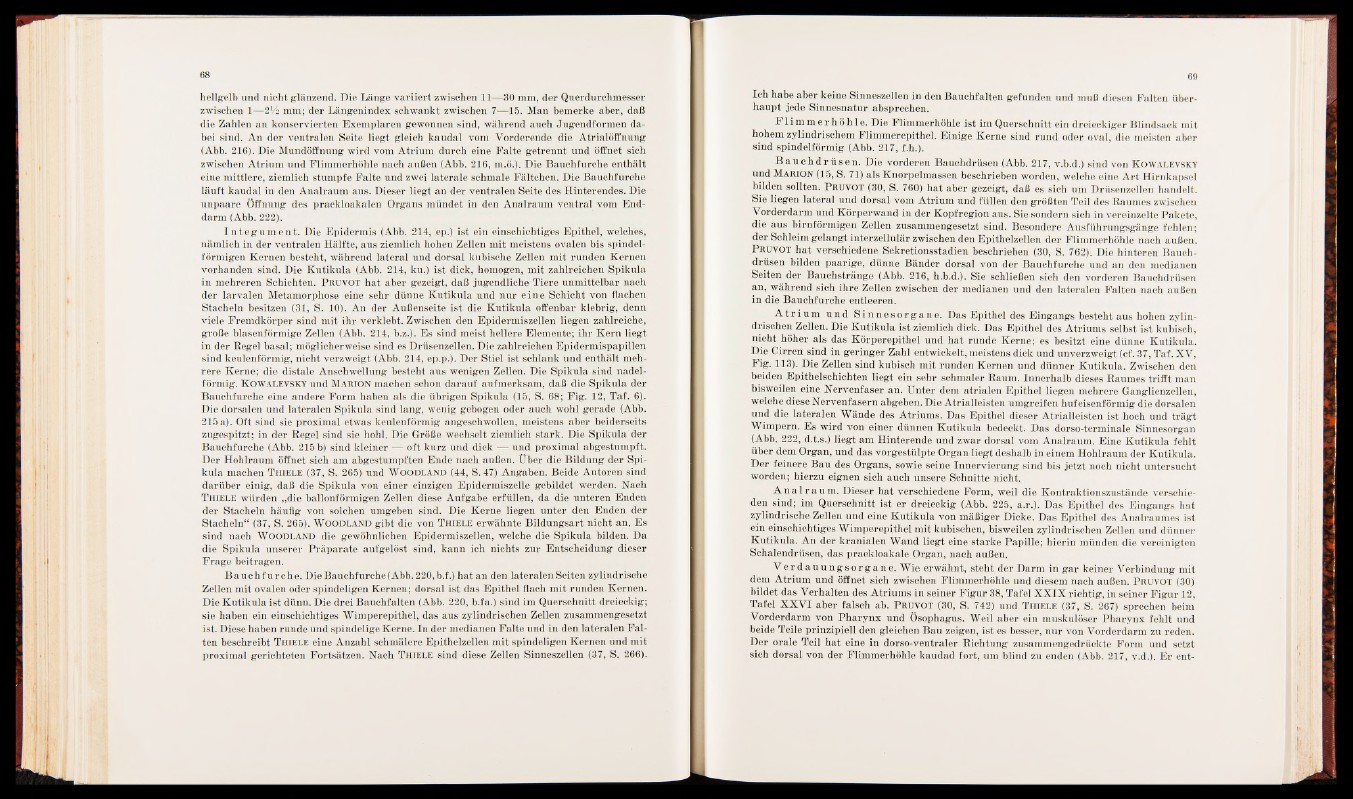
hellgelb und nicht glänzend. Die Länge va riiert zwischen 11—30 mm, der Querdurchmesser
zwischen 1—-2V2 mm; der Längenindex schwankt zwischen 7—15. Man bemerke aber, daß
die Zahlen an konservierten Exemplaren gewonnen sind, während auch Jugendformen dabei
sind. An der ventralen Seite liegt gleich kaudal vom Vorderende die Atrialöffnung
(Abb. 216). Die Mundöffnung wird vom Atrium durch eine Falte getrennt und öffnet sich
zwischen Atrium und Flimmerhöhle nach außen (Abb. 216, m.ö.). Die Bauchfurche enthält
eine mittlere, ziemlich stumpfe Falte und zwei laterale schmale Fältchen. Die Bauchfurche
läuft kaudal in den Analraum aus. Dieser liegt an der ventralen Seite des Hinterendes. Die
unpaare Öffnung des praekloakalen Organs mündet in den Analraum ventral vom Enddarm
(Abb. 222).
I n t e g um e n t . Die Epidermis (Abb. 214, ep.) ist ein einschichtiges Epithel, welches,
nämlich in der ventralen Hälfte, aus ziemlich hohen Zellen mit meistens ovalen bis spindelförmigen
Kernen besteht, während lateral und dorsal kubische Zellen mit runden Kernen
vorhanden sind. Die Kutikula (Abb. 214, ku.) ist dick, homogen, mit zahlreichen Spikula
in mehreren Schichten. P r u v o t hat aber gezeigt, daß jugendliche Tiere unmittelbar nach
der larvalen Metamorphose eine sehr dünne Kutikula und nur ein e Schicht von flachen
Stacheln besitzen (31, S. 10). An der Außenseite ist die Kutikula offenbar klebrig, denn
viele Fremdkörper sind mit ihr verklebt. Zwischen den Epidermiszellen liegen zahlreiche,
große blasenförmige Zellen (Abb. 214, b.z.). Es sind meist hellere Elemente; ihr Kern liegt
in der Regel basal; möglicherweise sind es Drüsenzellen. Die zahlreichen Epidermispapillen
sind keulenförmig, nicht verzweigt (Abb. 214, ep.p.). Der Stiel ist schlank und enthält mehrere
Kerne; die distale Anschwellung besteht aus wenigen Zellen. Die Spikula sind nadel-
förmig. K o w a l e v s k y und M a r i o n machen schon darauf aufmerksam, daß die Spikula der
Bauchfurche eine andere Form haben als die übrigen Spikula (15, S. 68; Fig. 12, Taf. 6).
Die dorsalen und lateralen Spikula sind lang, wenig gebogen oder auch wohl gerade (Abb.
215 a). Oft sind sie proximal etwas keulenförmig angeschwollen, meistens aber beiderseits
zugespitzt; in der Regel sind sie hohl. Die Größe wechselt ziemlich stark. Die Spikula der
Bauchfurche (Abb. 215 b) sind kleiner — oft kurz und dick — und proximal abgestumpft.
Der Hohlraum öffnet sich am abgestumpften Ende nach außen. Über die Bildung der Spikula
machen T h i e l e (37, S. 265) und W o o d l a n d (44, S. 47) Angaben. Beide Autoren sind
darüber einig, daß die Spikula von einer einzigen Epidermiszelle gebildet werden. Nach
T h i e l e würden „die ballonförmigen Zellen diese Aufgabe erfüllen, da die unteren Enden
der Stacheln häufig von solchen umgeben sind. Die Kerne liegen unter den Enden der
Stacheln“ (37, S. 265). W o o d l a n d gibt die von T h i e l e erwähnte Bildungsart nicht an. Es
sind nach W o o d l a n d die gewöhnlichen Epidermiszellen, welche die Spikula bilden. Da
die Spikula unserer Präparate aufgelöst sind, kann ich nichts zur Entscheidung dieser
Frage beitragen.
Ba u ch fu r c h e . Die Bauchfurche (Abb. 220, b.f.) ha t an den lateralen Seiten zylindrische
Zellen mit ovalen oder spindeligen Kernen; dorsal ist das Epithel flach mit runden Kernen.
Die K utikula ist dünn. Die drei Bauchfalten (Abb. 220, b.fa.) sind im Querschnitt dreieckig;
sie haben ein einschichtiges Wimperepithel, das aus zylindrischen Zellen zusammengesetzt
ist. Diese haben runde und spindelige Kerne. In der medianen F alte und in den lateralen Falten
beschreibt T h i e l e eine Anzahl schmälere Epithelzellen mit spindeligen Kernen und m it
proximal gerichteten Fortsätzen. Nach T h i e l e sind diese Zellen Sinneszellen (37, S. 266).
Ich habe aber keine Sinneszellen in den Bauchfalten gefunden und muß diesen Palten überhaupt
jede Sinnesnatur absprechen.
P l im m e r h ö h l e . Die Plimmerhöhle ist im Querschnitt ein dreieckiger Blindsack mit
hohem zylindrischem Plimmerepithel. Einige Kerne sind rund oder oval, die meisten aber
sind spindelförmig (Abh. 217, f.h.).
B a u c h d r ü s e n . Die vorderen Bauehdrüsen (Abb. 217, v.b.d.) sind von K o w a l e v s k y
und M a r i o n (15, S. 71) als Knorpelmassen beschrieben worden, welche eine Art Hirnkapsel
bilden sollten, P r u v o t (30, S. 760) hat aber gezeigt, daß es sich um Drüsenzellen handelt.
Sie liegen lateral und dorsal vom Atrium und füllen den größten Teil des Baumes zwischen
Vorderdarm und Körperwand in der Kopfregion aus. Sie sondern sich in vereinzelte Pakete,
die aus bimförmigen Zellen zusammengesetzt sind. Besondere Ausführungsgänge fehlen;
der Schleim gelangt interzellulär zwischen den Epithelzellen der Plimmerhöhle nach außen.
P r u v o t hat verschiedene Sekretionsstadien beschrieben7 (30, S. 762). Die hinteren Bauchdrüsen
bilden paarige, dünne Bänder dorsal von der Bauchfurche und an den medianen
Seiten der Bauchstränge (Abb. 216, h.b.d.). Sie schließen sich den vorderen Bauehdrüsen
an, während sich ihre Zellen zwischen der medianen und den lateralen Palten nach außen
in die Bauchfurche entleeren.
A t r i u m u n d S i n n e s o r g a n e . Das Epithel des Eingangs besteht aus hohen zylindrischen
Zellen. Die Kutikula ist ziemlich dick. Das Epithel des Atriums selbst ist kubisch,
nicht höher: a ls das Körperepithel und hat runde Kerne;'es besitzt eine dünne Kutikula.
Die Cirren sind in geringer Zahl entwickelt, meistens dick und unverzweigt (cf. 37, Taf. XV,
Fig. 113). Die Zellen sind kubisch mit runden Kernen und dünner Kutikula. Zwischen den
beiden Epithelschiehten liegt ein sehr schmaler Baum. Innerhalb dieses Baumes trifft man
bisweilen eine Nervenfaser an. Unter dem atrialen Epithel liegen mehrere Ganglienzellen,
welche diese Nervenfasern abgeben. Die Atrialleisten umgreifen hufeisenförmig die dorsalen
und die lateralen Wände des Atriums. Das Epithel dieser Atrialleisten ist hoch und trägt
Wimpern. Es wird von einer dünnen Kutikula bedeckt. Das dorso-terminale Sinnesorgan
(Abb. ,2|2, d.t.s.) liegt am Hinterende und zwar dorsal vom Analraum. Eine Kutikula fehlt
über dem Organ, und das vorgestülpte Organ liegt deshalb in einem Hohlraum der Kutikula.
Der feinere Bau des Organs, sowie seine Innervierung sind bis jetzt noch nicht untersucht
worden; hierzu eignen sich auch unsere Schnitte nicht.
A n a l r a um . Dieser ha t verschiedene Form, weil die Kontraktionszustände verschieden
sind; im Querschnitt ist er dreieckig (Abh. 225, a.r.). Das Epithel des Eingangs hat
zylindrische Zellen und eine Kutikula von mäßiger Dicke. Das Epithel des Analraumes ist
ein einschichtiges W imperepithel m it kubischen, bisweilen zylindrischen Zellen und dünner
Kutikula. An der kranialen Wand liegt eine starke Papille; hierin münden die vereinigten
Schalendrüsen, das praekloakale Organ, nach außen.
V e r d a u u n g s o r g a n e . Wie erwähnt, steht der Darm in gar keiner Verbindung mit
dem Atrium und öffnet sieh zwischen Flimmerhöhle und diesem nach außen. P r u v o t (30)
bildet das Verhalten des Atriums in seiner Figur 38, Tafel XXIX richtig, in seiner F igur 12,
Tafel XXVI aber falsch ab. P r u v o t (30, S. 742) und T h i e l e (37, S. 267) sprechen beim
Vorderdarm von Pharynx und Ösophagus. Weil aber ein muskulöser. Pharynx fehlt und
beide Teile prinzipiell den gleichen B au zeigen, ist es besser, nur von Vorderdarm zu reden.
Der orale Teil hat eine in dorso-ventraler Bichtung zusammengedrückte Form und setzt
sich dorsal von der Plimmerhöhle kaudad fort, um blind zu enden (Abb. 217, v.d.). E r ent