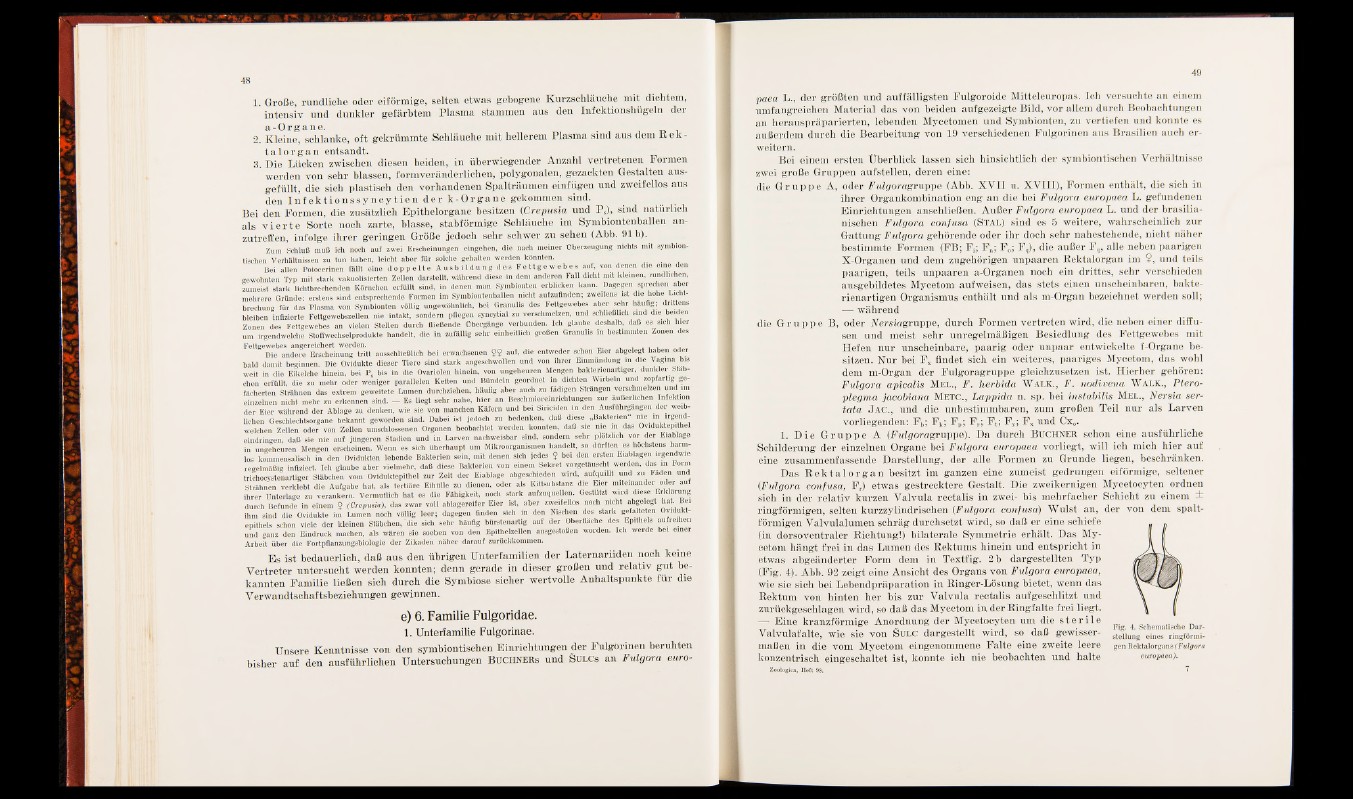
1. Große, rundliche oder eiförmige, selten etwas gebogene Kurzschläuche mit dichtem,
intensiv und dunkler gefärbtem Plasma stammen aus den Infektionshügeln der
a -Or g a n e .
2. Kleine, schlanke, oft gekrümmte Schläuche mit hellerem Plasma sind aus dem KeH-
t a l o r g a n entsandt.
3. Die Lücken zwischen diesen beiden, in überwiegender Anzahl vertretenen Formen
werden von sehr blassen, formveränderlichen, polygonalen, gezackten Gestalten ausgefüllt,
die sich plastisch den vorhandenen Spalträumen einfügen und zweifellos aus
den I n f e k t i o n s s y n c y t i e n d e r k -Or g a n e gekommen sind.
Bei den Formen, die zusätzlich Epithelorgane besitzen (Crepusia und P s), sind natürlich
als v i e r t e Sorte noch zarte, blasse, stabförmige Schläuche im Symbiontenballen anzutreffen,
infolge ihrer geringen Größe jedoch sehr schwer zu sehen (Abb. 91h).
Zum Schluß muß ich noch auf zwei Erscheinungen eingehen, die nach meiner Überzeugung nichts mit symbion-
tischen Verhältnissen zu tun haben, leicht aber für solche gehalten werden könnten.
Bei allen Poiocerinen fällt eine d o p p e l t e A u s b i l d u n g d e s F e t t g e w e b e s auf, von denen die eine den
gewohnten Typ mit stark vakuolisierten Zellen darstellt, während diese in dem anderen Fall dicht mit kleinen, rundlichen,
zumeist stark lichtbrechenden Körnchen erfüllt sind, in denen man Symbionten erblicken kann. Dagegen sprechen aber
mehrere Gründe: erstens sind entsprechende Formen im Symbiontenballen nicht aufzufinden; zweitens ist die hohe Lichtbrechung
für das Plasma von Symbionten völlig ungewöhnlich, bei Granulis des Fettgewebes aber sehr häufig; drittens
bleiben infizierte Fettgewebszellen nie intakt, sondern pflegen syncytial zu verschmelzen, und schließlich sind die beiden
Zonen des Fettgewebes an vielen Stellen durch fließende Übergänge verbunden. Ich glaube deshalb, daß es sich hier
um irgendwelche Stoffwechselprodukte handelt, die in zufällig sehr einheitlich großen Granulis m bestimmten Zonen des
Fettgewebes angereichert werden. ^ , WM
Die andere Erscheinung tritt ausschließlich bei erwachsenen $ $ auf, die entweder schon Eier abgelegt haben oder
bald damit beginnen. Die Ovidukte dieser Tiere sind stark angeschwollen und von ihrer Einmündung in die Vagina bis
weit in die Eikelche hinein, bei Ps bis in die Ovariolen hinein, von ungeheuren Mengen bakterienartiger, dunkler Stäbchen
erfüllt, die zu mehr oder weniger parallelen Ketten und Bündeln geordnet in dichten Wirbeln und zopfartig ge-
fächerten Strähnen das extrem geweitete Lumen durchziehen, häufig aber auch zu fädigen Strängen verschmelzen und im
einzelnen nicht mehr zu erkennen sind, g g Es hegt sehr nahe, hier an Beschmiereinrichtungen zur äußerlichen Infektion
der Eier während der Ablage zu denken, wie sie von manchen Käfern und bei Siriciden in den Ausführgängen der weiblichen
Geschlechtsorgane bekannt geworden sind. Dabei ist jedoch zu bedenken, daß diese „Bakterien" n e m irgendwelchen
Zellen oder von Zellen umschlossenen Organen beobachtet werden konnten, daß sie nie in das Oviduktepithel
eindringen, daß sie nie auf jüngeren Stadien und in Larven nachweisbar sind, sondern sehr plötzlich vor der Eiablage
in ungeheuren Mengen erscheinen. Wenn es sich überhaupt um Mikroorganismen handelt, so dürften es höchstens harmlos
kommensalisch in den Ovidukten lebende Bakterien sein, mit denen sich jedes 5 be i den ersten Eiablagen irgendwie
regelmäßig infiziert. Ich glaube aber vielmehr, daß diese Bakterien von einem Sekret vorgetäuscht werden, das in Form
trichocvstenartiger Stäbchen vom Oviduktepithel zur Zeit der Eiablage abgeschieden wird, aufquiUt und zu Faden und
Strähnen verklebt die Aufgabe hat, als tertiäre Eihülle zu dienen, oder als Kittsubstanz .die Eier miteinander oder auf
ihrer Unterlage zu verankern. Vermutlich hat es die Fähigkeit, noch stark aufzuquellen. Gestützt wird diese Erklärung
durch Befunde in einem H (Crepusia), das zwar voll ablagereifer Eier ist, aber zweifellos noch nicht abgelegt h a t Bei
ihm sind die Ovidukte im Lumen noch völlig leer; dagegen finden sich in den Nischen des stark g e alteten Oviduktepithels
schon viele der kleinen Stäbchen, die sich sehr häufig bürstenartig auf der Oberfläche des Epithels aufreihen
und ganz den Eindruck machen, als wären sie soeben von den Epithelzellen ausgestoßen worden. Ich werde bei einer
Arbeit über die Fortpflanzungsbiologie der Zikaden näher darauf zurückkommen.
Es ist bedauerlich, daß aus den übrigen Unterfamilien der Laternariiden noch keine
Vertreter untersucht werden konnten; denn gerade in dieser großen und relativ gut bekannten
Familie ließen sieh durch die Symbiose sicher wertvolle Anhaltspunkte für die
Verwandtschaftsbeziehungen gewinnen.
e) 6. Familie Fulgoridae.
1. Unterfamilie Fulgorinae.
Unsere Kenntnisse von den symbiontisehen Einrichtungen der Fulgörinen beruhten
bisher auf den ausführlichen Untersuchungen B ü ch n er s und SüLCs an Fulgora europaea
L., der größten und auffälligsten Fulgoroide Mitteleuropas. Ich versuchte an einem
umfangreichen Material das von beiden aufgezeigte Bild, vor allem durch Beobachtungen
an herauspräparierten, lebenden Mycetomen und Symbionten, zn vertiefen und konnte es
außerdem durch die Bearbeitung von 19 verschiedenen Fulgörinen aus Brasilien auch erweitern.
Bei einem ersten Überblick lassen sich hinsichtlich der symbiontisehen Verhältnisse
zwei große Gruppen aufstellen, deren eine:
die Gr u p p e A, oder Fulgoragruppe (Abb. XVII u. XVIII), Formen enthält, die sich in
ihrer Organkombination eng an die bei Fulgora europaea L. gefundenen
Einrichtungen anschließen. Außer Fulgora europaea L. und der brasilianischen
Fulgora confusa (Sta l) sind es 5 weitere, wahrscheinlich zur
Gattung Fulgora gehörende oder ihr doch sehr nahestehende, nicht näher
bestimmte Formen (FB; F n; F 0; F q), die außer F q, alle neben paarigen
X-Organen und dem zugehörigen unpaaren Rektalorgan im 9, und teils
paarigen, teils unpaaren a-Organen noch ein drittes, sehr verschieden
ansgebildetes Mycetom aufweisen, das stets einen unscheinbaren, bakterienartigen
Organismus enthält und als m-Organ bezeichnet werden soll;
während
die Gr u p p e B, oder Aersmgruppe, durch Formen vertreten wird, die neben einer diffusen
und meist sehr unregelmäßigen Besiedlung des Fettgewebes mit
Hefen nur unscheinbare, paarig oder unpaar entwickelte f-Organe besitzen.
Nur bei F x findet sich ein weiteres, paariges Mycetom, das wohl
dem m-Organ der Fulgoragruppe gleichzusetzen ist. Hierher gehören:
Fulgora apicalis Me l ., F. herbida W a lk ., F. nodivena W a lk ., Ptero-
plegma jacobiana Me t c ., Lappida n. sp. bei instabilis Me l ., Nersia ser-
tata JAC., und die unbestimmbaren, zum großen Teil nur als Larven
vorliegenden: F b; F k; F p; F r; F t; F y; F x und Cx0.
1. D ie Gr u p p e A (Fulgoragruppe). Da durch B ü c h n e r schon eine ausführliche
Schilderung der einzelnen Organe bei Fulgora europaea vorliegt, will ich mich hier auf
eine zusammenfassende Darstellung, der alle Formen zu Grunde liegen, beschränken.
Das R e k t a l o r g a n besitzt im ganzen eine zumeist gedrungen eiförmige, seltener
{Fulgora confusa, F r) etwas gestrecktere Gestalt. Die zweikernigen Mycetocyten ordnen
sich in der relativ kurzen Valvula rectalis in zwei- bis mehrfacher Schicht zu einem i
ringförmigen, selten kurzzylindrischen {Fulgora confusa) Wulst an, der von dem spaltförmigen
Valvulalumen schräg durchsetzt wird, so daß er eine schiefe
(in dorsoventraler Richtung!) bilaterale Symmetrie erhält. Das Mycetom
hängt frei in das Lumen des Rektums hinein und entspricht in
etwas abgeänderter Form dem in Textfig. 2 b dargestellten Typ
(Fig. 4). Abh. 92 zeigt eine Ansicht des Organs von Fulgora europaea,
wie sie sich bei Lebendpräparation in Ringer-Lösung bietet, wenn das
Rektum von hinten her bis zur Valvula rectalis auf geschlitzt und
zurückgeschlagen wird, so daß das Mycetom in der Ringfalte frei liegt.
— Eine kranzförmige Anordnung der Mycetocyten um die s t e r i l e
Valvulafalte, wie sie von ÖULC dargestellt wird, so daß gewissermaßen
in die vom Mycetom eingenommene Falte eine zweite leere
konzentrisch eingeschaltet ist, konnte ich nie beobachten und halte
Fig. 4. Schematische Darstellung
eines ringförmigen
Rektalorgans (Fulgora
europaea).