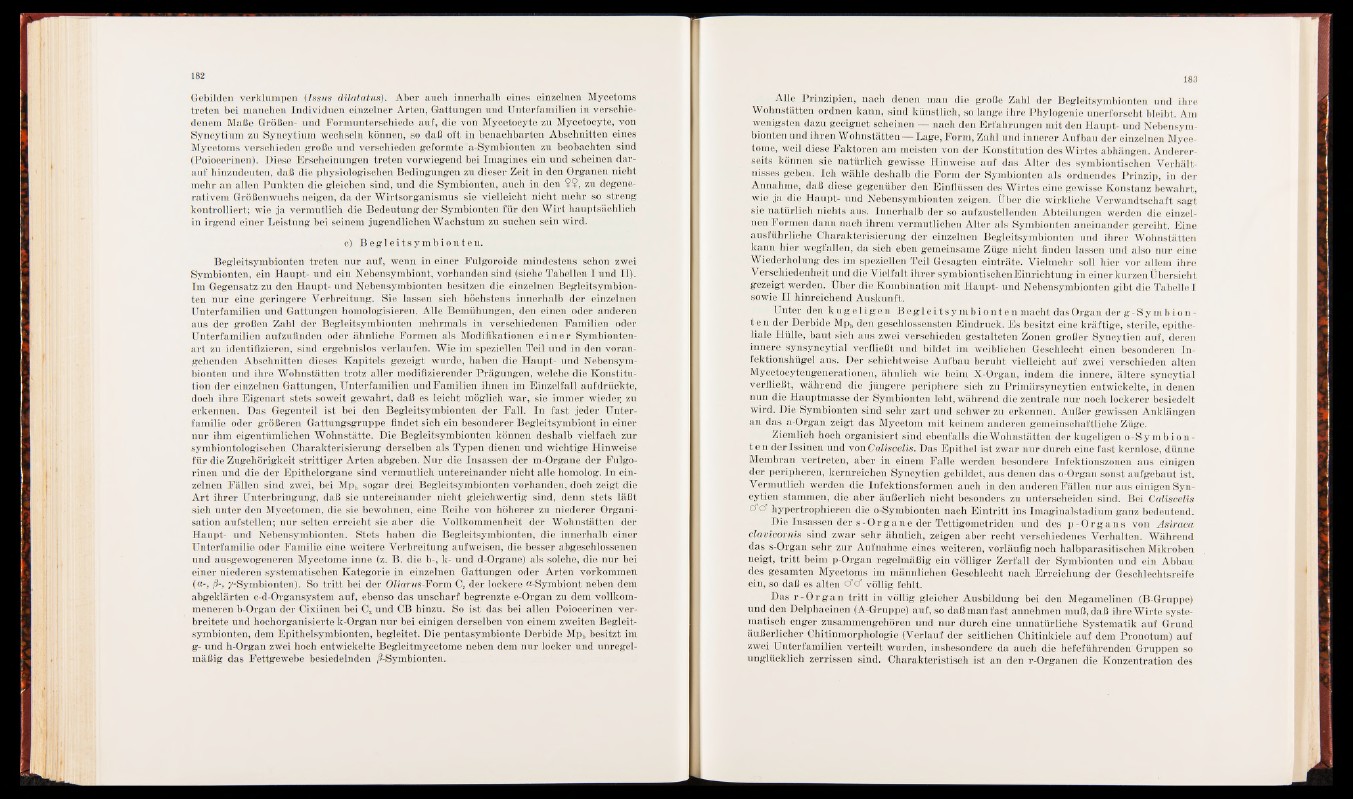
Gebilden verklumpen (Issus dilatatus). Aber auch innerhalb eines einzelnen Mycetoms
treten bei manchen Individuen einzelner Arten, Gattungen und Unterfamilien in verschiedenem
Maße Größen- und Formunterschiede auf, die von Mycetocyte zu Mycetocyte, von
Syncytium zu Syncytium wechseln können, so daß oft in benachbarten Abschnitten eines
Mycetoms verschieden große und verschieden geformte a-Symbionten zu beobachten sind
(Poiocerinen). Diese Erscheinungen treten vorwiegend bei Imagines ein und scheinen da rauf
hinzudeuten, daß die physiologischen Bedingungen zu dieser Zeit in den Organen nicht
mehr an allen Punkten die gleichen sind, und die Symbionten, auch in den 99, zu degene-
rativem Größen wuchs neigen, da der Wirtsorganismus sie vielleicht nicht mehr so streng
kontrolliert; wie ja vermutlich die Bedeutung der Symbionten fü r den Wirt hauptsächlich
in irgend einer Leistung bei seinem jugendlichen Wachstum zu suchen sein wird.
c) B e g l e i t s ymb i o n t e n .
Begleitsymbionten treten nur auf, wenn in einer Fulgoroide mindestens schon zwei
Symbionten, ein Haupt- und ein Nebensymbiont, vorhanden sind (siehe Tabellen I und II).
Im Gegensatz zu den Haupt- und Nebensymbionten besitzen die einzelnen Begleitsymbionten
nur eine geringere Verbreitung. Sie lassen sich höchstens innerhalb der einzelnen
Unterfamilien und Gattungen homologisieren. Alle Bemühungen, den einen oder anderen
aus der großen Zahl der Begleitsymbionten mehrmals in verschiedenen Familien oder
Unterfamilien aufzufinden oder ähnliche Formen als Modifikationen e i n e r Symbionten-
a rt zu identifizieren, sind ergebnislos verlaufen. Wie im speziellen Teil und in den vorangehenden
Abschnitten dieses Kapitels gezeigt wurde, haben die Haupt- und Nebensymbionten
und ihre Wohnstätten trotz aller modifizierender Prägungen, welche die Konstitution
der einzelnen Gattungen, Unterfamilien und Familien ihnen im Einzelfall aufdrückte,
doch ihre Eigenart stets soweit gewahrt, daß es leicht möglich war, sie immer wieder, zu
erkennen. Das Gegenteil ist bei den Begleitsymbionten der Fall. In fast jeder Unterfamilie
oder größeren Gattungsgruppe findet sich ein besonderer Begleitsymbiont in einer
nur ihm eigentümlichen Wohnstätte. Die Begleitsymbionten können deshalb vielfach zur
symbiontologischen Charakterisierung derselben als Typen dienen und wichtige Hinweise
für die Zugehörigkeit strittiger Arten abgeben. Nur die Insassen der m-Organe der Fulgo-
rinen und die der Epithelorgane sind vermutlich untereinander nicht alle homolog. In einzelnen
Fällen sind zwei, bei Mpb sogar drei Begleitsymbionten vorhanden, doch zeigt die
Art ihrer Unterbringung, daß sie untereinander nicht gleichwertig sind, denn stets läßt
sich unter den Mycetomen, die sie bewohnen, eine Reihe von höherer zu niederer Organisation
auf stellen; nur selten erreicht sie aber die Vollkommenheit der Wohnstätten der
Haupt- und Nebensymbionten. Stets haben die Begleitsymbionten, die innerhalb einer
Unterfamilie oder Familie eine weitere Verbreitung auf weisen, die besser abgeschlossenen
und ausgewogeneren Mycetome inne (z. B. die b-, k- und d-Organe) als solche, die nur bei
einer niederen systematischen Kategorie in einzelnen Gattungen oder Arten Vorkommen
(a ß - , y-Symbionten). So tritt bei der Oliarus-Form C7 der lockere a-Symbiont neben dem
abgeklärten c-d-Organsystem auf, ebenso das unscharf begrenzte e-Organ zu dem vollkommeneren
b-Organ der Cixiinen bei Cx und CB hinzu. So ist das bei allen Poiocerinen verbreitete
und hochorganisierte k-Organ nur bei einigen derselben von einem zweiten Begleitsymbionten,
dem Epithelsymbionten, begleitet. Die pentasymbionte Derbide Mpb besitzt im
g- und h-Organ zwei hoch entwickelte Begleitmycetome neben dem nur locker und unregelmäßig
das Fettgewebe besiedelnden ^-Symbionten.
Alle Prinzipien, nach denen man die große Zahl der Begleitsymbionten und ihre
Wohnstätten ordnen kann, sind künstlich, so lange ihre Phylogenie unerforscht bleibt. Am
wenigsten dazu geeignet scheinen — nach den Erfahrungen mit den Haupt- und Nebensymbionten
und ihren Wohnstätten — Lage, Form, Zahl und innerer A ufbau der einzelnen Mycetome,
weil diese Faktoren am meisten von der Konstitution des Wirtes abhängen. Andererseits
können sie natürlich gewisse Hinweise auf das Alter des symbiontischen Verhältnisses
geben. Ich wähle deshalb die Form der Symbionten als ordnendes Prinzip, in der
Annahme, daß diese gegenüber den Einflüssen des Wirtes eine gewisse Konstanz bewahrt,
wie ja die Haupt- und Nebensymbionten zeigen. Über die wirkliche Verwandtschaft sagt
sie natürlich nichts aus. Innerhalb der so aufzusteilenden Abteilungen werden die einzelnen
Formen dann nach ihrem vermutlichen Alter als Symbionten aneinander gereiht. Eine
ausführliche Charakterisierung der einzelnen Begleitsymbionten und ihrer Wohnstätten
kann hier wegfallen, da sich eben gemeinsame Züge nicht finden lassen und also nur eine
Wiederholung des im speziellen Teil Gesagten einträte. Vielmehr soll hier vor allem ihre
Verschiedenheit und die Vielfalt ihrer symbiontischen Einrichtung in einer kurzen Übersicht
gezeigt werden. Über die Kombination mit Haupt- und Nebensymbionten gibt die Tabelle I
sowie I I hinreichend Auskunft.
Unter den k u g e l i g e n B e g l e i t s ymb i o n t e n macht das Organ der g - S y m b i o n -
t e n der Derbide Mpb den geschlossensten Eindruck. Es besitzt eine kräftige, sterile, epitheliale
Hülle, baut sich aus zwei verschieden gestalteten Zonen großer Syncytien auf, deren
innere synsyncytial verfließt und bildet im weiblichen Geschlecht einen besonderen In fektionshügel
aus. Der schichtweise Aufbau beruht vielleicht auf zwei verschieden alten
Mycetocytengenerationen, ähnlich wie beim X-Organ, indem die innere, ältere syncytial
verfließt, während die jüngere periphere sich zu Primärsyncytien entwickelte, in denen
nun die Hauptmasse der Symbionten lebt, während die zentrale nur noch lockerer besiedelt
wird. Die Symbionten sind sehr zart und schwer zu erkennen. Außer gewissen Anklängen
an das a-Organ zeigt das Mycetom mit keinem anderen gemeinschaftliche Züge.
Ziemlich hoch organisiert sind ebenfalls die Wohnstätten der kugeligen o - Symb i o n-
t en der Issinen und vonCaliscelis. Das Epithel ist zwar nur durch eine fast kernlose, dünne
Membran vertreten, aber in einem Falle werden besondere Infektionszonen aus einigen
der peripheren, kernreichen Syncytien gebildet, aus denen das o-Organ sonst aufgebaut ist.
Vermutlich werden die Infektionsformen auch in den anderen Fällen nur aus einigen Syncytien
stammen, die aber äußerlich nicht besonders zu unterscheiden sind. Bei Caliscelis
cf cf hypertrophieren die o-Symbionten nach E in tritt ins Imaginalstadium ganz bedeutend.
Die Insassen der s - O r g a n e der Tettigometriden und des p -Or g a n s von Asiraca
clavicornis sind zwar sehr ähnlich, zeigen aber recht verschiedenes Verhalten. Während
das s-Organ sehr zur Aufnahme eines weiteren, vorläufig noch halbparasitischen Mikroben
neigt, tritt beim p-Organ regelmäßig ein völliger Zerfall der Symbionten und ein Abbau
des gesamten Mycetoms im männlichen Geschlecht nach Erreichung der Geschlechtsreife
ein, so daß es alten cf Cf völlig fehlt.
Das r -O r g a n tritt in völlig gleicher Ausbildung bei den Megamelinen (B-Gruppe)
und den Delphacinen (A-Gruppe) auf, so daß man fast annehmen muß, daß ihre Wirte systematisch
enger zusammengehören und nur durch eine unnatürliche Systematik auf Grund
äußerlicher Chitinmorphologie (Verlauf der seitlichen Chitinkiele auf dem Pronotum) auf
zwei Unterfamilien verteilt wurden, insbesondere da auch die hefeführenden Gruppen so
unglücklich zerrissen sind. Charakteristisch ist an den r-Organen die Konzentration des