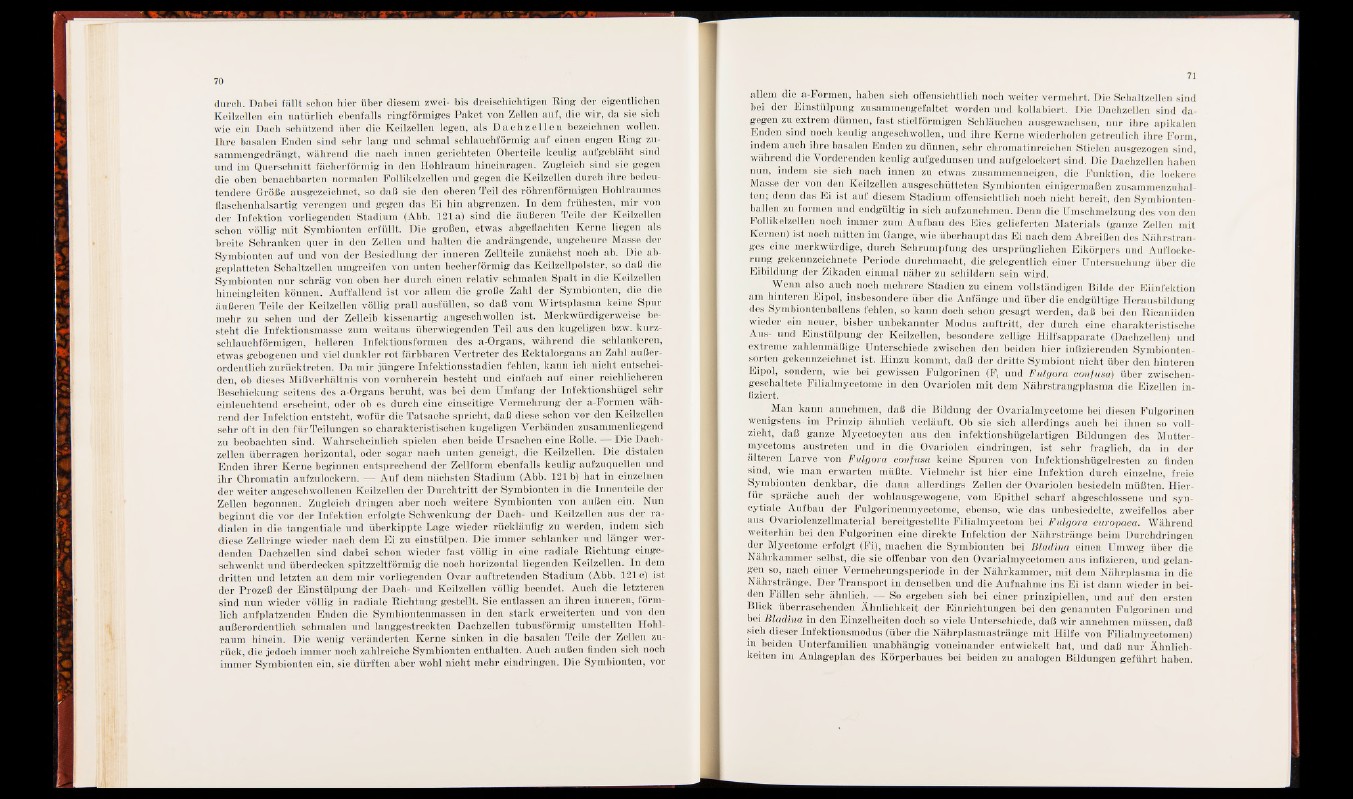
durch. Dabei fällt schon hier über diesem zwei- bis dreischichtigen Ring der eigentlichen
Keilzellen ein natürlich ebenfalls ringförmiges Paket von Zellen auf, die wir, da sie sich
wie ein Dach schützend über die Keilzellen legen, als Da c h z e l l e n bezeichnen wollen.
Ihre basalen Enden sind sehr lang und schmal schlauchförmig auf einen engen Ring zusammengedrängt,
während die nach innen gerichteten Oberteile lceulig aufgebläht sind
und im Querschnitt fächerförmig in den Hohlraum hineinragen. Zugleich sind sie gegen
die oben benachbarten normalen Follikelzellen und gegen die Keilzellen durch ihre bedeutendere
Größe ausgezeichnet, so daß sie den oberen Teil des röhrenförmigen Hohlraumes
flaschenhalsartig verengen und gegen das Ei hin abgrenzen. In dem frühesten, mir von
der Infektion vorliegenden Stadium (Abh. 121a) sind die äußeren Teile der Keilzellen
schon völlig mit Symbionten erfüllt. Die großen, etwas abgeflachten Kerne liegen als
breite Schranken quer in den Zellen und halten die andrängende, ungeheure Masse der
Symbionten auf und von der Besiedlung der inneren Zellteile zunächst noch ab. Die abgeplatteten
Sehaltzellen umgreifen von unten becherförmig das Keilzellpolster, so daß die
Symbionten nur schräg von oben her durch einen relativ schmalen Spalt in die Keilzellen
hineingleiten können. Auffallend ist vor allem die große Zahl der Symbionten, die die
äußeren Teile der Keilzellen völlig prall ausfüllen, so daß vom Wirtsplasma keine Spur
mehr zu sehen und der Zelleib kissenartig angeschwollen ist. Merkwürdigerweise besteht
die Infektionsmasse zum weitaus überwiegenden Teil aus den kugeligen bzw. kurzsehlauchförmigen,
helleren Infektionsformen des a-Organs, während die schlankeren,
etwas gebogenen und viel dunkler rot färbbaren Vertreter des Rektalorgans an Zahl außerordentlich
zurücktreten. Da mir jüngere Infektionsstadien fehlen, kann ich nicht entscheiden,
ob dieses Mißverhältnis von vornherein besteht und einfach auf einer reichlicheren
Beschickung seitens des a-Organs beruht, was bei dem Umfang der Infektionshügel sehr
einleuchtend erscheint, oder ob es durch eine einseitige Vermehrung der a-Formen während
der Infektion entsteht, wofür die Tatsache spricht, daß diese schon vor den Keilzellen
sehr oft in den für Teilungen so charakteristischen kugeligen Verbänden zusammenliegend
zu beobachten sind. Wahrscheinlich spielen eben beide Ursachen eine Rolle. — Die Daeh-
zellen überragen horizontal, oder sogar nach unten geneigt, die Keilzellen. Die distalen
Enden ihrer Kerne beginnen entsprechend der Zellform ebenfalls keulig aufzuquellen und
ihr Chromatin aufzulockern. Auf dem nächsten Stadium (Abb. 121 b) hat in einzelnen
der weiter angeschwollenen Keilzellen der Durchtritt der Symbionten in die Innenteile der
Zellen begonnen. Zugleich dringen aber noch weitere Symbionten von außen ein. Nun
beginnt die vor der Infektion erfolgte Schwenkung der Dach- und Keilzellen aus der ra dialen
in die tangentiale und überkippte Lage wieder rückläufig zu werden, indem sich
diese Zellringe wieder nach dem Ei zu einstülpen. Die immer schlanker und länger werdenden
Dachzellen sind dabei schon wieder fast völlig in eine radiale Richtung eingeschwenkt
und überdecken spitzzeltförmig die noch horizontal liegenden Keilzellen. In dem
dritten und letzten an dem mir vorliegenden Ovar auf tretenden Stadium (Abh. 121 o) ist
der Prozeß der Einstülpung der Dach- und Keilzellen völlig beendet. Auch die letzteren
sind nun wieder völlig in radiale Richtung gestellt. Sie entlassen an ihren inneren, förmlich
aufplatzenden Enden die Symbiontenmassen in den stark erweiterten und von den
außerordentlich schmalen und langgestreckten Dachzellen tubusförmig umstellten Hohlraum
hinein. Die wenig veränderten Kerne sinken in die basalen Teile der Zellen zurück,
die jedoch immer noch zahlreiche Symbionten enthalten. Auch außen finden sich noch
immer Symbionten ein, sie dürften aber wohl nicht mehr eindringen. Die Symbionten, vor
allem die a-Formen, haben sich offensichtlich noch weiter vermehrt. Die Schaltzellen sind
bei der Einstülpung zusammengefaltet worden und kollabiert. Die Dachzellen sind dagegen
zu extrem dünnen, fast stielförmigen Schläuchen ausgewachsen, nur ihre apikalen
Enden sind noch keulig angeschwollen, und ihre Kerne wiederholen getreulich ihre Form,
indem auch ihre basalen Enden zu dünnen, sehr chromatinreichen Stielen ausgezogen sind,
während die Vorderenden keulig aufgedunsen und aufgelockert sind. Die Dachzellen haben
nun, indem sie sich nach innen zu etwas zusammenneigen, die Funktion, die lockere
Masse der von den Keilzellen ausgeschütteten Symbionten einigermaßen zusammenzuhalten;
denn das Ei ist auf diesem Stadium offensichtlich noch nicht bereit, den Symbionten-
ballen zu formen und endgültig in sich aufzunehmen. Denn die Umschmelzung des von den
Follikelzellen noch immer zum Aufbau des Eies gelieferten Materials (ganze Zellen mit
Kernen) ist noch mitten im Gange, wie überhaupt das Ei nach dem Abreißen des Nährstran-
ges eine merkwürdige, durch Schrumpfung des ursprünglichen Eikörpers und Auflockerung
gekennzeichnete Periode durehmacht, die gelegentlich einer Untersuchung über die
Eibildung der Zikaden einmal näher zu schildern sein wird.
Wenn also auch noch mehrere Stadien zu einem vollständigen Bilde der Eiinfektion
am hinteren Eipol, insbesondere über die Anfänge und über die endgültige Herausbildung
des Symbiontenballens fehlen, so kann doch schon gesagt werden, daß bei den Ricaniiden
wieder ein neuer, bisher unbekannter Modus au ftritt, der durch eine charakteristische
Aus- und Einstülpung der Keilzellen, besondere zellige Hilfsapparate (Dachzellen) und
extreme zahlenmäßige Unterschiede zwischen den beiden hier infizierenden Symbionten-
sorten gekennzeichnet ist. Hinzu kommt, daß der dritte Symbiont nicht über den hinteren
Eipol, sondern, wie bei gewissen Fulgorinen (F, und Fulgora confusa) über zwischengeschaltete
Filialmycetome in den Ovariolen mit dem Nährstrangplasma die Eizellen infiziert.
Man kann annehmen, daß die Bildung der Ovarialmyeetome bei diesen Fulgorinen
wenigstens, im Prinzip ähnlich verläuft. Ob sie sich allerdings auch bei ihnen so vollzieht,
daß ganze Mycetoeyten aus den infektionshügelartigen Bildungen des Mutter-
mycetoms austreten und in die Ovariolen eindringen, ist sehr fraglich, da in der
älteren Larve von Fulgora confusa keine Spuren von Infektionshügelresten zu finden
sind, wie man erwarten müßte'. Vielmehr ist hier eine Infektion durch einzelne, freie
Symbionten denkbar, die dann allerdings Zellen der Ovariolen besiedeln müßten. Hierfür
spräche auch der wohlausgewogene, vom Epithel scharf abgeschlossene und syn-
cytiale Aufbau der Fulgorinenmycetome, ebenso, wie das unbesiedelte, zweifellos aber
aus Ovariolenzellmaterial bereitgestellte Filialmycetom bei Fulgora europaea. Während
weiterhin bei den Fulgorinen eine direkte Infektion der Nährstränge beim Durchdringen
der Myeetome erfolgt (Fi), machen die Symbionten bei Bladina einen Umweg über die
Nährkammer selbst, die sie offenbar von den Ovarialmycetomen aus infizieren, und gelangen
so, nach einer Vermehrungsperiode in der Nährkammer, mit dem Nährplasma in die
Nährstränge. Der Transport in denselben und die Aufnahme ins Ei ist dann wieder in beiden
Fällen sehr ähnlich. - 9 So ergeben sich bei einer prinzipiellen, und auf den ersten
Blick überraschenden Ähnlichkeit der Einrichtungen bei den genannten Fulgorinen und
bei Bladina in den Einzelheiten doch so viele Unterschiede, daß wir annehmen müssen, daß
sich dieser Infektionsmodus (über die Nährplasmastränge mit Hilfe von Filialmycetomen)
in beiden Unterfamilien unabhängig voneinander entwickelt hat, und daß nur Ähnlichkeiten
im Anlageplan des Körperbaues bei beiden zu analogen Bildungen geführt haben.