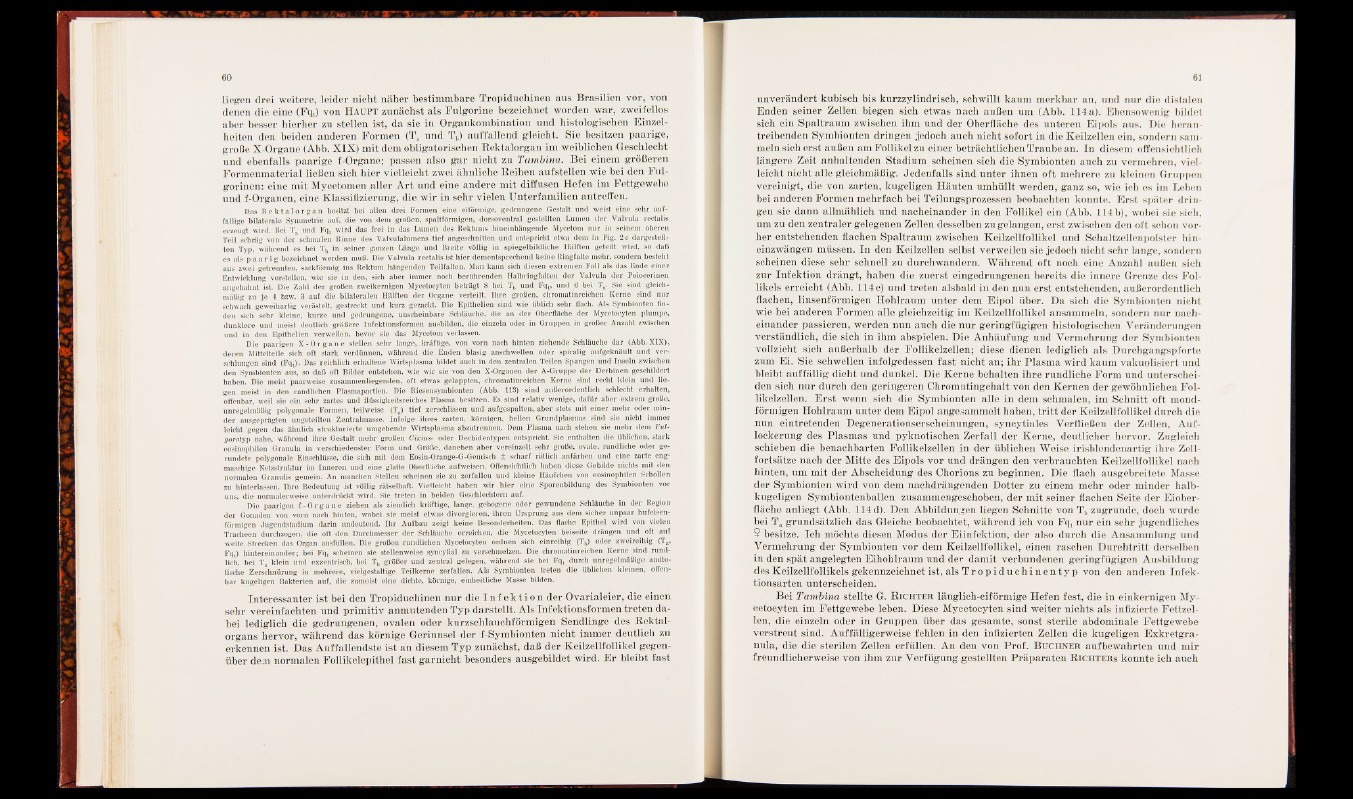
liegen drei weitere, leider nicht näher bestimmbare Tropiduchinen aus Brasilien vor, von
denen die eine (Fqt) von H a u p t zunächst als Fulgorine bezeichnet worden war, zweifellos
aber besser hierher zu stellen ist, da sie in Organkombination und histologischen Einzelheiten
den beiden anderen Formen (Ta und Tb) auffallend gleicht. Sie besitzen paarige,
große X-Organe (Abh. XIX) mit dem obligatorischen Rektalorgan im weiblichen Geschlecht
und ebenfalls paarige f-Organe; passen also gar nicht zu Tambina. Bei einem größeren
Formenmaterial ließen sich hier vielleicht zwei ähnliche Reihen aufstellen wie bei den Ful-
gorinen: eine mit Myeetomen aller Art und eine andere mit diffusen Hefen im Fettgewebe
und f-Organen, eine Klassifizierung, die wir in sehr vielen Unterfamilien antreffen.
Das R e k t a l o r g a n besitzt bei allen drei Formen eine eiförmige, gedrungene Gestalt und weist eine sehr auffällige
bilaterale Symmetrie auf, die von dem großen, spaltförmigen, dorsoventral gestellten Lumen der Valvula rectalis
erzeugt wird. Bei Ta und Fqt wird das frei in das Lumen des Rektums hineinhängende Mycetom nur in seinem oberen
Teil schräg von der schmalen Rinne des Valvulalumens tief angeschnitten und entspricht etwa dem in Fig. 2 c dargestellten
Typ, während es bei Tb in seiner ganzen Länge und Breite völlig in spiegelbildliche Hälften geteilt wird, so daß
es als p a a r i g bezeichnet werden muß. Die Valvula rectalis ist h ier dementsprechend keine Ringfalte mehr, sondern besteht
aus zwei getrennten, sackförmig ins Rektum hängenden Teilfalten. Man kann sich diesen extremen Fall als das Ende einer
Entwicklung vorstellen, wie sie in den, sich aber immer noch berührenden Halbringfalten der Valvula der Poiocerinen
angebahnt ist. Die Zahl der großen zweikernigen Mycetocyten beträgt 8 bei Tb und Fqt, und 6 bei Ta. Sie sind gleichmäßig
zu je 4 bzw. 3 auf die bilateralen Hälften der Organe verteilt. Ihre großen, chromatinreichen Kerne sind nur
schwach geweihartig verästelt, gestreckt und kurz gezackt. Die Epithelien sind wie üblich sehr flach. Als Symbionten finden
sich sehr kleine, kurze und gedrungene, unscheinbare Schläuche, die an der Oberfläche der Mycetocyten plumpe,
dunklere und meist deutlich größere Infektionsformen ausbilden, die einzeln oder in Gruppen in großer Anzahl zwischen
und in den Epithelien verweilen, bevor sie das Mycetom verlassen.
Die paarigen X- O r g a n e stellen sehr lange, kräftige, von vorn nach hinten ziehende Schläuche dar (Abb.XIX),
deren Mittelteile sich oft stark verdünnen, während die Enden blasig anschwellen oder spiralig aufgeknäult und verschlungen
sind (Fqt). Das reichlich erhaltene Wirtsplasma bildet auch in den zentralen Teilen Spangen und Inseln zwischen
den Symbionten aus, so daß oft Bilder entstehen, wie wir sie von den X-Organen der A-Gruppe der Derbinen geschildert
haben. Die meist paarweise zusammenliegenden, oft etwas gelappten, chromatinreichen Kerne sind recht klein und liegen
meist in den randlichen Plasmapartien. Die Riesensymbionten (Abb. 113) sind außerordentlich schlecht erhalten,
offenbar, weil sie ein sehr zartes und flüssigkeitsreiches Plasma besitzen. Es sind relativ wenige, dafür aber extrem große,
unregelmäßig polygonale Formen, teilweise (Ta) tief zerschlissen und aufgespalten, aber stets mit einer mehr oder minder
ausgeprägten ungeteilten Zentralmasse. Infolge ihres zarten, körnigen, hellen Grundplasmas sind sie nicht immer
leicht gegen das ähnlich strukturierte umgebende Wirtsplasma abzutrennen. Dem Plasma nach stehen sie mehr dem Ful-
goratyp nahe, während ihre Gestalt mehr großen Cixius- oder Derbidentypen entspricht. Sie enthalten die üblichen, stark
eosinophilen Granula in verschiedenster Form und Größe, daneben aber vereinzelt sehr große, ovale, rundliche oder gerundete
polygonale Einschlüsse, die sich mit dem Eosin-Orange-G-Gemisch ± scharf rötlich anfärben und eine zarte engmaschige
Netzstruktur im Inneren und eine glatte Oberfläche aufweisen. Offensichtlich haben diese Gebilde nichts mit den
normalen Granulis gemein. An manchen Stellen scheinen sie zu zerfallen und kleine Häufchen von eosinophilen Schollen
zu hinterlassen. Ihre Bedeutung ist völlig rätselhaft. Vielleicht haben wir hier eine Sporenbildung des Symbionten vor
uns, die normalerweise unterdrückt wird. Sie treten in beiden Geschlechtern auf.
Die paarigen f -Or g a n e ziehen als ziemlich kräftige, lange, gebogene oder gewundene Schläuche in der Region
der Gonaden von vorn nach hinten, wobei sie meist etwas divergieren, ihren Ursprung aus dem sicher unpaar hufeisenförmigen
Jugendstadium darin andeutend. Ihr Aufbau zeigt keine Besonderheiten. Das flache Epithel wird von vielen
Tracheen durchzogen, die oft den Durchmesser der Schläuche erreichen, die Mycetocyten beiseite drängen und oft auf
weite Strecken das Organ ausfüllen. Die großen rundlichen Mycetocyten ordnen sich einreihig (Tb) oder zweireihig (Ta,
Fqt) hintereinander; bei Fqt scheinen sie stellenweise syncytial zu verschmelzen. Die chromatinreichen Kerne sind rundlich,
bei Ta klein und exzentrisch, bei Tb größer und zentral gelegen, während sie bei Fqt durch unregelmäßige amito-
tische Zerschnürung in mehrere, vielgestaltige Teilkerne zerfallen. Als Symbionten treten die üblichen kleinen, offenbar
kugeligen Bakterien auf, die zumeist eine dichte, körnige, einheitliche Masse bilden.
Interessanter ist bei den Tropiduchinen nur die I n f e k t i o n der Ovarialeier, die einen
sehr vereinfachten und primitiv anmutenden Typ darstellt. Als Infektionsformen treten dabei
lediglich die gedrungenen, ovalen oder kurzschlauchförmigen Sendlinge des Rektalorgans
hervor, während das körnige Gerinnsel der f-Symhionten nicht immer deutlich zu
erkennen ist. Das Auffallendste ist an diesem Typ zunächst, daß der Keilzellfollikel gegenüber
dem normalen Follikelepithel fast garnicht besonders ausgebildet wird. E r bleibt fast
unverändert kubisch bis kurzzylindrisch, schwillt kaum merkbar an, und nur die distalen
Enden seiner Zellen biegen sich etwas nach außen um (Abb. 114 a). Ebensowenig bildet
sich ein Spaltraum zwischen ihm und der Oberfläche des unteren Eipols aus. Die herantreibenden
Symbionten dringen jedoch auch nicht sofort in die Keilzellen ein, sondern sammeln
sieh erst außen am Follikel zu einer beträchtlichen Traube an. In diesem offensichtlich
längere Zeit anhaltenden Stadium scheinen sieh die Symbionten auch zu vermehren, vielleicht
nicht alle gleichmäßig. Jedenfalls sind.unter ihnen oft mehrere zu kleinen Gruppen
vereinigt, die von zarten, kugeligen Häuten umhüllt werden, ganz so, wie ich es im Beben
bei anderen Formen mehrfach bei Teilungsprozessen beobachten konnte. Erst später dringen
sie dann allmählich und nacheinander in den Follikel ein (Abb. 114b), wobei sie sich,
um zu den zentraler gelegenen Zellen desselben zu gelangen, erst zwischen den oft schon vorher
entstehenden flachen Spaltraum zwischen Keilzellfollikel und Schaltzellenpolster hineinzwängen
müssen. In den Keilzellen selbst verweilen sie jedoch nicht sehr lange, sondern
scheinen diese sehr schnell zu durchwandern. Während oft noch eine Anzahl außen sich
zur Infektion drängt, haben die zuerst eingedrungenen bereits die innere Grenze des Follikels
erreicht (Abb. 114 c) und treten alsbald in den nun erst entstehenden, außerordentlich
flachen, linsenförmigen Hohlraum unter dem Eipol über. Da sich die Symbionten nicht
wie bei anderen Formen alle gleichzeitig im Keilzellfollikel ansammeln, sondern nur nacheinander
passieren, werden nun auch die nur geringfügigen histologischen Veränderungen
verständlich, die sich in ihm abspielen. Die Anhäufung und Vermehrung der Symbionten
vollzieht sich außerhalb der Follikelzellen; diese dienen lediglich als Durchgangspforte
zum Ei. Sie schwellen infolgedessen fast nicht an; ihr Plasma wird kaum vakuolisiert und
bleibt auffällig dicht und dunkel. Die Kerne behalten ihre rundliche Form und unterscheiden
sich nur durch den geringeren Chromatingehalt von den Kernen der gewöhnlichen Follikelzellen.
E rst wenn sich die Symbionten alle in dem schmalen, im Schnitt oft mondförmigen
Hohlraum unter dem Eipol angesammelt haben, tritt der Keilzellfollikel durch die
nun eintretenden Degenerationserscheinungen, syneytiales Verfließen der Zellen, Auflockerung
des Plasmas und pyknotischen Zerfall der Kerne, deutlicher hervor. Zugleich
schieben die benachbarten Follikelzellen in der üblichen Weise irisblendenartig ihre Zellfortsätze
nach der Mitte des Eipols vor und drängen den verbrauchten Keilzellfollikel nach
hinten, um mit der Abscheidung des Chorions zu beginnen. Die flach ausgebreitete Masse
der Symbionten wird von dem nachdrängenden Dotter zu einem mehr oder minder halbkugeligen
Symbiontenballen zusammengeschoben, der mit seiner flachen Seite der Eioberfläche
anliegt (Abb. 114 d). Den Abbildungen liegen Schnitte von Tb zugrunde, doch wurde
bei T, grundsätzlich das Gleiche beobachtet, während ich von Fq, nur ein sehr jugendliches
2 besitze. Ich möchte diesen Modus der Eiinfektion, der also durch die Ansammlung und
Vermehrung der Symbionten vor dem Keilzellfollikel, einen raschen Durchtritt derselben
in den spät angelegten Eihohlraum und der damit verbundenen geringfügigen Ausbildung
des Keilzellfollikels gekennzeichnet ist, als T r o p i d u c h i n e n t y p von den anderen Infektionsarten
unterscheiden.
Bei Tambina stellte G. R ic h t e r länglich-eiförmige Hefen fest, die in einkernigen My-
eetocyten im Fettgewebe leben. Diese Mycetocyten sind weiter nichts als infizierte Fettzellen,
die einzeln oder in Gruppen über das gesamte, sonst sterile abdominale Fettgewebe
verstreut sind. Auffälligerweise fehlen in den infizierten Zellen die kugeligen Exkretgra-
nula, die die sterilen Zellen erfüllen. An den von Prof. BÜCHNER aufbewahrten und mir
freundlicherweise von ihm zur Verfügung gestellten Präparaten R ic h t e r s konnte ich auch