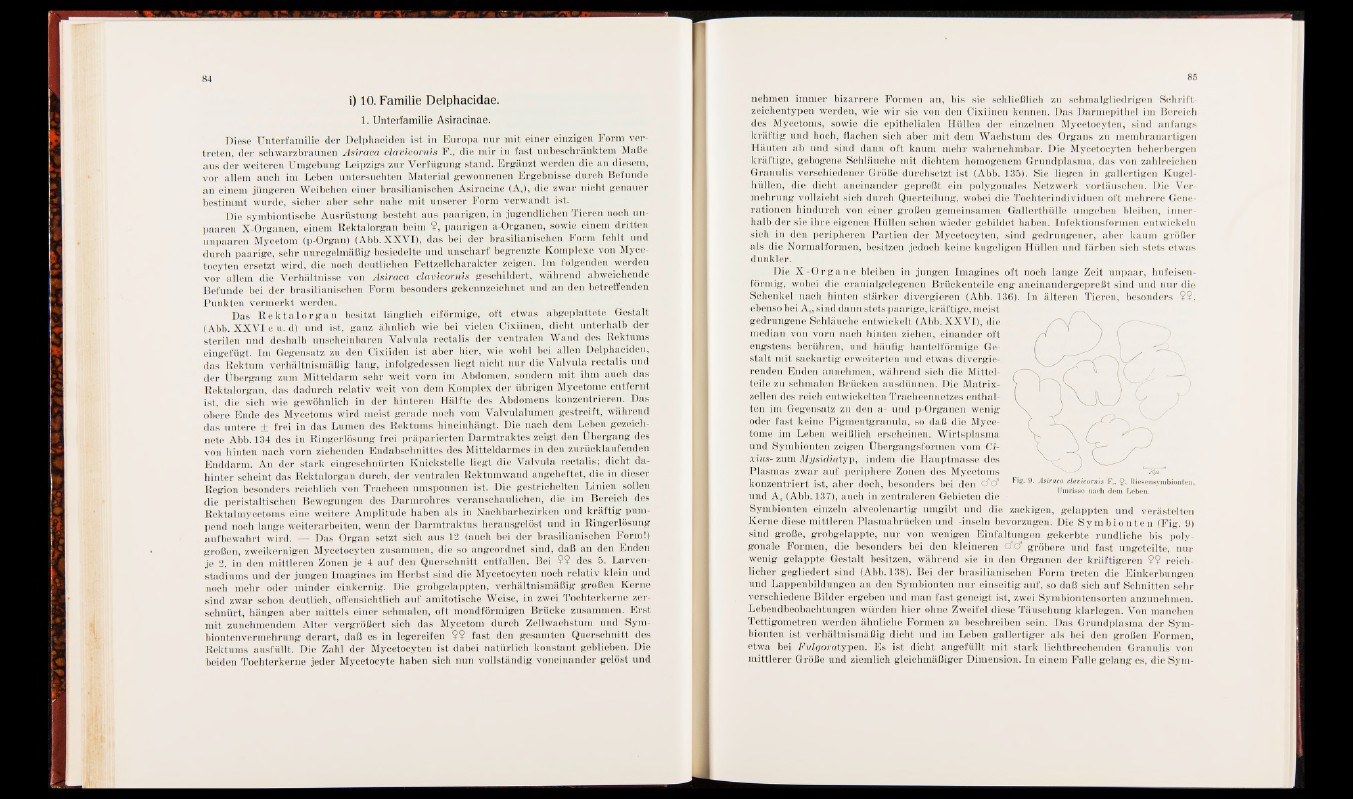
i) 10. Familie Delphacidae.
1. Unterfamilie Asiracinae.
Diese Unterfamilie der Delphaeiden ist in Europa nur mit einer einzigen Form vertreten,
der schwarzbraunen Asiraca clavicornis F., die mir in fast unbeschränktem Maße
aus der weiteren Umgebung Leipzigs zur Verfügung stand. Ergänzt werden die an diesem,
vor allem auch im Leben untersuchten Material gewonnenen Ergebnisse durch Befunde
an einem jüngeren Weibchen einer brasilianischen Asiracine (As), die zwar nicht genauer
bestimmt wurde, sicher aber sehr nahe mit unserer Form verwandt ist.
Die symbiontische Ausrüstung besteht ans paarigen, in jugendlichen Tieren noch un-
paaren X-Organen, einem Rektalorgan beim ?, paarigen a-Organen, sowie einem dritten
unpaaren Mycetom (p-Organ) (Abb. XXVI), das bei der brasilianischen Form fehlt und
durch paarige, sehr unregelmäßig besiedelte und unscharf begrenzte Komplexe von Myee-
tocyten ersetzt wird, die noch deutlichen Fettzellcharakter zeigen. Im folgenden werden
vor allem die Verhältnisse von Asiraca clavicornis geschildert, während abweichende
Befunde bei der brasilianischen Form besonders gekennzeichnet und an den betreffenden
Punkten vermerkt werden.
Das R e k t a l o r g a n besitzt länglich eiförmige, oft etwas abgeplattete Gestalt
(Abb. XXVI c u. d) und ist, ganz ähnlich wie bei vielen Cixiinen, dicht unterhalb der
sterilen und deshalb unscheinbaren Valvula rectalis der ventralen Wand des Rektums
eingefügt. Im Gegensatz zu den Cixiiden ist aber hier, wie wohl bei allen Delphaeiden,
das Rektum verhältnismäßig lang, infolgedessen liegt nicht nur die Valvula rectalis und
der Übergang zum Mitteldarm sehr weit vorn im Abdomen, sondern mit ihm auch das
Rektalorgan, das dadurch relativ weit von dem Komplex der übrigen Mycetome entfernt
ist, die sich wie gewöhnlich in der hinteren Hälfte des Abdomens konzentrieren. Das
obere Ende des Mycetoms wird meist gerade noch vom Valvulalumen gestreift, während
das untere + frei in das Lumen des Rektums hineinhängt. Die nach dem Leben gezeichnete
Abb. 134 des in Ringerlösung frei präparierten Darmtraktes zeigt den Übergang des
von hinten nach vorn ziehenden Endabschnittes des Mitteldarmes in den zurücklaufenden
Enddarm. An der stark eingeschnürten Knickstelle liegt die Valvula rectalis; dicht dahinter
scheint das Rektalorgan durch, der ventralen Rektumwand angeheftet, die in dieser
Region besonders reichlich von Tracheen umsponnen ist. Die gestrichelten Linien sollen
die peristaltischen Bewegungen des Darmrohres veranschaulichen, die im Bereich des
Rektalmycetoms eine weitere Amplitude haben als in Nachbar bezirken und kräftig pumpend
noch lange Weiterarbeiten, wenn der Darmtraktus herausgelöst und in Ringerlösung
aufbewahrt wird. — Das Organ setzt sich aus 12 (auch bei der brasilianischen Form!)
großen, zweikernigen Mycetocyten zusammen, die so angeordnet sind, daß an den Enden
je 2, in den mittleren Zonen je 4 auf den Querschnitt entfallen. Bei 99 des 5. Larvenstadiums
und der jungen Imagines im Herbst sind die Mycetocyten noch relativ klein und
noch mehr oder minder einkernig. Die grobgelappten, verhältnismäßig großen Kerne
sind zwar schon deutlich, offensichtlich auf amitotische Weise, in zwei Tochterkerne zer-
schniirt, hängen aber mittels einer schmalen, oft mondförmigen Brücke zusammen. Erst
mit zunehmendem Alter vergrößert sich das Mycetom durch Zellwachstum und Sym-
biontenvermehrung derart, daß es in legereifen 9? fast den gesamten Querschnitt des
Rektums ausfüllt. Die Zahl der Mycetocyten ist dabei natürlich konstant geblieben. Die
beiden Tochterkerne jeder Mycetocyte haben sich nun vollständig voneinander gelöst und
nehmen immer bizarrere Formen an, bis sie schließlich zu schmalgliedrigen Schriftzeichentypen
werden, wie wir sie von den Cixiinen kennen. Das Darmepithel im Bereich
des Mycetoms, sowie die epithelialen Hüllen der einzelnen Mycetocyten, sind anfangs
kräftig und hoch, flachen sich aber mit dem Wachstum des Organs zu membranartigen
Häuten ab und sind dann oft kaum mehr wahrnehmbar. Die Mycetocyten beherbergen
kräftige, gebogene Schläuche mit dichtem homogenem Grundplasma, das von zahlreichen
Granulis verschiedener Größe durchsetzt ist (Abb. 135). Sie liegen in gallertigen Kugelhüllen,
die dicht aneinander gepreßt ein polygonales Netzwerk vortäuschen. Die Vermehrung
vollzieht sich durch Querteilung, wobei die Tochterindividuen oft mehrere Generationen
hindurch von einer großen gemeinsamen Gallerthülle umgeben bleiben, innerhalb
der sie ihre eigenen Hüllen schon wieder gebildet haben. Infektionsformen entwickeln
sich in den peripheren Partien der Mycetocyten, sind gedrungener, aber kaum größer
als die Normalformen, besitzen jedoch keine kugeligen Hüllen und färben sich stets etwas
dunkler.
Die X -Or g a n e bleiben in jungen Imagines oft noch lange Zeit unpaar, hufeisenförmig,
wobei die cranialgelegenen Brückenteile eng aneinandergepreßt sind und nur die
Schenkel nach hinten stärker divergieren (Abb. 136). In älteren Tieren, besonders 99,
ebenso bei As, sind dann stets paarige, kräftige, meist
gedrungene Schläuche entwickelt (Abb. XXVI), die
median von vorn nach hinten ziehen, einander oft
engstens berühren, und häufig hantelförmige Gestalt
mit sackartig erweiterten und etwas divergierenden
Enden annehmen, während sich die Mittelteile
zu schmalen Brücken ausdünnen. Die Matrixzellen
des reich entwickelten Tracheennetzes enthalten
im Gegensatz zu den a- und p-Organen wenig
oder fast keine Pigmentgranula, so daß die Mycetome
im Leben weißlich erscheinen. Wirtsplasma
und Symbionten zeigen Übergangsformen vom Ci-
xius- zum Mysidiatyj), indem die Hauptmasse des
Plasmas zwar auf periphere Zonen des Mycetoms
konzentriert ist, aber doch, besonders bei den cf Cf Fig‘ 9< Asiraca clavicornis f., $, Riesensymbionten,
und As (Abb. 137), auch in zentraleren Gebieten die
Symbionten einzeln alveolenartig umgibt und die zackigen, gelappten und verästelten
Kerne diese mittleren Plasmabrücken und -insein bevorzugen. Die S ymb i o n t e n (Fig. 9)
sind große, grobgelappte, nur von wenigen Einfaltungen gekerbte rundliche bis polygonale
Formen, die besonders bei den kleineren Cf cf gröbere und fast ungeteilte, nur
wenig gelappte Gestalt besitzen, während sie in den Organen der kräftigeren 99 reichlicher
gegliedert sind (Abb. 138). Bei der brasilianischen Form treten die Einkerbungen
und Lappenbildungen an den Symbionten nur einseitig auf, so daß sich auf Schnitten sehr
verschiedene Bilder ergeben und man fast geneigt ist, zwei Symbiontensorten anzunehmen.
Lebendbeobachtungen würden hier ohne Zweifel diese Täuschung klarlegen. Von manchen
Tettigometren werden ähnliche Formen zu beschreiben sein. Das Grundplasma der Symbionten
ist verhältnismäßig dicht und im Leben gallertiger als bei den großen Formen,
etwa bei Fulgoratypen. Es ist dicht angefüllt mit stark lichtbrechenden Granulis von
mittlerer Größe und ziemlich gleichmäßiger Dimension. In einem Falle gelang es, die Sym