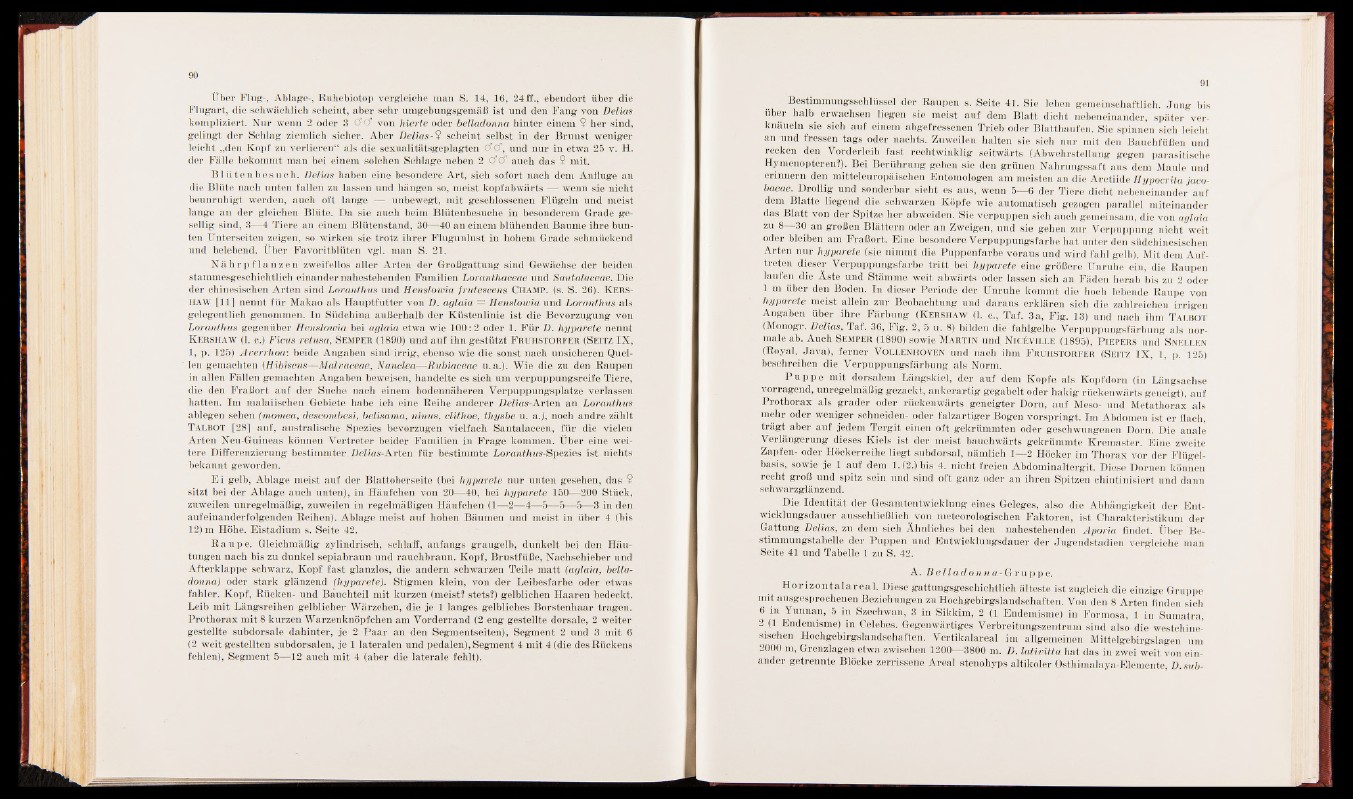
Über Flug-, Ablage-, Ruhebiotop vergleiche man S. 14, 16, 24 ff., ebendort über die
Flugart, die schwächlich scheint, aber sehr umgebungsgemäß ist und den Fang von Delias
kompliziert. Nur wenn 2 oder 3 cf cf von hierte oder belladonna hinter einem $ her sind,
gelingt der Schlag ziemlich sicher. Aber Delias -2 scheint selbst in der Brunst weniger
leicht „den Kopf zu verlieren“ als die sexualitätsgeplagten cf cf, und nur in etwa 25 v. H.
der Fälle bekommt man bei einem solchen Schlage neben 2 Cf cf auch das 2 mit.
B l ü t e n b e s u c h . Delias haben eine besondere Art, sich sofort nach dem Anfluge an
die Blüte nach unten fallen zu lassen und hängen so, meist kopfabwärts — wenn sie nicht
beunruhigt werden, auch oft lange :— unbewegt, mit geschlossenen Flügeln und meist
lange an der gleichen Blüte. Da sie auch beim Blütenbesuche in besonderem Grade gesellig
sind, 3—4 Tiere an einem Blütenstand, 30—40 an einem blühenden Baume ihre bunten
Unterseiten zeigen, so wirken sie trotz ihrer Flugunlust in hohem Grade schmückend
und belebend. Über Favoritblüten vgl. man S. 21.
N ä h r p f l a n z e n zweifellös aller Arten der Großgattung sind Gewächse der beiden
stammesgeschichtlich einander nahestehenden Familien Loranthaceae und Santalaceae. Die
der chinesischen Arten sind Loranthus und Henslowia frutescens Ch am p . (s. S. 26). K er s -
h aw [11] nennt fü r Makao als Hauptfutter von D. aglaia SH enslowia und Loranthus als
gelegentlich genommen. In Südchina außerhalb der Küstenlinie ist die Bevorzugung von
Loranthus gegenüber Henslowia bei aglaia etwa wie 100: 2 oder 1. F ü r D. hyparete nennt
K e r sh aw (1. c.) Ficus retusa, Sem p er (1890) und auf ihn gestützt F r u h s t o r f e r (Seit z IX,
1, p. 125) Averrhoa: beide Angaben sind irrig, ebenso wie die sonst nach unsicheren Quellen
gemachten (Hibiscus—Malvaceae, Nauclea.—Rubiaceae u.a.). Wie die zu den Raupen
in allen Fällen gemachten Angaben beweisen, handelte es sich um verpuppungsreife Tiere,
die den Fraßort auf der Suche nach einem bodennäheren Verpuppungsplatze verlassen
hatten. Im malaiischen Gebiete habe ich eine Reihe anderer Delias-Arten an Loranthus
ablegen sehen (momea, descombesi, belisama, ninus, clithoe, thysbe u. a.j, noch andre zählt
T albot [28] auf, australische Spezies bevorzugen vielfach Santalaceen, für die vielen
Arten Neu-Guineas können Vertreter beider Familien in Frage kommen. Über eine weitere
Differenzierung bestimmter DeWas-Arten für bestimmte Loranthus-Spezies ist nichts
bekannt geworden.
E i gelb, Ablage meist auf der Blattoberseite (bei hyparete nur unten gesehen, das 2
sitzt bei der Ablage auch unten), in Häufchen von 20—40, bei hyparete 150—200 Stück,
zuweilen unregelmäßig, zuweilen in regelmäßigen Häufchen (LWZ—4—5—5—5—3 in den
aufeinanderfolgenden Reihen). Ablage meist auf hohen Bäumen und meist in über 4 (bis
12) m Höhe. Eistadium s. Seite 42.
Ra up e . Gleichmäßig zylindrisch, schlaff, anfangs graugelb, dunkelt bei den Häutungen
nach bis zu dunkel sepiabraun und rauchbraun. Kopf, Brustfüße, Nachschieber und
Afterklappe schwarz, Kopf fast glanzlos, die ändern schwarzen Teile matt (aglaia, belladonna)
oder stark glänzend (hyparete). Stigmen klein, von der Leibesfarbe oder etwas
fahler. Kopf, Rücken- und Bauchteil mit kurzen (meist1? stets?) gelblichen Haaren bedeckt.
Leib mit Längsreihen gelblicher Wärzchen, die je 1 langes gelbliches Borstenhaar tragen.
Prothorax mit 8 kurzen Warzenknöpfchen am Vorderrand (2 eng gestellte dorsale, 2 weiter
gestellte subdorsale dahinter, je 2 P a a r an den Segmentseiten), Segment 2 und 3 mit 6
(2 weit gestellten subdorsalen, je 1 lateralen und pedalen), Segment 4 mit 4 (die des Rückens
fehlen), Segment 5—12 auch mit 4 (aber die laterale fehlt).
Bestimmungsschlüssel der Raupen s. Seite 41. Sie leben gemeinschaftlich. Ju n g bis
über halb erwachsen liegen sie meist auf dem Blatt dicht nebeneinander, später ver-
knäueln sie sich auf einem abgefressenen Trieb oder Blatthaufen. Sie spinnen sich leicht
an und fressen tags oder nachts. Zuweilen halten sie sieh nur mit den Bauchfüßen und
recken den Vorderleib fast rechtwinklig seitwärts (Abwehrstellung gegen parasitische
Hymenopteren?). Bei Berührung geben sie den grünen Nahrungssaft aus dem Maule und
erinnern den mitteleuropäischen Entomologen am meisten an die Aretiide Hypocrita jaco-
baeae. Drollig und sonderbar sieht ¡e| aus, wenn 5—6 der Tiere dicht nebeneinander auf
dem Blatte liegend die schwarzen Köpfe wie automatisch gezogen parallel miteinander
das Blatt von der Spitze her abweiden. Sie verpuppen sich auch gemeinsam, die von aglaia
zu 8—30 an großen Blättern oder an Zweigen, und sie gehen zur Verpuppung nicht weit
oder bleiben am Fraßort. Eine besondere Verpuppungsfarbe h at unter den südchinesischen
Arten nur hyparete (sie nimmt die Puppenfarbe voraus und wird fahl gelb). Mit dem Auftreten
diesep; Verpuppungsfarbe tritt bei hyparete eine größere Unruhe ein, die Raupen
laufen die Äsjjpund Stämme, weit .abwärts öder lassen sich an Fäden herab bis zu 2 oder
1 m über den Boden. In dieser Periode der Unruhe -kommt die hoch lebende Raupe von
hyparete meist allein zur Beobachtung und daraus erklären sieh die zahlreichen irrigen
Angaben über ihre Färbung ( K e r s h a w (1. ■%, Taf. 3 a, Fig. 13) und nach ihm T a l b o t
(Monogr. Delias, Taf. 36, Fig. 2, 5 u. 8) bilden die fahlgelbe Verpuppungsfärbung als normale
ab. Auch S e m p e r (1890) sowie M a r t in und. N i c e v i l l e (1895), P i e p e r s und S n e l l e n
(Royal. Java), -ferner V o l l e n h o v e n und nach ihm F r u h s t o r f e r ( S e it z IX, 1, p. 125)
beschreiben die Verpuppungsfärbung als Norm.
P u p p e mit dorsalem Längskiel, der auf dem Kopfe als Kopfdorn (in Längsachse
vorragend, unregelmäßig gezackt, ankerartig gegabelt oder hakig rüekenwärts geneigt), auf
Prothorax als grader oder rüekenwärts geneigter Dorn, auf Meso- und Metathorax als
mehr oder weniger schneiden- oder falzartiger Bogen vorspringt. Im Abdomen ist er flach,
trägt, aber auf jedem Tergit einen öftjgekrümmten oder geschwungenen Dorn. Die anale
Verlängerung dieses Kiejs ist der meist bauchwärts gekrümmte Kremaster. Eine zweite
Zapfen oder Höckerreihe liegt subdorsal, nämlich 1 - S Höcker im Thorax vor der Flügelbasis,
sowie je 1 auf dem l.,(;2.) bis 4. nicht freien Abdominaltergit. Diese Dornen können
recht groß und spitz sein und sind oft ganz oder an ihren Spitzen chintinisiert und dann
sehwarzglänzend.
Die Identität der Gesamtentwicklung eines Geleges, also die Abhängigkeit der Entwicklungsdauer
ausschließlich von meteorologischen Faktoren, ist Charakteristikum der
Gattung Delias, zu dem sich Ähnliches bei den nahestehenden Aporia findet. Über 'Bestimmungstabelle
der Puppen und Entwicklungsdauer der Jugendstadien vergleiche man
Seite 41 und Tabelle 1 zu S. 42.
K. B e l l ad o n n a -Gr uppe .
Hor i zont a l a r e a l . Diese gattungsgeschichtlieh älteste ist zugleich die einzige Gruppe
mit ausgesprochenen Beziehungen zu Hochgebirgslandschaften. Von den 8 Arten finden sich
6 in Yunnan, 5 in Szechwan, 3 in Sikkim, 2 (1 Endemisme) in' Formosa, 1 in Sumatra,
2 (1 Endemisme) in Celebes. Gegenwärtiges Verbreitungszentrum sind also die westchinesischen
Hochgebirgslandschaften. Vertikalareal im allgemeinen Mittelgebirgslagen um
2000 m, Grenzlagen etwa zwischen 1200—3800 m. D. lativitta hat das in zwei weit von einander
getrennte Blöcke zerrissene Areal stenöhyps altikoler Osthimalaya-Elemente, ü . svb