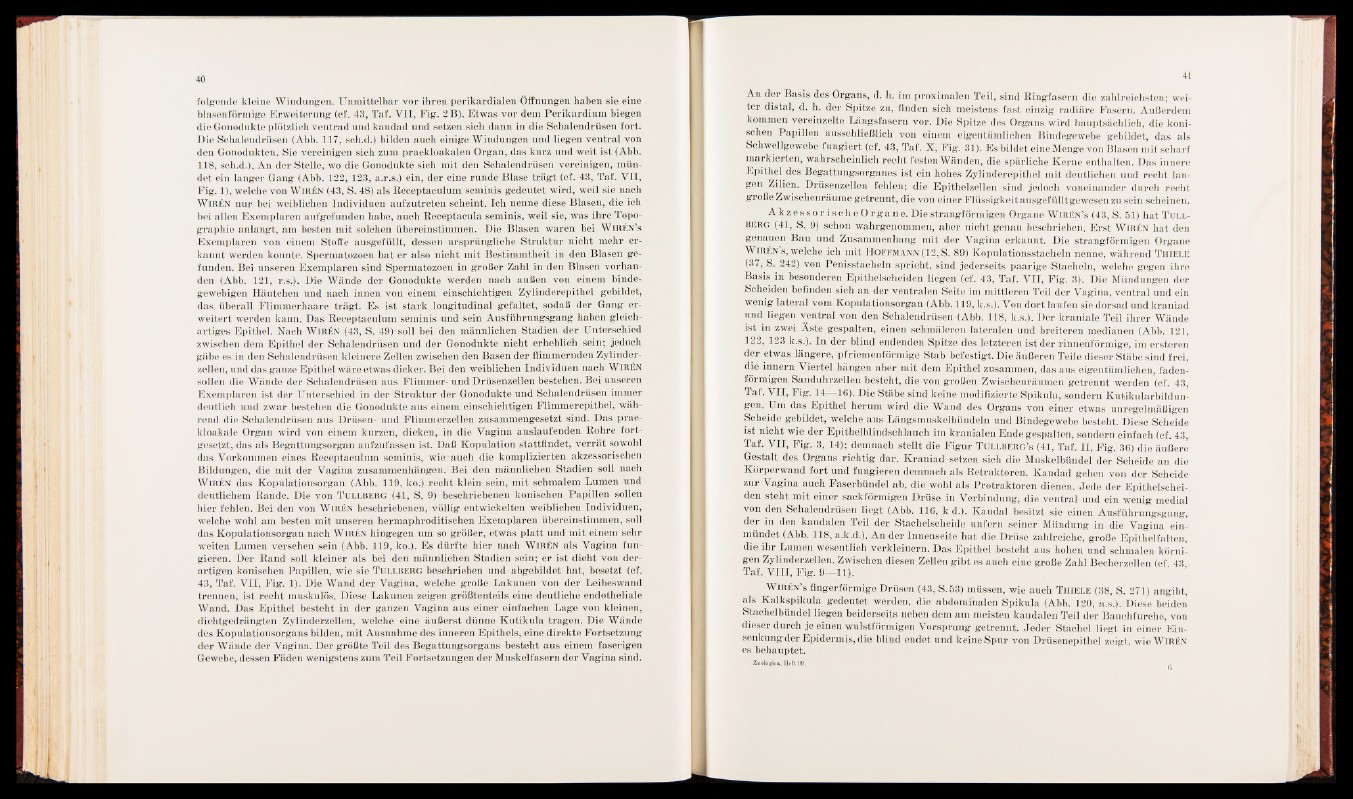
folgende kleine Windungen. Unmittelbar vor ihren perikardialen Öffnungen haben sie eine
blasenförmige Erweiterung (cf. 43, Taf. VII, Fig. 2B). Etwas vor dem Perikardium biegen
die Gonodukte plötzlich ventrad und kaudad und setzen sich dann in die Schalendrüsen fort.
Die Schalendrüsen (Abb. 117, sch.d.) bilden auch einige W indungen und liegen ventral von
den Gonodukten. Sie vereinigen sich zum praekloakalen Organ, das kurz und weit ist (Abb.
118, sch.d.). An der Stelle, wo die Gonodukte sich mit den Schalendrüsen vereinigen, mündet
ein langer Gang (Abb. 122, 123, a.r.s.) ein, der eine runde Blase träg t (cf. 43, Taf. VII,
Fig. 1), welche von W i r £ n (43, S. 48) als Receptaculum seminis gedeutet wird, weil sie nach
W i r e n nur bei weiblichen Individuen aufzutreten scheint. Ich nenne diese Blasen, die ich
bei allen Exemplaren aufgefunden habe, auch Receptacula seminis, weil sie, was ihre Topographie
anlangt, am besten mit solchen übereinstimmen. Die Blasen waren bei W i r e n ’s
Exemplaren von einem Stoffe ausgefüllt, dessen ursprüngliche Struktur nicht mehr erkannt
werden konnte. Spermatozoen ha t er also nicht mit Bestimmtheit in den Blasen gefunden.
Bei unseren Exemplaren sind Spermatozoen in großer Zahl in den Blasen vorhanden
(Abb. 121, r.s.). Die Wände der Gonodukte werden nach außen von einem bindegewebigen
Häutchen und nach innen von einem einschichtigen Zylinderepithel gebildet,
das überall Flimmerhaare trägt. Es ist stark longitudinal gefaltet, sodaß der Gang erweitert
werden kann. Das Receptaculum seminis und sein Ausführungsgang haben gleichartiges
Epithel. Nach W i r e n (43, S. 49) soll bei den männlichen Stadien der Unterschied
zwischen dem Epithel der Schalendrüsen und der Gonodukte nicht erheblich sein; jedoch
gäbe es. in den Schalendrüsen kleinere Zellen zwischen den Basen der flimmernden Zylinderzellen,
und das ganze Epithel wäre etwas dicker. Bei den weiblichen Individuen nach W i r e n
sollen die Wände der Schalendrüsen aus F lim m e r -und Drüsenzellen bestehen. Bei unseren
Exemplaren ist der Unterschied in der Struktur der Gonodukte und Schalendrüsen immer
deutlich und zwar bestehen die Gonodukte aus einem einschichtigen Flimmerepithel, während
die Schalendrüsen aus Drüsen- und Flimmerzellen zusammengesetzt sind. Das prae-
kloakale Organ wird von einem kurzen, dicken, in die Vagina auslaufenden Rohre fortgesetzt,
das als Begattungsorgan aufzufassen ist. Daß Kopulation stattfindet, v e rrä t sowohl
das Vorkommen eines Receptaculum seminis, wie auch die komplizierten akzessorischen
Bildungen, die mit der Vagina Zusammenhängen. Bei den männlichen Stadien soll nach
W i r e n das Kopulationsorgan (Abb. 119, ko.) recht klein sein, mit schmalem Lumen und
deutlichem Rande. Die von T u l l b e r g (41, S. 9) beschriebenen konischen Papillen sollen
hier fehlen. Bei den von W i r e n beschriebenen, völlig entwickelten weiblichen Individuen,
welche wohl am besten mit unseren hermaphroditischen Exemplaren übereinstimmen, soll
das Kopulationsorgan nach W i r e n hingegen um so größer, etwas p latt und mit einem sehr
weiten Lumen versehen sein (Abb. 119, ko.). Es dürfte hier nach W i r £ n als Vagina fungieren.
Der Rand soll kleiner als bei den männlichen Stadien sein; er ist dicht von derartigen
konischen Papillen, wie sie T u l l b e r g beschrieben und ahgebildet hat, besetzt (cf.
43, Taf. VII, Fig. 1). Die Wand der Vagina, welche große Lakunen von der Leiheswand
trennen, ist recht muskulös. Diese Lakunen zeigen größtenteils eine deutliche endotheliale
Wand. Das Epithel besteht in der ganzen Vagina aus einer einfachen Lage von kleinen,
dichtgedrängten Zylinderzellen, welche eine äußerst dünne Kutikula tragen. Die Wände
des Kopulationsorgans bilden, mit Ausnahme des inneren Epithels, eine direkte Fortsetzung
der Wände der Vagina. Der größte Teil des Begattungsorgans besteht aus einem faserigen
Gewebe, dessen Fäden wenigstens zum Teil Fortsetzungen der Muskelfasern der Vagina sind.
An der Basis des Organs, d. h. im proximalen Teil, sind Ringfasern die zahlreichsten; weiter
distal, d. h. der Spitze zu, finden sich meistens fast einzig radiäre Fasern. Außerdem
kommen vereinzelte Längsfasern vor. Die Spitze des Organs wird hauptsächlich, die konischen
Papillen ausschließlich von einem eigentümlichen Bindegewebe gebildet, das als
Schwellgewebe fungiert (cf. 43, Taf. X, Fig. 31). Es bildet eine Menge von Blasen m it scharf
markierten, wahrscheinlich recht festen Wänden, die spärliche Kerne enthalten. Das innere
Epithel des Begattungsorganes ist ein hohes Zylinderepithel mit deutlichen und recht langen
Zilien. Drüsenzellen fehlen; die Epithelzellen sind jedoch voneinander durch recht
große Zwischenräume getrennt, die von einer Flüssigkeit ausgefüllt gewesen zu sein scheinen.
A k z e s s o r i s c h eO r g a n e . Diestrangförmigen Organe W ik k n ’s (43, S. 51) h a t Tuix-
BERG (41, S. 9) schon wahrgenommen, aber nicht genau beschrieben. Erst W i r e n hat den
genauen Bau und Zusammenhang mit der Vagina erkannt. Die strangförmigen Organe
W i r e n s, welche ich mit H o f fm a n n (12, S. 89) Kopulationsstacheln nenne, während T h i e l e
(37, S. 242) von Penisstacheln spricht, sind jederseits paarige Stacheln, welche gegen ihre-
Basis in besonderen Epithelscheiden liegen (cf. 43, Taf. VII, Fig. 3). Die Mündungen der
Scheiden befinden sich an der ventralen Seite im mittleren Teil der Vagina, ventral und ein
wenig lateral vom Kopulationsorgan (Abb. 119, k.s.). Von dort laufen sie dorsad und kraniad
und liegen ventral von den Sehalendrüsjm (Abb. 118, k.s,). Der kraniale Teil ihrer Wände
ist in zwei Äste gespalten, einen schmäleren lateralen und breiteren medianen (Abb. 121,
122, 123 k.s.). In der blind endenden Spitze des letzteren ist der rinnenförmige, im ersteren
der etwas längere, pfriemenförmige Stab befestigt. Die äußeren Teile dieser Stäbe sind frei,
die innern Viertel hängen aber mit dem Epithel zusammen, das aus eigentümlichen, fadenförmigen
Sanduhrzellen besteht, die von großen Zwischenräumen getrennt werden (cf. 43,
Taf. VII, Fig. 14|Sl6). Die Stäbe sind keine modifizierte Spikula, sondern Kutikularbildun-
gen. Um das Epithel herum wird die Wand des Organs von einer etwas unregelmäßigen
Scheide gebildet, welche aus Längsmuskelbündeln und Bindegewebe besteht. Diese Scheide
ist nicht wie der Epithelblindschlauch im kranialen Ende gespalten, sondern einfach (cf. 43,
Taf. VII, Fig. 3, 14); demnach stellt die Figur T u l l b e r g ’s (41, Taf. II, Fig. 36) die äußere
Gestalt des Organs richtig dar. Kraniad setzen sich die Muskelbündel der Scheide an die
Körperwand fort und fungieren demnach als Ketraktoren. Kaudad gehen von der Scheide
zur Vagina auch Faserbündel ab, die wohl als Protraktoren dienen. Jede der Epithelsehei--,
den steht mit einer sackförmigen Drüse in Verbindung, die ventral und ein wenig medial
von den Schalendrüsen liegt (Abb. 116, k d.). Kaudal besitzt sie einen Ausführungsgang,
der in den kaudalen Teil der Stachelscheide unfern seiner Mündung in die Vagina einmündet
(Abb. 118, a.k.d.). A 11 der Innenseite hat die Drüse zahlreiche, große Epithelfalten,,
die ih r Lumen wesentlich verkleinern. Das Epithel besteht aus hohen und schmalen körnigen
Zylinderzellen. Zwischen diesen Zellen gibt es auch eine große Zahl Becherzellen (cf 43
Taf. VIII, Fig. 9—11).
W i r e n ’s fingerförmige Drüsen (43, S. 53) müssen, wie auch T h i e l e (38, S. 271) angibt,:
als Kalkspikula gedeutet werden, die abdominalen Spikula (Abb. 120, a.s.). Diese beiden
Stachelbündel liegen beiderseits neben dem am meisten kaudalen Teil der Bauchfurche, von
dieser durch je einen wulstförmigen Vorsprung getrennt. Jeder Stachel liegt in einer Einsenkung
der Epidermis, die blind endet und keine Spur von Drüsenepithel zeigt, wie WlRfiN
es behauptet.