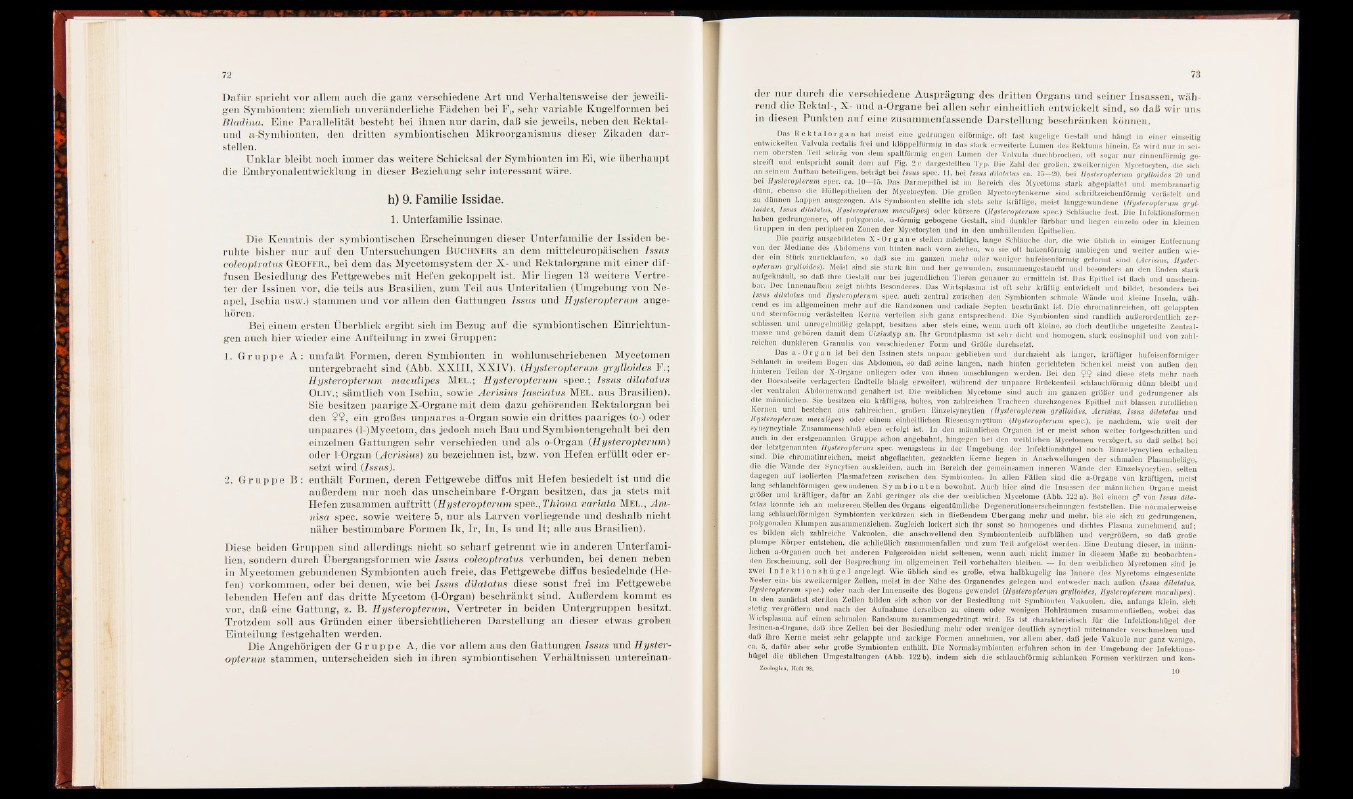
72
Dafür spricht vor allem auch die ganz verschiedene Art und Verhaltensweise der jeweiligen
Symbionten: ziemlich unveränderliche Fädchen bei F i? sehr variable Kugelformen bei
Bladina. Eine Parallelität besteht bei ihnen nur darin, daß sie jeweils, neben den Rektal-
und a-Symbionten, den dritten symbiontischen Mikroorganismus dieser Zikaden da rstellen.
Unklar bleibt noch immer das weitere Schicksal der Symbionten im Ei, wie überhaupt
die Embryonalentwicklung in dieser Beziehung sehr interessant wäre.
h) 9. Familie Issidae.
1. Unterfamilie Issinae.
Die Kenntnis der symbiontischen Erscheinungen dieser TJnterfamilie der Issiden beruhte
bisher n ur auf den Untersuchungen BtTCHNERs an dem mitteleuropäischen Issus
coleoptratus G e o ffr., bei dem das Mycetomsystem der X- und Rektalorgane mit einer diffusen
Besiedlung des Fettgewebes mit Hefen gekoppelt ist. Mir liegen 13 weitere Vertreter
der Issinen vor, die teils aus Brasilien, zum Teil aus Unteritalien (Umgebung von Neapel,
Isehia usw.) stammen und vor allem den Gattungen Issus und Hysteropterum angehören
.B
ei einem ersten Überblick ergibt sich im Bezug auf die symbiontischen Einrichtungen
auch hier wieder eine Aufteilung in zwei Gruppen:
1. Gr u p p e A: umfaßt Formen, deren Symbionten in wohlumschriebenen Mycetomen
untergebracht sind (Abb. XX III, X X lV )$H y s te r o p te nm grylloides F.;
Hysteropterum maculipes Me l .; Hysteropterum spee.; Issus dilatatus
Ol iv .; sämtlich von Ischia, sowie Acrisius fasciatus Me l . aus Bra silien ^
Sie besitzen paarige X-Organe mit dem dazu gehörenden Rektalorgan bei
den jü B ein großes unpaares a-Organ sowie ein drittes paariges (o ) oder
unpaares (l-)Mycetom, das jedoch nach Bau und Symbiontengehalt bei den
einzelnen Gattungen sehr verschieden und als o-Organ (Hysteropterum)
oder 1-Örgan (Acrisius) zu bezeichnen ist, hzw. von Hefen erfüllt oder ersetzt
wird (Issus).
2. Gr u p p e B: enthält Formen, deren Fettgewebe diffus mit Hefen besiedelt ist und die
außerdem nur noch das unscheinbare f-Organ besitzen, das ja stets mit
Hefen zusammen a u ftritt (Hysteropterum spee.,Thiona variata Me l ., Am-
nisa spee. sowie weitere 5, nur als Larven vorliegende und deshalb nicht
näher bestimmhare Formen Ik, Ir, In, Is und It; alle aus Brasilien).
Diese beiden Gruppen sind allerdings nicht so scharf getrennt wie in anderen Unterfamilien,
sondern durch Übergangsformen wie Issus coleoptratus verbunden, bei denen neben
in Mycetomen gebundenen Symbionten auch freie, das Fettgewebe diffus besiedelnde (Hefen)
Vorkommen, oder bei denen, wie bei Issus dilatatus diese sonst frei im Fettgewebe
lebenden Hefen auf das dritte Mycetom (1-Organ) beschränkt sind. Außerdem kommt es
vor, daß eine Gattung, z. B. Hysteropterum, Vertreter in beiden Untergruppen besitzt.
Trotzdem soll aus Gründen einer übersiehtlieheren Darstellung an dieser etwas groben
Einteilung festgehalten werden.
Die Angehörigen der Gr u p p e A, die vor allem aus den Gattungen Issus und Hysteropterum
stammen, unterscheiden sieh in ihren symbiontischen Verhältnissen untereinan-
73
der nur durch die verschiedene Ausprägung des dritten Organs und seiner Insassen, während
die Rektal-, X- und a-Organe bei allen sehr einheitlich entwickelt sind, so daß wir uns
in diesen Punkten auf eine zusammenfassende Darstellung beschränken können.
Das R e k t a l o r g a n hat meist eine gedrungen eiförmige, oft fast kugelige Gestalt und hängt in einer einseitig
entwickelten Valvula rectalis frei und klöppelförmig in das stark erweiterte Lumen des Rektums hinein. Es wird nur in seinem
obersten Teil schräg von dein spaltförmig engen Lumen der Valvula durchbrochen, oft sogar nur rinnenförmig gestreift
und entspricht somit dem auf Fig. 2 c dargestellten Typ. Die Zahl der großen, zweikernigen Mycetocyten, die sich
an seinem Aufbau beteiligen, beträgt bei Issus spee. 11, bei Issus dilatatus ca. 15-^20, bei Hysteropterum grylloides 20 und
bei Hysteropterum. spee. ca. 10—15. Das Darmepithel ist im Bereich des Mycetoms stark abgeplattet und membranartig
dünn, ebenso die Hüllepithelien der Mycetocyten. Die großen Mycetocytenkerne sind schriftzeichenförmig verästelt und
zu dünnen Lappen ausgezogen. Als Symbionten stellte ich stets sehr kräftige, meist langgewundene (Hysteropterum grylloides,
Issus dilatatus, Hysteropterum maculipes) oder kürzere (Hysteropterum spee.) Schläuche fest. Die Infektionsformen
haben gedrungenere, oft polygonale, u-förmig gebogene Gestalt, sind dunkler färbbar und liegen einzeln oder in kleinen
Gruppen in den peripheren Zonen der Mycetocyten und in den umhüllenden Epithelien.
Die paarig ausgebildeten X- O r g a n e stellen mächtige, lange Schläuche dar, die wie üblich in einiger Entfernung
von der Mediane des Abdomens von hinten nach vorn ziehen, wo sie oft hakenförmig umbiegen und weiter außen wieder
ein Stück zurücklaufen, so daß sie im ganzen mehr oder weniger hufeisenförmig geformt sind (Acrisius, Hysteropterum
grylloides). Meist sind sie stark hin und her gewunden, zusammengestaucht und besonders an den Enden stark
aufgeknäult, so daß ihre Gestalt nur bei jugendlichen Tieren genauer zu ermitteln ist. Das Epithel ist flach und unscheinbar.
Der Innenaufbau zeigt nichts Besonderes. Das Wirtsplasma ist oft sehr kräftig entwickelt und bildet, besonders bei
Issus dilatatus und Hysteropterum spee. auch zentral zwischen den Symbionten schmale Wände und kleine Inseln, während
es im allgemeinen mehr auf die Randzonen und radiale Septen beschränkt ist. Die chromatinreichen, oft gelappten
und sternförmig verästelten Kerne verteilen sich ganz entsprechend. Die Symbionten sind randlich außerordentlich zerschlissen
und unregelmäßig gelappt, besitzen aber stets eine, wenn auch oft kleine, so doch deutliche ungeteilte Zentralmasse
und gehören damit dem Cixiustyp an. Ihr Grundplasma ist sehr dicht und homogen, stark eosinophil und von zahlreichen
dunkleren Granulis von verschiedener Form und Größe durchsetzt.
Das a - O r g a n ist bei den Issinen stets unpaar geblieben und durchzieht als langer, kräftiger hufeisenförmiger
Schlauch in weitem Bogen das Abdomen, so daß seine langen, nach hinten gerichteten Schenkel meist von außen den
hinteren Teilen der X-Organe anliegen oder von ihnen umschlungen werden. Bei den $ $ sind diese stets mehr nach
der Dorsalseite verlagerten Endteile blasig erweitert, während der unpaare Brückenteil schlauchförmig dünn bleibt und
der ventralen Abdomenwand genähert ist. Die weiblichen Mycetome sind auch im ganzen größer und gedrungener als
die männlichen. Sie besitzen ein kräftiges, hohes, von zahlreichen Tracheen durchzogenes Epithel mit blassen rundlichen
Kernen und bestehen aus zahlreichen, großen Einzelsyncytien (Hysteropterum grylloides, Acrisius, Issus dilatatus und
Hysteropterum maculipes) oder einem einheitlichen Riesensyncytium (Hysteropterum spee.), je nachdem, wie weit der
synsyncytiale Zusammenschluß eben erfolgt ist. In den männlichen Organen ist er meist schon weiter fortgeschritten und
auch in der erstgenannten Gruppe schon angebahnt, hingegen bei den weiblichen Mycetomen verzögert, so daß selbst bei
der letztgenannten Hysteropterum spee. wenigstens in der Umgebung der Infektionshügel noch Einzelsyncytien erhalten
Sind. Die chromatinreichen, meist abgeflachten, gezackten Kerne liegen in Anschwellungen der schmalen Plasmabeläge,
die die Wände der Syncytien auskleiden, auch im Bereich der gemeinsamen inneren Wände der Einzelsyncytien, selten
dagegen auf isolierten Plasmafetzen zwischen den Symbionten. In allen Fällen sind die a-Organe von kräftigen, meist
lang schlauchförmigen gewundenen S y m b i o n t e n bewohnt. Auch hier sind die Insassen -der männlichen Organe meist
größer und kräftiger, dafür an Zahl geringer als die der weiblichen Mycetome (Abb. 122 a). Bei einem ( f von Issus dilatatus
konnte ich an mehreren Stellen des Organs eigentümliche Degenerationserscheinungen feststellen. Die normalerweise
lang schlauchförmigen Symbionten verkürzen sich in fließendem Übergang mehr und mehr, bis sie sich zu gedrungenen,
polygonalen Klumpen zusammenziehen. Zugleich lockert sich ihr sonst so homogenes und dichtes Plasma zunehmend auf;
es bilden sich zahlreiche Vakuolen, die anschwellend den Symbiontenleib auf blähen und vergrößern, so daß große
plumpe Körper entstehen, die schließlich zusammenfallen und zum Teil aufgelöst werden. Eine Deutung dieser, in männlichen
a-Organen auch bei anderen Fulgoroiden nicht seltenen, wenn auch nicht immer in diesem Maße zu beobachtenden
Erscheinung, soll der Besprechung im allgemeinen Teil Vorbehalten bleiben. — In den weiblichen Mycetomen sind je
zwei I n f e k t i o n s h ü g e l angelegt. Wie üblich sind es große, etwa halbkugelig ins Innere des Mycetoms eingesenkte
Nester ein- bis zweikerniger Zellen, meist in der Nähe des Organendes gelegen und entweder nach außen (Issus dilatatus,
Hysteropterum spee.) oder nach der Innenseite des Bogens gewendet (Hysteropterum grylloides, Hysteropterum maculipes).
In den zunächst sterilen Zellen bilden sich schon vor der Besiedlung mit Symbionten Vakuolen, die, anfangs klein, sich
stetig vergrößern und nach der Aufnahme derselben zu einem oder wenigen Hohlräumen zusammenfließen, wobei das
Wirtsplasma auf einen schmalen Randsaum zusammengedrängt wird. Es ist charakteristisch für die Infektionshügel der
Issinen-a-Organe, daß ihre Zellen bei der Besiedlung mehr oder weniger deutlich syncytial miteinander verschmelzen und
daß ihre Kerne meist sehr gelappte und zackige Formen annehmen, vor allem aber, daß jede Vakuole nur ganz wenige,
ca-_ 5,- dafür aber sehr, große Symbionten enthält. Die Normalsymbionten erfahren schon in der Umgebung der Infektionshügel
die üblichen Umgestaltungen (Abb. 122 b), indem sich die schlauchförmig schlanken Formen verkürzen und kon-
Zoologica, H e it 98;