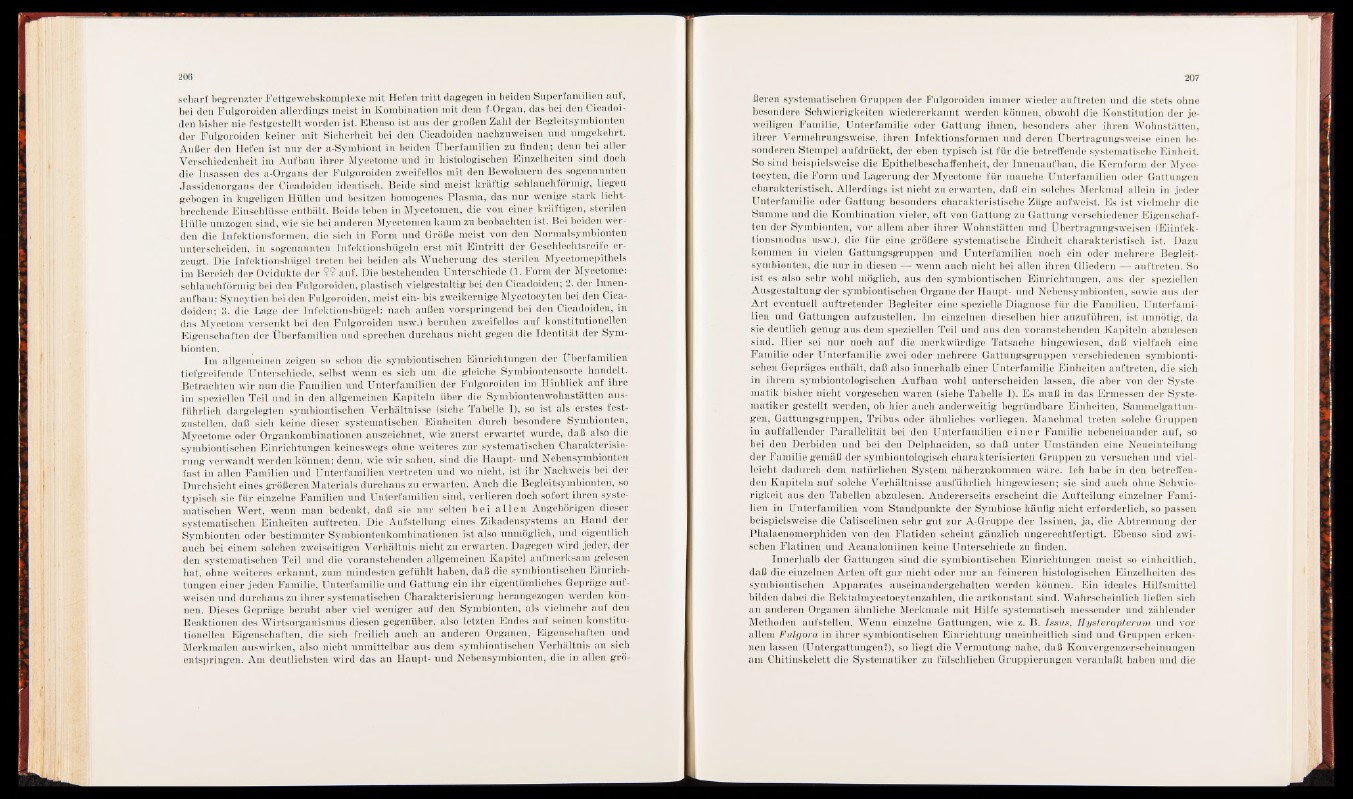
scharf begrenzter Fettgewebskomplexe mit Hefen tritt dagegen in beiden Superfamilien auf,
bei den Fulgoroiden allerdings meist in Kombination mit dem f-Organ, das bei den Cicadoi-
den bisher nie festgestellt worden ist. Ebenso ist aus der großen Zahl der Begleitsymbionten
der Fulgoroiden keiner mit Sicherheit bei den Cicadoiden nachzuweisen und umgekehrt.
Außer den Hefen ist nur der a-Symbiont in beiden Überfamilien zu finden; denn bei aller
Verschiedenheit im Aufbau ihrer Mycetome und in histologischen Einzelheiten sind doch
die Insassen des a-Organs der Fulg'oroiden zweifellos mit den Bewohnern des sogenannten
Jassidenorgans der Cicadoiden identisch. Beide sind meist kräftig schlauchförmig, liegen
gebogen in kugeligen Hüllen und besitzen homogenes Plasma, das nur wenige stark lichtbrechende
Einschlüsse enthält. Beide leben in Mycetomen, die von einer kräftigen, sterilen
Hülle umzogen sind, wie sie bei anderen Mycetomen kaum zu beobachten ist. Bei beiden werden
die Infektionsformen, die sich in Form und Größe meist von den Normalsymbionten
unterscheiden, in sogenannten Infektionshügeln erst mit E in tritt der Geschlechtsreife erzeugt.
Die Infektionshügel treten bei beiden als Wucherung des sterilen Mycetomepithels
im Bereich der Ovidukte der 99 auf. Die bestehenden Unterschiede (1. Form der Mycetome:
schlauchförmig bei den Fulgoroiden, plastisch vielgestaltig bei den Cicadoiden; 2. der Innenaufbau:
Syncytien bei den Fulgoroiden, meist ein- bis zweikernige Mycetocyten bei den Cicadoiden;
3. die Lage der Infektionshügel: nach außen vor springend bei den Cicadoiden, in
das Mycetom versenkt bei den Fulgoroiden usw.) beruhen zweifellos auf konstitutionellen
Eigenschaften der Überfamilien und sprechen durchaus nicht gegen die Identität der Sym-
bionten.
Im allgemeinen zeigen so schon die symbiontischen Einrichtungen der Überfamilien
tiefgreifende Unterschiede, selbst wenn es sich um die gleiche Symbiontensorte handelt.
Betrachten wir nun die Familien und Unterfamilien der Fulgoroiden im Hinblick auf ihre
im speziellen Teil und in den allgemeinen Kapiteln über die Symbiontenwohnstätten ausführlich
dargelegten symbiontischen Verhältnisse (siehe Tabelle I), so ist als erstes festzustellen,
daß sich keine dieser systematischen Einheiten durch besondere Svmbionten,
Mycetome oder Organkombinationen auszeichnet, wie zuerst erwartet wurde, daß also die
symbiontischen Einrichtungen keineswegs ohne weiteres zur systematischen Charakterisierung
verwandt werden können; denn, wie wir sahen, sind die Haupt- und Nebensymbionten
fast in allen Familien und Unterfamilien vertreten und wo nicht, ist ihr Nachweis bei der
Durchsicht eines größeren Materials durchaus zu erwarten. Auch die Begleitsymbionten, so
typisch sie für einzelne Familien und Unterfamilien sind, verlieren doch sofort ihren systematischen
Wert, wenn man bedenkt, daß sie nur selten b e i a l l e n Angehörigen dieser
systematischen Einheiten auftreten. Die Aufstellung eines Zikadensystems an Hand der
Symbionten oder bestimmter Symbiontenkombinationen ist also unmöglich, und eigentlich
auch bei einem solchen zweiseitigen Verhältnis nicht zu erwarten. Dagegen wird jeder, der
den systematischen Teil und die voranstehenden allgemeinen Kapitel aufmerksam gelesen
hat, ohne weiteres erkannt, zum mindesten gefühlt haben, daß die symbiontischen Einrichtungen
einer jeden Familie, Unterfamilie und Gattung ein ihr eigentümliches Gepräge auf-
weisen und durchaus zu ihrer systematischen Charakterisierung herangezogen werden können.
Dieses Gepräge beruht aber viel weniger auf den Symbionten, als vielmehr auf den
Reaktionen des Wirtsorganismus diesen gegenüber, also letzten Endes auf seinen konstitutionellen
Eigenschaften, die sich freilich auch an anderen Organen, Eigenschaften und
Merkmalen auswirken, also nicht unmittelbar aus dem symbiontischen Verhältnis an sich
entspringen. Am deutlichsten wird das an Haupt- und Nebensymbionten, die in allen größeren
systematischen Gruppen der Fulgoroiden immer wieder auftreten und die stets ohne
besondere Schwierigkeiten wiedererkannt werden können, obwohl die Konstitution der jeweiligen
Familie, Unterfamilie oder Gattung ihnen, besonders aber ihren Wohnstätten,
ihrer Vermehrungsweise, ihren Infektionsformen und deren Übertragungsweise einen besonderen
Stempel aufdrückt, der eben typisch ist für die betreffende systematische Einheit.
So sind beispielsweise die Epithelbeschaffenheit, der Innenaufbau, die Kernform der Mycetocyten,
die Form und Lagerung der Mycetome für manche Unterfamilien oder Gattungen
charakteristisch. Allerdings ist nicht zu erwarten, daß ein solches Merkmal allein in jeder
Unterfamilie oder Gattung besonders charakteristische Züge auf weist. Es ist vielmehr die
Summe und die Kombination vieler, oft von Gattung zu Gattung verschiedener Eigenschaften
der Symbionten, vor allem aber ihrer Wohnstätten und Übertragungsweisen (Eiinfektionsmodus
usw.), die für eine größere systematische Einheit charakteristisch ist. Dazu
kommen in vielen Gattungsgruppen und Unterfamilien noch ein oder mehrere Begleitsymbionten,
die nu r in diesen — wenn auch nicht bei allen ihren Gliedern — auftreten. So
ist es also sehr wohl möglich, aus den symbiontischen Einrichtungen, aus der speziellen
Ausgestaltung der symbiontischen Organe der Haupt- und Nebensymbionten, sowie aus der
A rt eventuell auf tretender Begleiter eine spezielle Diagnose für die Familien, Unterfamilien
und Gattungen aufzustellen. Im einzelnen dieselben hier anzuführen, ist unnötig, da
sie deutlich genug aus dem speziellen Teil und aus den voranstehenden Kapiteln abzulesen
sind. Hier sei nur noch auf die merkwürdige Tatsache hingewiesen, daß vielfach eine
Familie oder Unterfamilie zwei oder mehrere Gattungsgruppen verschiedenen symbiontischen
Gepräges enthält, daß also innerhalb einer Unterfamilie Einheiten auftreten, die sich
in ihrem symbiontologischen Aufbau wohl unterscheiden lassen, die aber von der Systematik
bisher nicht vorgesehen waren (siehe Tabelle I). Es muß in das Ermessen der Systematiker
gestellt werden, ob hier auch anderweitig begründbare Einheiten, Sammelgattungen,
Gattungsgruppen, Tribus oder ähnliches vorliegen. Manchmal treten solche Gruppen
in auffallender Parallelität bei den Unterfamilien e i n e r Familie nebeneinander auf, so
bei den Derbiden und bei den Delphaciden, so daß unter Umständen eine Neueinteilung
der Familie gemäß der symbiontologisch charakterisierten Gruppen zu versuchen und vielleicht
dadurch dem natürlichen System näherzukommen wäre. Ich habe in den betreffenden
Kapiteln auf solche Verhältnisse ausführlich hingewiesen; sie sind auch ohne Schwierigkeit
aus den Tabellen abzulesen. Andererseits erscheint die Aufteilung einzelner Familien
in Unterfamilien vom Standpunkte der Symbiose häufig nicht erforderlich, so passen
beispielsweise die Caliscelinen sehr gut zur A-Gruppe der Issinen, ja, die Abtrennung der
Phalaenomorphiden von den Flatiden scheint gänzlich ungerechtfertigt. Ebenso sind zwischen
Fiatinen und Acanaloniinen keine Unterschiede zu finden.
Innerhalb der Gattungen sind die symbiontischen Einrichtungen meist so einheitlich,
daß die einzelnen Arten oft gar nicht oder nur an feineren histologischen Einzelheiten des
symbiontischen Apparates auseinandergehalten werden können. Ein ideales Hilfsmittel
bilden dabei die Rektalmycetocytenzahlen, die artkonstant sind. Wahrscheinlich ließen sich
an anderen Organen ähnliche Merkmale mit Hilfe systematisch messender und zählender
Methoden aufstellen. Wenn einzelne Gattungen, wie z. B. Issus, Hysteropterum und vor
allem Fulgora in ihrer symbiontischen Einrichtung uneinheitlich sind und Gruppen erkennen
lassen (Untergattungen?), so liegt die Vermutung nahe, daß Konvergenzerscheinungen
am Chitinskelett die Systematiker zu fälschlichen Gruppierungen veranlaßt haben und die