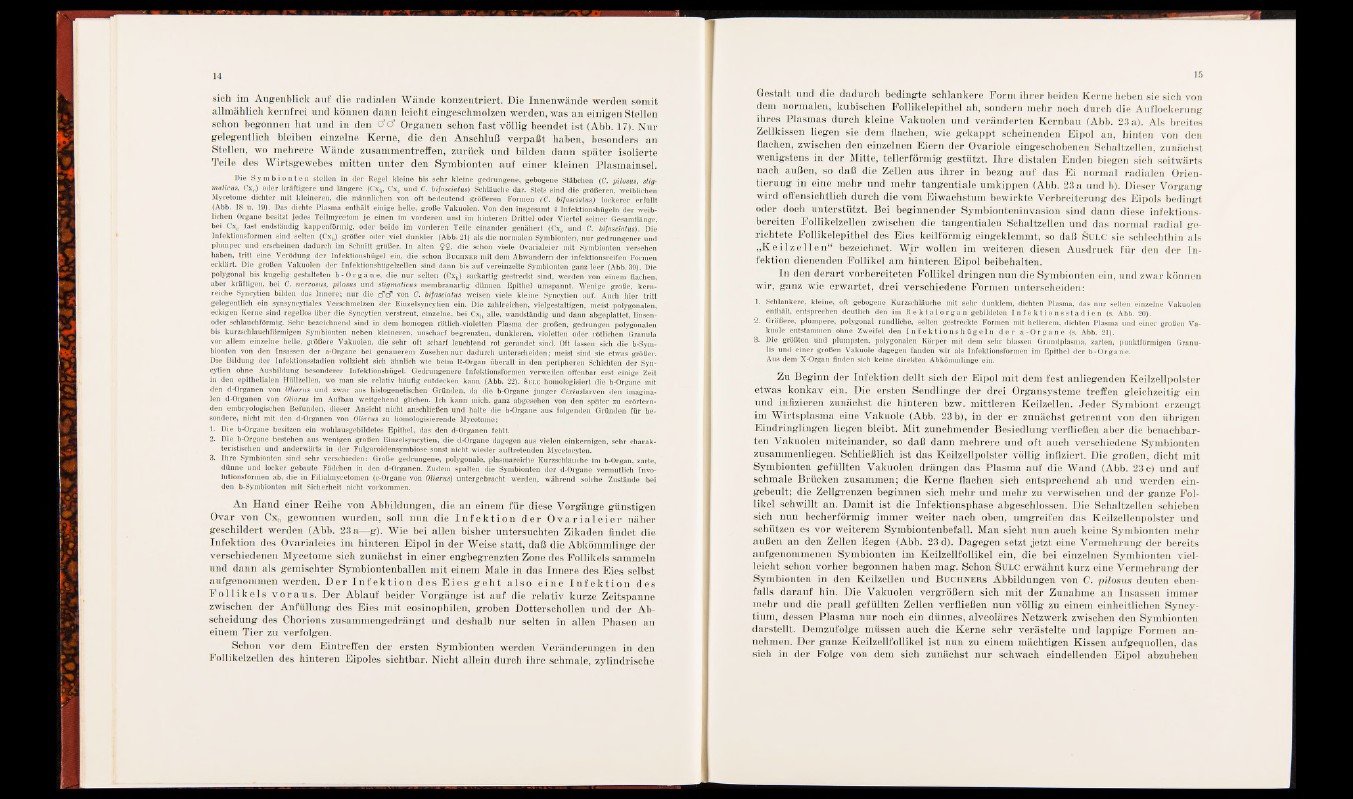
sich im Augenblick auf die radialen Wände konzentriert. Die Innenwände werden somit
allmählich kernfrei und können dann leichj|ingesehmolzen werden, was,kn einigen Stellen
schon begonnen h a t und im den, <f0 Organen schon fast völlig beendet ist (Abb. 17). Nur
gelegentlich bleiben einzelne Kerne, die den Anschluß verpaßt haben, besonders an
Stellen, wo mehrere Wände Zusammentreffen, zurück und bilden dann später isolierte
Teile des Wirtsgewebes mitten unter den Symbionten auf einer kleinen Plasmainsel.
Die S y m b i o n t e n stellen in der Regel kleine bis sehr kleine gedrungene, gebogene Stäbchen (C. pilosus, stig-
maticus, Cxe) oder kräftigere und längere (Cxh, Cxc und C. bifasciatus) Schläuche dar. Stets sind die größeren, weiblichen
Mycetome dichter mit kleineren, die männlichen von oft bedeutend größeren Formen (C. bifasciatus) lockerer erfüllt
(Abb. 18 u. 19). Das dichte Plasma enthält einige helle, große Vakuolen. Von den insgesamt 4 Infektionshügeln der weiblichen
Organe besitzt jedes Teilmycetom je einen im vorderen und im hinteren Drittel oder Viertel seiner Gesamtlänge,
bei Cxc fast endständig kappenförmig, oder beide im vorderen Teile einander genähert (Cx0 und C. bifasciatus). Die
Infektionsformen sind selten (Cxh) größer oder viel dunkler (Abb. 21) als die normalen Symbionten, nur gedrungener und
plumper und erscheinen dadurch im Schnitt größer. In alten $ $ , die schon viele Ovarialeier mit Symbionten versehen
haben, tritt eine Verödung der Infektionshügel ein, die schon B ü ch n er mit dem Abwandern der infektionsreifen Formen
erklärt. Die großen Vakuolen der Infektionshügelzellen sind dann bis auf vereinzelte Symbionten ganz leer (Abb. 39). Die
polygonal bis kugelig gestalteten b -Or g a n e , die nur selten (Cxh) sackartig gestreckt sind, werden von einem flachen,
aber kräftigen, bei C. nervosus, pilosus und stigmaticus membranartig dünnen Epithel umspannt. Wenige große, kernreiche
Syncytien bilden das Innere; nur die cTgT von C. bifasciatus weisen viele kleine Syncytien. auf. Auch hier tritt
gelegentlich ein synsyncytiales Verschmelzen der Einzelsyncytien ein. Die zahlreichen, vielgestaltigen, meist polygonalen,
eckigen Kerne sind regellos über die Syncytien verstreut, einzelne, bei Cxh alle, wandständig und dann abgeplattet, linsen-
oder schlauchförmig. Sehr bezeichnend sind in dem homogen rötlich-violetten Plasma der großen, gedrungen polygonalen
bis kurzschlauchförmigen Symbionten neben kleineren, unscharf begrenzten, dunkleren, violetten oder rötlichen Granula
vor allem einzelne helle, größere Vakuolen, die sehr oft scharf leuchtend rot gerandet sind. Oft lassen sich die b-Sym-
bionten von den Insassen der a-Organe bei genauerem Zusehen nur dadurch unterscheiden; meist sind sie etwas größer.
Die Bildung der Infektionsstadien vollzieht sich ähnlich wie beim R-Organ überall in den peripheren Schichten der Syncytien
ohne Ausbildung besonderer Infektionshügel. Gedrungenere Infektionsformen verweilen offenbar erst einige Zeit
in den epithelialen Hüllzelleh, wo man sie relativ häufig entdecken kann (Abb. 22). S ulc homologisiert die b-Organe mit
den d-Organen von Oliarus und zwar aus histogenetischen Gründen, da die b-Organe junger Cmwslarven den imagina-
len d-Organen von Oliarus im Aufbau weitgehend glichen. Ich kann mich, ganz abgesehen von den später p i erörternden
embryologischen Befunden, dieser Ansicht nicht anschließen und halte die b-Organe aus folgenden Gründen für besondere,
nicht mit den d-Organen von Oliarus zu homologisierende Mycetome:
1. Die b-Organe besitzen ein wohlausgebildetes Epithel, das den d-Organen fehlt.
2. Die b-Organe bestehen aus wenigen großen Einzelsyncytien, die d-Organe dagegen aus vielen einkernigen, sehr charakteristischen
und anderwärts in der Fulgoroidensymbiose sonst nicht wieder auf tretenden Mycetocyten.
3. Ihre Symbionten sind sehr verschieden: Große gedrungene, polygonale, plasmareiche Kurzschläuche im b-Organ, zarte,
dünne und locker gebaute Fädchen in den d-Organen. Zudem spalten die Symbionten der d-Organe vermutlich Involutionsformen
ab, die in Filialmycetomen (c-Organe von Oliarus) untergebracht werden, während solche Zustände bei
den b-Symbionten mit Sicherheit nicht Vorkommen.
An Hand einer Reihe von Abbildungen, die an einem für dies®. Vorgänge günstigen
Ovar von Cxh gewonnen wurden, söll nun die I n f e k t i o n d e r O v a r i a l e i e r näher
geschildert werden (Abb. 28 a—g). Wie bei allen bisher untersuchten Zikaden findet die
Infektion des Ovarialeies im hinteren Eipol in der Weise statt, daß die Abkömmlinge der
verschiedenen Mycetome sich zunächst in einer engbegrenzten Zone des Follikels sammeln
und dann als gemischter Symbiontenballen mit einem Male in das Innere des Eies selbst
aufgenommen werden. D e r I n f e k t i o n des E i e s g e h t a l s o e ine I n f e k t i o n des
F o l l i k e l « v o r a u s . Der Ablauf beider Vorgänge ist auf die relativ kurze Zeitspanne
zwischen der Anfüllung des Eies mit eosinophilen, groben Dottersehollen und der Abscheidung
des Chorions zusammengedrängt und deshalb nur selten in allen Phasen an
einem Tier zu verfolgen.
Schon vor dem Eintreffen der ersten Symbionten werden Veränderungen in den
Follikelzellen des hinteren Eipoles sichtbar. Nicht allein durch ihre schmale, zylindrische
Gestalt und die dadurch bedingte schlankere Form ihrer beiden Kerne heben sie sich von
dem normalen, kubischen Follikelepithel ab, sondern mehr noch durch die Auflockerung
ihres Plasmas durch kleine Vakuolen und veränderten Kernbau (Abb. 23 a). Als breites
Zellkissen liegen sie dem flachen, wie gekappt scheinenden Eipol an, hinten von den
flachen, zwischen den einzelnen Eiern der Ovariole eingeschobenen Schaltzellen, zunächst
wenigstens in der Mitte, tellerförmig gestützt. Ih re distalen Enden biegen sich seitwärts
nach außem so daß die Zellen aus ihrer in bezug auf das Ei normal radialen Orientierung
in eine mehr und mehr tangentiale umkippen (Abb. 23 a und b). Dieser Vorgang
wird offensichtlich durch die vom Eiwachstum bewirkte Verbreiterung des Eipols bedingt
oder doch unterstützt. Bei beginnender Symbionteninvasion sind dann diese infektionsbereiten
Fdlikelzellen zwischen die tangentialen Schaltzellen und das normal radial gerichtete
Follikelepithel des Eies keilförmig eingeklemmt, so daß Su l c sie schlechthin als
„ Ke i l z e l l e n “ 'bezeichnet. Wir wollen im weiteren diesen Ausdruck für den der In fektion
dienenden Follikel am hinteren Eipol beibehalten.
In den derart vorbereiteten Follikel dringen nun die Symbionten ein, und zwar können
wir, ganz wie erwartet, drei verschiedene Formen unterscheiden:
1 ZI A l . I H I oft gebogene kürzsclii&uche mit sehr dunkföäi, dichten Plashiä, das nur heften einzelne Vakuolen
enthält, entsprechen deutlich den im R e k t a l o r g a n gebildeten I n f e k t ^ n s s t ä d i e n (s. Abb. 20).
2" Großeie, plumpeie, polygonal rundliche, selten gestreckte Formen mit Höherem, dichten Plasma und einer großen Va-
tioole entstammen ohne TwSM&l den I n f e k : i o n s h ; i« e t n d e r a - fl r g .t r. e {s. Abb. 21).
^ l a ^ r S f l t e ö tund plumpstet;, polygipitiTgri Körper mit dem sehr blassen Grundpiasma, zarten, punktförmigen Granu-
lis nt-.d MtnbViiaiß im ly ^ uoie dagegen tanden^ffjlflils Intektionsfornier. im Epithel der b-Organe.
Ausciiein X Organ finden sichnlrfirre direkten Abkömmlinge ein.
Zu Beginn der Infektion dellt sich der Eipol mit dem fest anliegenden Keilzellpolster
etwas konkav ein. Die ersten Seudlinge der drei Organsysteme treffen gleichzeitig ein
und infizieren zunächst die hinteren bzw. mittleren Keilzellen. Jeder Symbiont erzeugt
im Wirtsplasma eine Vakuole (Abb. 23 b), in der er zunächst getrennt von den übrigen
Eindringlingen liegen bleibt. Mit zunehmender Besiedlung verfließen aber die benachbarten
Vakuolen miteinander, so daß dann mehrere und oft auch verschiedene Symbionten
zusammenliegen. Schließlich ist das KeiMÜpolster völlig infiziert. Die großen, dicht mit
Symbionten gefüllten Vakuolen drängen das Plasma auf die Wand (Abb. 23 e) und auf
schmale Brücken zusammen; die Kerne flachen sieh entsprechend ah und werden eingebeult;
die Zellgremzeu beginnen sich mehr und mehr zu verwischen und der ganze Follikel
schwillt an. Damit ist die Infektionsphase abgeschlossen. Die Schaltzellen schieben
flieh nun becherförmig immer weiter nach oben, umgreifen das Keilzellenpolster und
;l|hützen es vor weiterem Symbiontenbefall. Man sieht nun auch keine Symbionten mehr
außen an den Zellen liegen (Abb. 23 d). Dagegen setzt jetzt eine Vermehrung der bereits
aufgenommenen Symbionten im Keilzellfollikel ein, die jfli einzelnen Symbionten vielleicht
schon vorher begonnen haben mag. .Schon SüLC erwähnt kurz eine Vermehrung der
Symbionten in den Keilzellen und B ü ch n er s Abbildungen von C. pilosus deuten ebenfalls
darauf hin. Die Vakuolen vergrößern sieh mit der Zunahme an Insassen immer
mehr und die prall gefüllten Zellen verfließen nun völlig zu einem einheitlichen Syncy-
tium, dessen Plasma nur noch ein dünnes, alveoläres Netzwerk zwischen den Symbionten
darstellt. Demzufolge müssen auch die Kerne sehr verästelte und lappige Formen annehmen.
Der ganze Keilzellfollikel ist nun zu einem mächtigen Kissen aufgequollen, das
sieh in der Folge von dem sich zunächst nur schwach eindellenden Eipol abzuheben