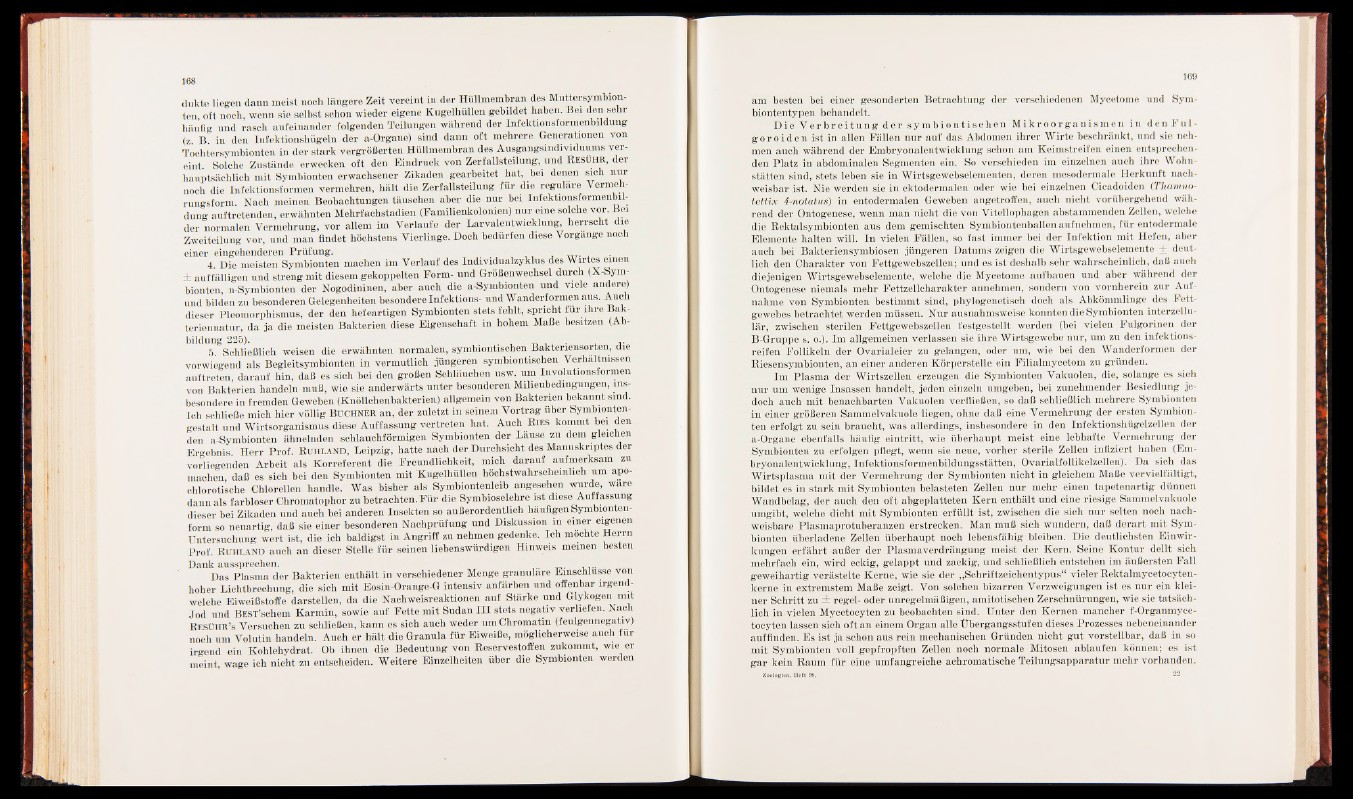
dukte liegen dann meist noch längere Zeit vereint in der Hüllmembran des Muttersymbion-
ten oft noch, wenn sie selbst schon wieder eigene Kugelhüllen gebildet haben. Bei den sehr
häufig und rasch aufeinander folgenden Teilungen während der Infektionsformenbildung
(z. B. in den Infektionshügeln der a-Organe) sind dann oft mehrere Generationen von
Tochtersymbionten in der stark vergrößerten Hüllmembran des Ausgangsindividuums vereint.
Solche Zustände erwecken oft den Eindruck von Zerfallsteilung, und B e su h r , der
hauptsächlich mit Symbionten erwachsener Zikaden gearbeitet hat, bei denen sich nur
noch die Infektionsformen vermehren, hält die Zerfallsteilung für die reguläre Vermehrungsform.
Nach meinen Beobachtungen täuschen aber die nur hei Infektionsformenbil-
dung auftretenden, erwähnten Mehrfachstadien (Pamilienkolonien) nur eine solche vor. Bei
der normalen Vermehrung, vor allem im Verlaufe der Larvalentwicklung, herrscht die
Zweiteilung vor, und man findet höchstens Vierlinge. Doch bedürfen diese Vorgänge noch
einer eingehenderen Prüfung.
4. Die meisten Symbionten machen im Verlauf des Individualzyklus des Wirtes einen
± auffälligen und streng mit diesem gekoppelten Form- und Größenwechsel durch (X-Sym-
bionten, n-Symbionten der Nogodininen, aber auch die a-Symbionten und viele andere)
und bilden zu besonderen Gelegenheiten besondere Inf ektions- und Wanderformen aus. Auch
dieser Pleomorphismus, der den hefeartigen Symbionten stets fehlt, s p n c h g |r ihre Bakteriennatur,
da ja die meisten Bakterien diese Eigenschaft in hohem Maße besitzen (Abbildung
225). . ,.
5 Schließlich weisen die erwähnten normalen, symbiontischen Bakteriensorten, die
vorwiegend als Begleitsymbionten in vermutlich jüngeren symbiontischen Verhältnissen
auftreten, darauf hin, daß es sich bei den großen Schläuchen usw. um Involutionsformen
von Bakterien handeln muß, wie sie anderwärts unter besonderen Milieubedingungen, insbesondere
in fremden Geweben (Knöllchenbakterien) allgemein von Bakterien bekannt sind.
Ich schließe mich hier völlig B ü c h n e r an, der zuletzt in seinem Vortrag über Symbionten-
gestalt und Wirtsorganismus diese Auffassung vertreten hat. Auch E ie s kommt hei den
den a-Symhionten ähnelnden schlauchförmigen Symbionten der Läuse zu dem gleichen
Ergebnis. Herr Prof. B u h l a n d , Leipzig, hatte nach der Durchsicht des Manuskriptes der
vorliegenden Arbeit als Korreferent die Freundlichkeit, mich darauf aufmerksam zu
machen, daß es sich hei den Symbionten mit 'Kugelhüllen höchstwahrscheinlich um apo-
chlorotische Chlorellen handle. Was bisher als Symbiontenleib angesehen wurde, ware
dann als farbloser Chromatophor zu betrachten. F ü r die Symbioselehre ist diese Auffassung
dieser bei Zikaden und auch hei anderen Insekten so außerordentlich häufigen Symbionten-
form so neuartig, daß sie einer besonderen Nachprüfung und Diskussion in einer eigenen
Untersuchung wert ist, die ich baldigst in Angriff zu nehmen gedenke. Ich mochte Herrn
Prof. B u h la n d auch an dieser Stelle für seinen liebenswürdigen Hinweis meinen besten
Dank aussprechen.
Das Plasma der Bakterien enthält in verschiedener Menge granuläre Einschlüsse von
hoher Lichtbrechung, die sich mit Eosin-Orange-G intensiv anfärben und offenbar irgendwelche
Eiweißstoffe darstellen, da die Nachweisreaktionen auf Stärke und Glykogen mit
Jod und BEST’schem Karmin, sowie auf Fette mit Sudan I I I stets negativ verliefen. Nach
BESÜHR’s Versuchen zu schließen, kann es sich auch weder um Chromatin (feulgennegativ)
noch um Volutin handeln. Auch er hält die Granula für Eiweiße, möglicherweise auch für
irgend ein Kohlehydrat. Ob ihnen die Bedeutung von Eeservestoffen zukommt, wie er
meint, wage ich nicht zu entscheiden. Weitere Einzelheiten über die Symbionten werden
am besten bei einer gesonderten Betrachtung der verschiedenen Mycetome und Sym-
biontentypen behandelt.
D ie V e r b r e i t u n g d e r s ymb i o n t i s c h e n Mi k r o o r g a n i sme n in de n Fu l -
g o r o i d e n ist in allen Fällen nur auf das Abdomen ihrer Wirte beschränkt, und sie nehmen
auch während der Embryonalentwicklung schon am Keimstreifen einen entsprechenden
Platz in abdominalen Segmenten ein. So verschieden im einzelnen auch ihre Wohnstätten
sind, stets leben sie in Wirtsgewebselementen, deren mesodermale Herkunft nachweisbar
ist. Nie werden sie in ektodermalen oder wie bei einzelnen Cicadoiden (Thamno-
tettix 4-notatus) in entodermalen Geweben angetroffen, auch nicht vorübergehend während
der Ontogenese, wenn man nicht die von Vitellophagen abstammenden Zellen, welche
die Rektalsymbionten aus dem gemischten Symbiontenballen auf nehmen, für entodermale
Elemente halten will. In vielen Fällen, so fast immer bei der Infektion mit Hefen, aber
auch bei Bakteriensymbiosen jüngeren Datums zeigen die Wirtsgewebselemente ^ deutlich
den Charakter von Fettgewebszellen; und es ist deshalb sehr wahrscheinlich, daß auch
diejenigen Wirtsgewebselemente, welche die Mycetome auf bauen und aber während der
Ontogenese niemals mehr Fettzellcharakter annehmen, sondern von vornherein zur Aufnahme
von Symbionten bestimmt sind, phylogenetisch doch als Abkömmlinge des Fe ttgewebes
betrachtet werden müssen. Nur ausnahmsweise konnten die Symbionten interzellulär,
zwischen sterilen Fettgewebszellen festgestellt werden (bei vielen Fulgorinen der
B-Gruppe s. o.). Im allgemeinen verlassen sie ihre Wirtsgewebe nur, um zu den infektionsreifen
Follikeln der Ovarialeier zu gelangen, oder um, wie bei den Wanderformen der
Riesensymbionten, an einer anderen Körperstelle ein Filialmycetom zu gründen.
Im Plasma der Wirtszellen erzeugen die Symbionten Vakuolen, die, solange es sich
nur um wenige Insassen handelt, jeden einzeln umgeben, bei zunehmender Besiedlung jedoch
auch mit benachbarten Vakuolen verfließen, so daß schließlich mehrere Symbionten
in einer größeren Sammelvakuole liegen, ohne daß eine Vermehrung der ersten Symbionten
erfolgt zu sein braucht, was allerdings, insbesondere in den Infektionshügelzellen der
a-Organe ebenfalls häufig eintritt, wie überhaupt meist eine lebhafte Vermehrung der
Symbionten zu erfolgen pflegt, wenn sie neue, vorher sterile Zellen infiziert haben (Embryonalentwicklung,
Infektionsformenbildungsstätten, Ovarialfollikelzellen). Da sich das
Wirtsplasma mit der Vermehrung der Symbionten nicht in gleichem Maße vervielfältigt,
bildet es in stark mit Symbionten belasteten Zellen nur mehr einen tapetenartig dünnen
Wandbelag, der auch den oft abgeplatteten Kern enthält und eine riesige Sammelvakuole
umgibt, welche dicht mit Symbionten erfüllt ist, zwischen die sich nur selten noch nachweisbare
Plasmaprotuberanzen erstrecken. Man muß sich wundern, daß derart mit Symbionten
überladene Zellen überhaupt noch lebensfähig bleiben. Die deutlichsten Einwirkungen
erfährt außer der Plasmaverdrängung meist der Kern. Seine Kontur dellt sich
mehrfach ein, wird eckig, gelappt und zackig, und schließlich entstehen im äußersten Fall
geweihartig verästelte Kerne, wie sie der „Schriftzeichentypus“ vieler Rektalmycetocyten-
kerne in extremstem Maße zeigt. Von solchen bizarren Verzweigungen ist es nur ein kleiner
Schritt zu ± regel- oder unregelmäßigen, amitotischen Zerschnürungen, wie sie tatsächlich
in vielen Mycetocyten zu beobachten sind. Unter den Kernen mancher f-Organmyce-
tocyten lassen sich oft an einem Organ alle Übergangsstufen dieses Prozesses nebeneinander
auffinden. Es ist ja schon aus rein mechanischen Gründen nicht gut vorstellbar, daß in so
mit Symbionten voll gepfropften Zellen noch normale Mitosen ablaufen können; es ist
gar kein Raum für eine umfangreiche achromatische Teilungsapparatur mehr vorhanden.
Zoologica, Heft 98. 2 2