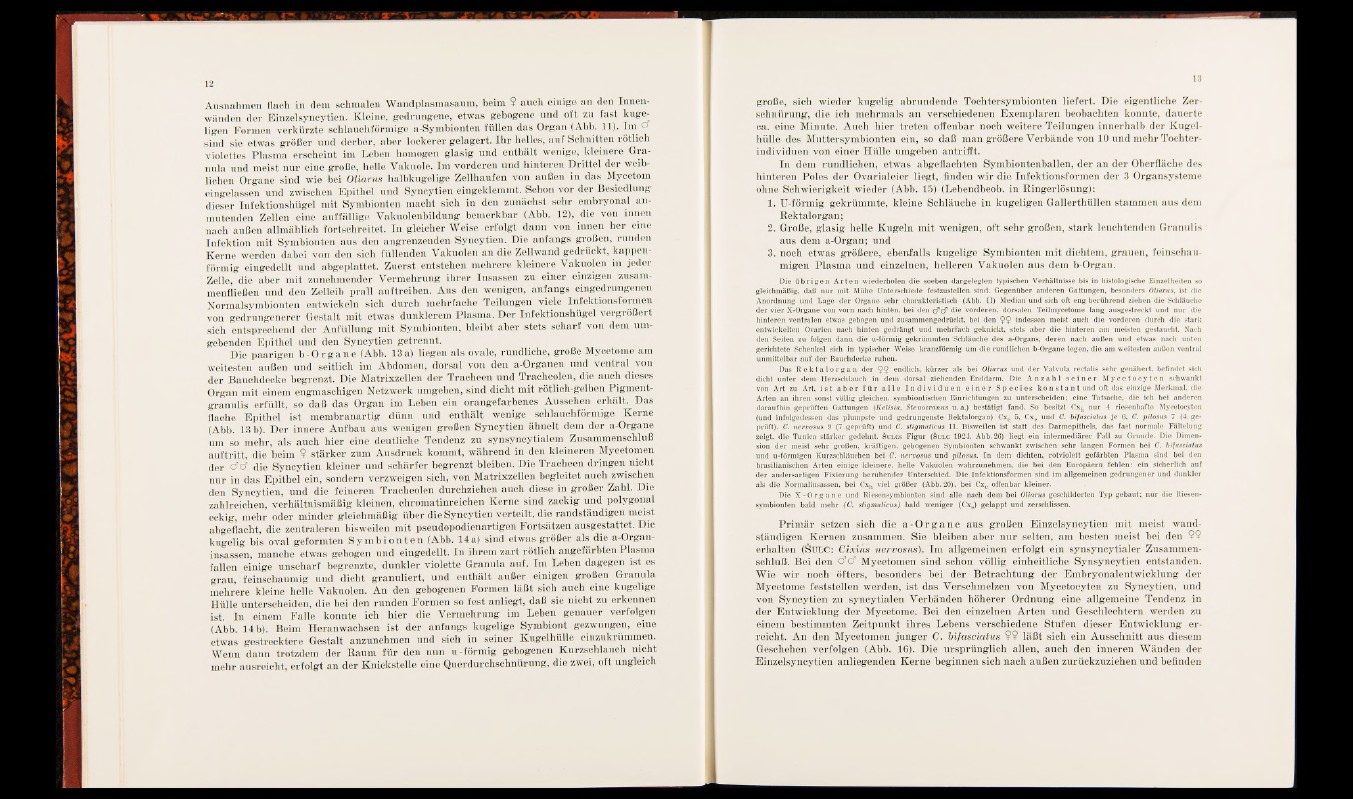
Ausnahmen flach in dem schmalen Wandplasmasaum, beim ? auch einige an den Innenwänden
der Einzelsyncytien. Kleine, gedrungene, etwas gebogene und oft zu fast kugeligen
Formen verkürzte schlauchförmige a-Symbionten füllen das Organ (Abb. 11). Im o
sind sie etwas größer und derber, aber lockerer gelagert. Ih r helles, auf Schnitten rötlich
violettes Plasma erscheint im Leben homogen glasig und enthält wenige, kleinere Granula
und meist nur eine große, helle Vakuole. Im vorderen und hinteren Drittel der weiblichen
Organe sind wie bei Oliarus halbkugelige Zellhaufen von außen in das Mycetom
eingelassen und zwischen Epithel und Syncytien eingeklemmt. Schon vor der Besiedlung
dieser Infektionshügel mit Symbionten macht sieh in den zunächst sehr embryonal anmutenden
Zellen eine auffällige Vakuolenbildung bemerkbar (Abb. 12), die von innen
nach außen allmählich fortsehreitet. In gleicher Weise erfolgt dann von innen her eine
Infektion mit Symbionten aus den angrenzenden Syncytien. Die anfangs großen, runden
Kerne werden dabei von den sich füllenden Vakuolen an die Zellwand gedrückt, kappenförmig
eingedellt und abgeplattet. Zuerst entstehen mehrere kleinere Vakuolen in jeder
Zelle, die aber mit zunehmender Vermehrung ihrer Insassen zu einer einzigen zusammenfließen
und den Zelleib prall auftreiben. Aus den wenigen, anfangs eingedrungenen
Normalsymbionten entwickeln sich durch mehrfache Teilungen viele Infektionsformen
von gedrungenerer Gestalt mit etwas dunklerem Plasma. Der Infektionshügel vergrößert
sich entsprechend der Anfüllung mit Symbionten, bleibt aber stets scharf von dem umgebenden
Epithel und den Syncytien getrennt.
Die paarigen b - O r g a n e (Abb. 13a) liegen als ovale, rundliche, große Mycetome am
weitesten außen und seitlich im Abdomen, dorsal von den a-Organen und ventral von
der Bauchdecke begrenzt. Die Matrixzellen der Tracheen und Tracheolen, die auch dieses
Organ mit einem engmaschigen Netzwerk umgeben, sind dicht mit rötlich-gelben Pigment-
granulis e rfü lM so daß das Organ im Leben ein orangefarbenes Aussehen erhält. Das
flache Epithel ist membranartig; dünn und enthält wenige schlauchförmige Kerne
(Abb. 13b). Der innere Aufbau aus wenigen großen Syncytien ähnelt dem der a-Organe
um so mehr, als auch hier eine deutliche Tendenz zu synsyneytialem Zusammenschluß
auftritt, die beim f ” stärker zum Ausdruck kommt, während in den kleineren Mycetomen
der cf cf die Syncytien kleiner und schärfer begrenzt bleiben. Die Tracheen dringen nicht
nur in das Epithel ein, sondern verzweigen sich, von Matrixzellen begleitet auch zwischen
den Syncytien, und die feineren Tracheolen durchziehen auch diese in großer Zahl. Die
zahlreichen, verhältnismäßig kleinen, chromatinreichen Kerne sind zackig und polygonal
eckig, mehr oder minder gleichmäßig ü b e r die Syncytien verteilt, die randständigen meist
abgeflacht, die zentraleren bisweilen mit pseudopodienartigen Fortsätzen ausgestattet. Die
kugelig bis oval geformten S ymb i o n t e n (Abb. 14a) sind etwas größer als die a-Organ-
insassen, manche etwas gebogen und eingedellt. In ihrem zart rötlich angefärbten Plasma
fallen einige unscharf begrenzte, dunkler violette Granula auf. Im Leben dagegen ist es
grau, feinschaumig und dicht granuliert, und enthält außer einigen großen Granula
mehrere kleine helle Vakuolen. An den gebogenen Formen läß t sich auch eine kugelige
Hülle.unterscheiden, die bei den runden Formen so fest anliegt, daß sie nicht zu erkennen
ist. In einem Falle konnte ich hier die Vermehrung im Leben genauer verfolgen
(Abb. 14 b). Beim Heranwachsen ist der anfangs kugelige Symbiont gezwungen, eine
etwas gestrecktere Gestalt anzunehmen und sich in seiner Kugelhülle einzukrümmen.
Wenn dann trotzdem der Kaum fü r den nun u-förmig gebogenen Kurzschlauch nicht
mehr ausreicht, erfolgt an der Knickstelle eine Querdurchschnürung, die zwei, oft ungleich
große, sich wieder kugelig abrundende Tochtersymbionten liefert. Die eigentliche Zer-
schnürung, die ich mehrmals an verschiedenen Exemplaren beobachten konnte, dauerte
ca. eine Minute. Auch hier treten offenbar noch weitere Teilungen innerhalb der Kugelhülle
des Muttersymbionten ein, so daß man größere Verbände von 10 und mehr Tochterindividuen
von einer Hülle umgeben antrifft.
In dem rundlichen, etwas abgeflachten Symbiontenballen, der an der Oberfläche des
hinteren Poles der Ovarialeier liegt, finden wir die Infektionsformen der 3 Organsysteme
ohne Schwierigkeit wieder (Abb. 15) (Lebendbeob. in Ringerlösung):
1. U-förmig gekrümmte, kleine Schläuche in kugeligen Gallerthüllen stammen aus dem
Rektalorgan;
2. Große, glasig helle Kugeln mit wenigen, oft sehr großen, stark leuchtenden Granulis
aus dem a-Organ; und
3. noch etwas größere, ebenfalls kugelige Symbionten mit dichtem, grauen, feinschaumigen
Plasma und einzelnen, helleren Vakuolen aus dem h-Organ.
Die ü br i ge n Ar t en wiederholen die soeben dargelegten typischen Verhältnisse bis in histologische Einzelheiten so
gleichmäßig, daß nur mit Mühe Unterschiede festzustellen sind. Gegenüber anderen Gattungen, besonders Oliarus, ist die
Anordnung und Lage der Organe sehr charakteristisch (Abb. II) Median und sich oft eng berührend ziehen die Schläuche
der vier X-Organe von vorn nach hinten, bei den cfcf die vorderen, dorsalen Teilmycetome lang ausgestreckt und nur die
hinteren ventralen etwas gebogen und zusammengedrückt, bei den $ $ indessen meist auch die vorderen durch die stark
entwickelten Ovarien nach hinten gedrängt und mehrfach geknickt, stets aber die hinteren am meisten gestaucht. Nach
den Seiten zu folgen dann die u-förmig gekrümmten Schläuche des a-Organs, deren nach außen und etwas nach unten
gerichtete Schenkel sich in typischer Weise kranzförmig um die rundlichen b-Organe legen, die am weitesten außen ventral
unmittelbar auf der Bauchdecke ruhen.
Das R e k t a l o r g a n der $ $ endlich, kürzer als bei Oliarus und der Valvula rectalis sehr genähert, befindet sich
dicht unter dem Herzschlauch in dem dorsal ziehenden Enddarm. Die An z a h l s e i n e r My c e t o c y t e n schwankt
von Art zu Art, i s t a b e r f ü r a l l e I n d i v i d u e n e i n e r S p e c i e s k o n s t a n t und oft das einzige Merkmal, die
Arten an ihren sonst völlig gleichen, symbiontischen Einrichtungen zu unterscheiden; eine Tatsache, die ich bei anderen
daraufhin geprüften Gattungen (Kelisia, Stenocranus u.a.) bestätigt fand. So besitzt Cxh nur 4 riesenhafte Mycetocyten
(und infolgedessen das plumpste und gedrungenste Rektalorgan) Cxc 5, Cxe und C. bifasciatus je 6, C. pilosus 7 (4 geprüft),
C. nervosus 9 (7 geprüft) und C. stigmaticus 11. Bisweilen ist statt des Darmepithels, das fast normale Fältelung
zeigt, die Tunica stärker gedehnt. Sulcs Figur (Sulc 1924, Abb. 26) liegt ein intermediärer Fall zu Grunde. Die Dimension
der meist sehr großen, kräftigen, gebogenen Symbionten schwankt zwischen sehr langen Formen bei C. bifasciatus
und u'-förmigen Kurzschläuchen bei 0. nervosus und pilosus. In dem dichten, rotviolett gefärbten Plasma sind bei den
brasilianischen Arten einige kleinere, helle Vakuolen wahrzunehmen, die bei den Europäern fehlen: ein sicherlich auf
der andersartigen Fixierung beruhender Unterschied. Die Infektionsformen sind im allgemeinen gedrungener und dunkler
als die Normalinsassen, bei Cxh viel größer (Abb. 20), bei Cxc offenbar kleiner.
Die X- O r g a n e und Riesensymbionten sind alle nach dem bei Oliarus geschilderten Typ gebaut; nur die Riesen-
symbionten bald mehr (C. stigmaticus) bald weniger (Cxe) gelappt und zerschlissen.
Prim är setzen sich die a -Or g a n e aus großen Einzelsyncytien mit meist wandständigen
Kernen zusammen. Sie bleiben aber nur selten, am besten meist bei den 99
erhalten (ÖULC: Cixius nervosus). Im allgemeinen erfolgt ein synsyncytialer Zusammenschluß.
Bei den Cf Cf Mycetomen sind schon völlig einheitliche Synsyncytien entstanden.
Wie wir noch öfters, besonders bei der Betrachtung der Embryonalentwicklung der
Mycetome feststellen werden, ist das Verschmelzen von Mycetocyten zu Syncytien, und
von Syncytien zu syncytialen Verbänden höherer Ordnung eine allgemeine Tendenz in
der Entwicklung der Mycetome. Bei den einzelnen Arten und Geschlechtern werden zu
einem bestimmten Zeitpunkt ihres Lebens verschiedene Stufen dieser Entwicklung erreicht.
An den Mycetomen junger C. bifasciatus $9 läßt sich ein Ausschnitt aus diesem
Geschehen verfolgen (Abb. 16). Die ursprünglich allen, auch den inneren Wänden der
Einzelsyncytien anliegenden Kerne beginnen sich nach außen zurückzuziehen und befinden