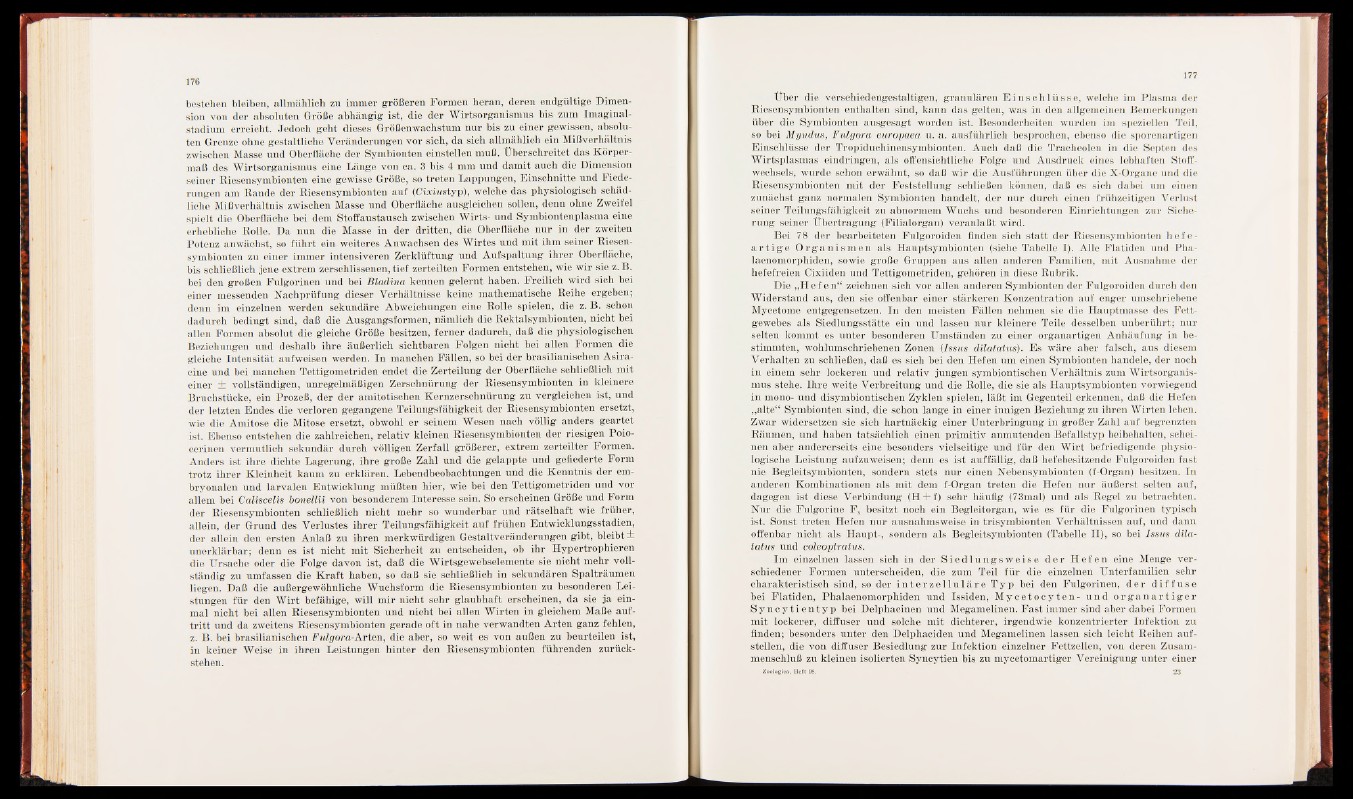
bestehen bleiben, allmählich zu immer größeren Formen heran, deren endgültige Dimension
von der absoluten Größe abhängig ist, die der Wirtsorganismus bis zum Imaginal-
stadium erreicht. Jedoch geht dieses Größenwachstum nur bis zu einer gewissen, absoluten
Grenze ohne gestaltliche Veränderungen vor sich, da sich allmählich ein Mißverhältnis
zwischen Masse und Oberfläche der Symhionten einstellen muß. Überschreitet das Körpermaß
des Wirtsorganismus eine Länge von ca. 3 bis 4 mm und damit auch die Dimension
seiner Riesensymbionten eine gewisse Größe, so treten Lappungen, Einschnitte und Fiederungen
am Rande der Riesensymbionten auf (Ctaiwstyp), welche das physiologisch schädliche
Mißverhältnis zwischen Masse und Oberfläche ausgleichen sollen, denn ohne Zweifel
spielt die Oberfläche bei dem Stoffaustausch zwischen Wirts- und Symbiontenplasma eine
erhebliche Rolle. Da nun die Masse in der dritten, die Oberfläche nur in der zweiten
Potenz anwächst, so füh rt ein weiteres Anwachsen des Wirtes und mit ihm seiner Riesensymbionten
zu einer immer intensiveren Zerklüftung und Aufspaltung ihrer Oberfläche,
bis schließlich jene extrem zerschlissenen,tief zerteilten Formen entstehen, wie wir sie z.B.
bei den großen Fulgorinen und bei Bladina kennen gelernt haben. Freilich wird sich bei
einer messenden Nachprüfung dieser Verhältnisse keine mathematische Reihe ergeben;
denn im einzelnen werden sekundäre Abweichungen eine Rolle spielen, die z. B. schon
dadurch bedingt sind, daß die Ausgangsformen, nämlich die Rektalsymbionten, nicht bei
allen Formen absolut die gleiche Größe besitzen, ferner dadurch, daß die physiologischen
Beziehungen und deshalb ihre äußerlich sichtbaren Folgen nicht bei allen Formen die
gleiche Intensität aufweisen werden. In manchen Fällen, so bei der brasilianischen Asira-
cine und bei manchen Tettigometriden endet die Zerteilung der Oberfläche schließlich mit
einer + vollständigen, unregelmäßigen Zerschnürung der Riesensymbionten in kleinere
Bruchstücke, ein Prozeß, der der amitotischen Kernzerschnürung zu vergleichen ist, und
der letzten Endes die verloren gegangene Teilungsfähigkeit der Riesensymbionten ersetzt,
wie die Amitose die Mitose ersetzt, obwohl er seinem Wesen nach völlig anders geartet
ist. Ebenso entstehen die zahlreichen, relativ kleinen Riesensymbionten der riesigen Poio-
cerinen vermutlich sekundär durch völligen Zerfall größerer, extrem zerteilter Formen.
Anders ist ihre dichte Lagerung, ihre große Zahl und die gelappte und gefiederte Form
trotz ihrer Kleinheit kaum zu erklären. Lebendbeobachtungen und die Kenntnis der embryonalen
und larvalen Entwicklung müßten hier, wie bei den Tettigometriden und vor
allem bei Caliscelis bonellii von besonderem Interesse sein. So erscheinen Größe und Form
der Riesensymbionten schließlich nicht mehr so wunderbar und rätselhaft wie früher,
allein, der Grund des Verlustes ihrer Teilungsfähigkeit auf frühen Entwicklungsstadien,
der allein den ersten Anlaß zu ihren merkwürdigen Gestaltveränderungen gibt, bleibt ±
unerklärbar; denn es ist nicht mit Sicherheit zu entscheiden, ob ihr Hypertrophieren
die Ursache oder die Folge davon ist, daß die Wirtsgewebselemente sie nicht mehr vollständig
zu umfassen die Kra ft haben, so daß sie schließlich in sekundären Spalträumen
liegen. Daß die außergewöhnliche Wuchsform die Riesensymbionten zu besonderen Leistungen
für den Wirt befähige, will mir nicht sehr glaubhaft erscheinen, da sie ja einmal
nicht bei allen Riesensymbionten und nicht bei allen Wirten in gleichem Maße auf-
tritt und da zweitens Riesensymbionten gerade oft in nahe verwandten Arten ganz fehlen,
z. B. bei brasilianischen Fulgora-Arten, die aber, so weit es von außen zu beurteilen ist,
in keiner Weise in ihren Leistungen hinter den Riesensymbionten führenden zurückstehen.
Über die verschiedengestaltigen, granulären E i n s c h l ü s s e , welche im Plasma der
Riesensymbionten enthalten sind, kann das gelten, was in den allgemeinen Bemerkungen
über die Symbionten ausgesagt worden ist. Besonderheiten wurden im speziellen Teil,
so bei Myndus, Fulgora europaea u. a. ausführlich besprochen, ebenso die sporenartigen
Einschlüsse der Tropiduchinensymbionten. Auch daß die Tracheolen in die Septen des
Wirtsplasmas eindringen, als offensichtliche Folge und Ausdruck eines lebhaften Stoffwechsels,
wurde schon erwähnt, so daß wir die Ausführungen über die X-Organe und die
Riesensymbionten mit der Feststellung schließen können, daß es sich dabei um einen
zunächst ganz normalen Symbionten handelt, der nur durch einen frühzeitigen Verlust
seiner Teilungsfähigkeit zu abnormem Wuchs und besonderen Einrichtungen zur Sicherung
seiner Übertragung (Filialorgan) veranlaßt wird.
Bei 78 der bearbeiteten Fulgoroiden finden sich sta tt der Riesensymbionten h e f e a
r t i g e Or g a n i sme n als Hauptsymbionten (siehe Tabelle I). Alle Flatiden und Pha-
laenomorphiden, sowie große Gruppen aus allen anderen Familien, mit Ausnahme der
hefefreien Cixiiden und Tettigometriden, gehören in diese Rubrik.
Die „ He f e n “ zeichnen sich vor allen anderen Symhionten der Fulgoroiden durch den
Widerstand aus, den sie offenbar einer stärkeren Konzentration auf enger umschriebene
Mycetome entgegensetzen. In den meisten Fällen nehmen sie die Hauptmasse des Fettgewebes
als Siedlungsstätte ein und lassen nur kleinere Teile desselben unberührt; nur
selten kommt es unter besonderen Umständen zu einer organartigen Anhäufung in bestimmten,
wohlumschriebenen Zonen (Issus dilatatus). Es wäre aber falsch, aus diesem
Verhalten zu schließen, daß es sich bei den Hefen um einen Symbionten handele, der noch
in einem sehr lockeren und relativ jungen symbiontischen Verhältnis zum Wirtsorganismus
stehe. Ih re weite Verbreitung und die Rolle, die sie als Hauptsymbionten vorwiegend
in mono- und disymbiontischen Zyklen spielen, läßt im Gegenteil erkennen, daß die Hefen
„alte“ Symbionten sind, die schon lange in einer innigen Beziehung zu ihren Wirten leben.
Zwar widersetzen sie sich hartnäckig einer Unterbringung in großer Zahl auf begrenzten
Räumen, und haben tatsächlich einen primitiv anmutenden Befallstyp beibehalten, scheinen
aber andererseits eine besonders vielseitige und fü r den Wirt befriedigende physiologische
Leistung auf zu weisen; denn es ist auffällig, daß hefebesitzende Fulgoroiden fast
nie Begleitsymbionten, sondern stets nur einen Nebensymbionten (f-Organ) besitzen. In
anderen Kombinationen als mit dem f-Organ treten die Hefen n ur äußerst selten auf,
dagegen ist diese Verbindung (H + f) sehr häufig (73mal) und als Regel zu betrachten.
Nur die Fulgorine F x besitzt noch ein Begleitorgan, wie es für die Fulgorinen typisch
ist. Sonst treten Hefen nur ausnahmsweise in trisymbionten Verhältnissen auf, und dann
offenbar nicht als Haupt-, sondern als Begleitsymbionten (Tabelle II), so bei Issus dilatatus
und coleoptratus.
Im einzelnen lassen sich in der S i e d l u n g swe i s e d e r He f e n eine Menge verschiedener
Formen unterscheiden, die zum Teil fü r die einzelnen Unterfamilien sehr
charakteristisch sind, so der i n t e r z e l l u l ä r e T y p bei den Fulgorinen, d e r d i f f u s e
bei Flatiden, Phalaenomorphiden und Issiden, My c e t o c y t e n - u n d o r g a n a r t i g e r
S y n c y t i e n t y p bei Delphacinen und Megamelinen. Fa st immer sind aber dabei Formen
mit lockerer, diffuser und solche mit dichterer, irgendwie konzentrierter Infektion zu
finden; besonders unter den Delphaciden und Megamelinen lassen sich leicht Reihen auf-
stellen, die von diffuser Besiedlung zur Infektion einzelner Fettzellen, von deren Zusammenschluß
zu kleinen isolierten Syncytien bis zu mycetomartiger Vereinigung unter einer
Zoologica, Heft 98. 2 3