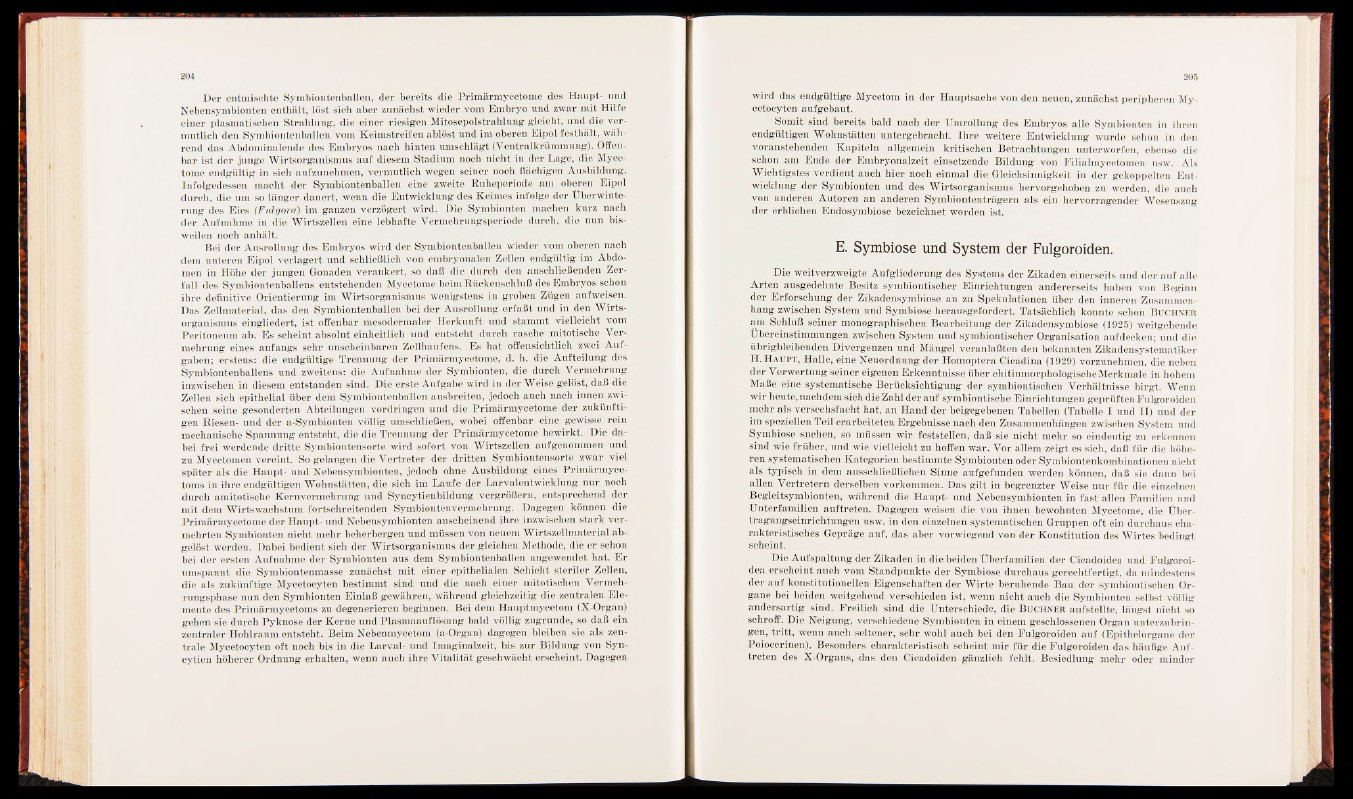
Der entmischte Symbiontenballen, der bereits die Primärmycetome des Haupt- und
Nebensymbionten enthält, löst sich aber zunächst wieder vom Embryo und zwar mit Hilfe
einer plasmatischen Strahlung, die einer riesigen Mitosepolstrahlung gleicht, und die vermutlich
den Symbiontenballen vom Keimstreifen ablöst und im oberen Eipol festbält, während
das Abdominalende des Embryos nach hinten umschlägt (Ventralkrümmung). Offenbar
ist der junge Wirtsorganismus auf diesem Stadium noch nicht in der Lage, die Myce-
tome endgültig in sich aufzunehmen, vermutlich wegen seiner noch flächigen Ausbildung.
Infolgedessen macht der Symbiontenballen eine zweite Ruheperiode am oberen Eipol
durch, die um so länger dauert, wenn die Entwicklung des Keimes infolge der Überwinterung
des Eies (Fulgora) im ganzen verzögert wird. Die Symbionten machen kurz nach
der Aufnahme in die Wirtszellen eine lebhafte Vermehrungsperiode durch, die nun bisweilen
noch anhält.
Bei der Ausrollung des Embryos wird der Symbiontenballen wieder vom oberen nach
dem unteren Eipol verlagert und schließlich von embryonalen Zellen endgültig im Abdomen
in Höhe der jungen Gonaden verankert, so daß die durch den anschließenden Zerfall
des Symbiontenballens entstehenden Mycetome beim Rückenschluß des Embryos schon
ihre definitive Orientierung im Wirtsorganismus wenigstens in groben Zügen aufweisen.
Das Zellmaterial, das den Symbiontenballen bei der Ausrollung erfaßt und in den Wirtsorganismus
eingliedert, ist offenbar mesodermaler Herkunft und stammt vielleicht vom
Peritoneum ab. Es scheint absolut einheitlich und entsteht durch rasche mitotische Vermehrung
eines anfangs sehr unscheinbaren Zellhaufens. Es hat offensichtlich zwei Aufgaben;
erstens: die endgültige Trennung der Primärmycetome, d. h. die Aufteilung des
Symbiontenballens und zweitens: die Aufnahme der Symbionten, die durch Vermehrung
inzwischen in diesem entstanden sind. Die erste Aufgabe wird in der Weise gelöst, daß die
Zellen sich epithelial über dem Symbiontenballen ausbreiten, jedoch auch nach innen zwischen
seine gesonderten Abteilungen Vordringen und die Primärmycetome der zukünftigen
Riesen- und der a-Symbionten völlig umschließen, wobei offenbar eine gewisse rein
mechanische Spannung entsteht, die die Trennung der Primärmycetome bewirkt. Die dabei
frei werdende dritte Symbiontensorte wird sofort von Wirtszellen auf genommen und
zu Mycetomen vereint. So gelangen die Vertreter der dritten Symbiontensorte zwar viel
später als die Haupt- und Nebensymbionten, jedoch ohne Ausbildung eines Primärmyce-
toms in ihre endgültigen Wohnstätten, die sich im Laufe der Lar valent wicklung nur noch
durch amitotische Kernvermehrung und Syncytienbildung vergrößern, entsprechend der
mit dem Wirtswachstum fortschreitenden Symbionten Vermehrung. Dagegen können die
Primärmycetome der H aupt- und Nebensymbionten anscheinend ihre inzwischen stark vermehrten
Symbionten nicht mehr beherbergen und müssen von neuem W irtszellmaterial abgelöst
werden. Dabei bedient sich der Wirtsorganismus der gleichen Methode, die er schon
bei der ersten Aufnahme der Symbionten aus dem Symbiontenballen angewendet hat. Er
umspannt die SymbiontenmaSse zunächst mit einer epithelialen Schicht steriler Zellen,
die als zukünftige Mycetocyten bestimmt sind und die nach einer mitotischen Vermehrungsphase
nun den Symbionten Einlaß gewähren, während gleichzeitig die zentralen Elemente
des Primärmycetoms zu degenerieren beginnen. Bei dem Hauptmycetom (X-Organ)
gehen sie durch Pyknose der Kerne und Plasmaauflösung bald völlig zugrunde, so daß ein
zentraler Hohlraum entsteht. Beim Nebenmycetom (a-Organ) dagegen bleiben sie als zentrale
Mycetocyten oft noch bis in die Larval- und Imaginalzeit, bis zur Bildung von Syn-
cytien höherer Ordnung erhalten, wenn auch ihre V italität geschwächt erscheint. Dagegen
wird das endgültige Mycetom in der Hauptsache von den neuen, zunächst peripheren Mycetocyten
aufgebaut.
Somit sind bereits bald nach der Umrollung des Embryos alle Symbionten in ihren
endgültigen Wohnstätten untergebracht. Ihre weitere Entwicklung wurde schon in den
voransteh enden Kapiteln allgemein kritischen Betrachtungen unterworfen, ebenso die
schon am Ende der Embryonalzeit einsetzende Bildung von Filialmycetomen usw. Als
Wichtigstes verdient auch hier noch einmal die Gleichsinnigkeit in der gekoppelten Entwicklung
der Symbionten und des Wirtsorganismus hervorgehoben zu werden, die auch
von anderen Autoren an anderen Symbiontenträgern als ein hervorragender Wesenszug
der erblichen Endosymbiose bezeichnet worden ist.
E. Symbiose und System der Fulgoroiden.
Die weitverzweigte Aufgliederung des Systems der Zikaden einerseits und der auf alle
Arten ausgedehnte Besitz symbiontischer Einrichtungen andererseits haben von Beginn
der Erforschung der Zikadensymbiose an zu Spekulationen über den inneren Zusammenhang
zwischen System und Symbiose herausgefordert. Tatsächlich konnte schon B ü c h n e r
am Schluß seiner monographischen Bearbeitung der Zikadensymbiose (1925) weitgehende
Übereinstimmungen zwischen System und symbiontischer Organisation auf decken; und die
übrigbleibenden Divergenzen und Mängel veranlaßten den bekannten Zikadensystematiker
H. H aupt, Halle, eine Neuordnung der Homoptera Cicadina (1929) vorzunehmen, die neben
der Verwertung seiner eigenen Erkenntnisse über chitinmorphologische Merkmale in hohem
Maße eine systematische Berücksichtigung der symbiontischen Verhältnisse birgt. Wenn
wir heute, nachdem sich die Zahl der auf 'Symbiontfsche Einrichtungen geprüften Fulgoroiden
mehr als versechsfacht hat, an Hand der beigegebenen Tabellen (Tabelle I und II) und der
im speziellen Teil erarbeiteten Ergebnisse nach den Zusammenhängen zwischen System und
Symbiose'suchen, so müssen wir feststellen, daß sie nicht mehr so eindeutig zu erkennen
sind wie früher, und wie vielleicht zu hoffen war. Vor allem zeigt es sich, daß für die höheren
Systematischen Kategorien bestimmte Symbionten oder Symbiontenkombinationen nicht
als typisch in dem ausschließlichen Sinne aufgefunden werden können, daß sie dann bei
allen Vertretern derselben Vorkommen. Das gilt in begrenzter Weise nur für die einzelnen
Begleitsymbionten, während die Haupt- und Nebensymbionten in fast allen Familien und
Kntcrfamilien auf treten. Dagegen weisen die von ihnen bewohnten Mycetome, die Übertragungseinrichtungen
usw. in den einzelnen systematischen Gruppen oft ein durchaus charakteristisches
Gepräge auf, das aber vorwiegend von der Konstitution des Wirtes bedingt
scheint.
Die Aufspaltung der Zikaden in die beiden Überfamilien der Cicadoidea und Fulgoroi-
dea erscheint auch vom Standpunkte der Symbiose durchaus gerechtfertigt, da mindestens
der auf konstitutionellen Eigenschaften der Wirte beruhende Bau der symbiontischen Organe
hei beiden weitgehend verschieden ist, wenn nicht auch die Symbionten seihst völlig
andersartig sind. Freilich sind die Unterschiede, die B ü c h n e r aufstellte, längst nicht so
schroff. Die Neigung, verschiedene Symbionten in einem geschlossenen Organ unterzubringen,
tritt, wenn auch seltener, sehr wohl auch bei den Fulgoroiden auf (Epithelorgane der
Poiocerinen). Besonders charakteristisch scheint mir für die Fulgoroiden das häufige Auftreten
des X-Organs, das den Cieadoiden gänzlich fehlt. Besiedlung mehr oder minder