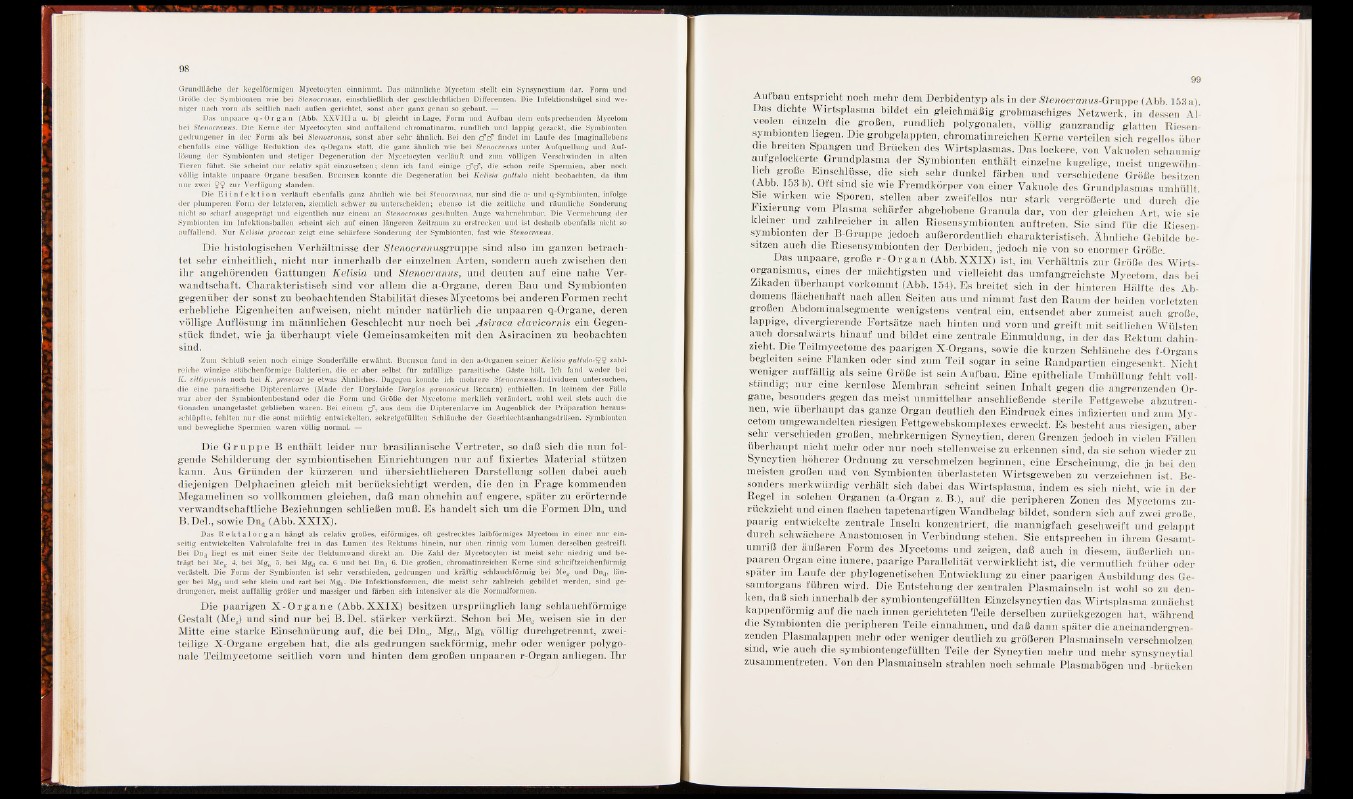
Grundfläche der kegelförmigen Mycetocyten einnimmt. Das männliche Mycetom stellt ein Synsyncytium dar. Form und
Größe der Symbionien wie bei Stenocranus, einschließlich der geschlechtlichen Differenzen. Die Infektionshügel sind weniger
nach vorn als seitlich nach außen gerichtet, sonst aber ganz genau so gebaut.
Das unpaare q - 0 r g a n (Abb. XXVIII a u. b) gleicht in Lage, Form und Aufbau dem entsprechenden Mycetom
bei Stenocranus. Die Kerne der Mycetocyten sind auffallend chromatinarm, rundlich und lappig gezackt, die Symbionten
gedrungener in der Form als bei Stenocranus, sonst aber sehr ähnlich. Bei den f f findet im Laufe des Imaginallebens
ebenfalls eine völlige Reduktion des q-Organs statt, die ganz ähnlich wie bei Stenocranus unter Aufquellung und Auflösung
der Symbionten und stetiger Degeneration der Mycetocyten verläuft und zum völligen Verschwinden in alten
Tieren führt. Sie scheint nur relativ spät einzusetzen; denn ich fand einige c f cf, die schon reife Spermien, aber noch
völlig intakte unpaare Organe besaßen. Bü ch n er konnte die Degeneration bei Kelisia guttula nicht beobachten, da ihm
n ur zwei $ $ zur Verfügung standen.
Die E i i n f e k t i o n verläuft ebenfalls ganz ähnlich wie bei Stenocranus, nur sind die a- und q-Symbionten, infolge
der plumperen Form der letzteren, ziemlich schwer zu unterscheiden; ebenso ist die zeitliche und räumliche Sonderung
nicht so scharf ausgeprägt und eigentlich nur einem an Stenocranus geschulten Auge wahrnehmbar. Die Vermehrung der
Symbionten im Infektionsballen scheint sich auf einen längeren Zeitraum zu erstrecken und ist deshalb ebenfalls nicht so
auffallend. Nur Kelisia praecox zeigt eine schärfere Sonderung der Symbionten, fast wie Stenocranus.
Die histologischen Verhältnisse der Stenocranusgruppe sind also im ganzen betrachtet
sehr einheitlich, nicht nur innerhalb der einzelnen Arten, sondern auch zwischen den
ih r angehörenden Gattungen Kelisia und Stenocranus, und deuten auf eine nahe Verwandtschaft.
Charakteristisch sind vor allem die a-Organe, deren Bau und Symbionten
gegenüber der sonst zu beobachtenden Stabilität dieses Mycetoms bei anderen Formen recht
erhebliche Eigenheiten aufweisen, nicht minder natürlich die unpaaren q-Organe, deren
völlige Auflösung im männlichen Geschlecht nur noch bei Asiraca clavicornis ein Gegenstück
findet, wie ja überhaupt viele Gemeinsamkeiten mit den Asiracinen zu beobachten
sind.
Zum Schluß seien noch einige Sonderfälle erwähnt. Büch n er fand in den a-Organen seiner Kelisia guttula-QQ zahlreiche
winzige stäbchenförmige Bakterien, die er aber selbst für zufällige parasitische Gäste hält. Ich fand weder bei
K. vittipennis noch bei K. praecox je etwas Ähnliches. Dagegen konnte ich mehrere Sienocramts-Individuen untersuchen,
die eine parasitische Dipterenlarve (Made der Dorylaide Dorylas pannonicus B e ck e r ) enthielten. In keinem der Fälle
war aber der Symbiontenbestand oder die Form und Größe der Mycetome merklich verändert, wohl weil stets auch die
Gonaden unangetastet geblieben waren. Bei einem f , aus dem die Dipterenlarve im Augenblick der Präparation herausschlüpfte,
fehlten nur die sonst mächtig entwickelten, sekretgefüllten Schläuche der Geschlechtsanhangsdrüsen. Symbionten
und bewegliche Spermien waren völlig normal. —
Die Gr u p p e B enthält leider nur brasilianische Vertreter, so daß sich die nun folgende
Schilderung der symbiontischen Einrichtungen nur auf fixiertes Material stützen
kann. Aus Gründen der kürzeren und übersichtlicheren Darstellung sollen dabei auch
diejenigen Delphacinen gleich mit berücksichtigt werden, die den in Frage kommenden
Megamelinen so vollkommen gleichen, daß man ohnehin auf engere, später zu erörternde
verwandtschaftliche Beziehungen schließen muß. Es handelt sich um die Formen Dlna und
B.Del., sowie Dnd (Abb. XXIX).
Das R e k t a l o r g a n hängt als relativ großes, eiförmiges, oft gestrecktes laibförmiges Mycetom in einer nur einseitig
entwickelten Valvulafalte frei in das Lumen des Rektums hinein, nur oben rinnig vom Lumen derselben gestreift.
Bei Dnd liegt es mit einer Seite der Rektumwand direkt an. Die Zahl der Mycetocyten ist meist sehr niedrig und beträgt
bei Meg 4, bei Mgn 5, bei Mgd ca. 6 und bei Dnd 6. Die großen, chromatinreichen Kerne sind schriftzeichenförmig
verästelt. Die Form der Symbionten ist sehr verschieden, gedrungen und kräftig schlauchförmig bei Meg und Dnd, länger
bei Mgd und sehr klein und zart bei Mgh. Die Infektionsformen, die meist sehr zahlreich gebildet werden, sind gedrungener,
meist auffällig größer und massiger und färben sich intensiver als die Normalformen.
Die paarigen X-O r g a n e (Abb.XXIX) besitzen ursprünglich lang schlauchförmige
Gestalt (Meg) und sind nur bei B.Del. stärker verkürzt. Schon bei Meg weisen sie in der
Mitte eine starke Einschnürung auf, die bei Dlna, Mgd, Mgh völlig durchgetrennt, zweiteilige
X-Organe ergeben hat, die als gedrungen sackförmig, mehr oder weniger polygonale
Teilmycetome seitlich vorn und hinten dem großen unpaaren r-Organ anliegen. Ih r
Aufbau entspricht noch mehr dem Derbidentyp als in der Stenocranus-Gruppe (Abb. 153 a).
Das dichte Wirtsplasma bildet ein gleichmäßig grobmaschiges Netzwerk, in dessen Al-
veolen einzeln die großen, rundlich polygonalen, völlig ganzrandig glatten Riesen-
pgymbionten liegen. Die grobgelappten, chromatinreichen Kerne verteilen sich regellos über
die breiten Spangen und Brücken des Wirtsplasmas. Das lockere, von Vakuolen schaumig
aufgelockerte Grundplasma der Symbionten enthält einzelne kugelige, meist ungewöhnlich
große Einschlüsse, die sich sehr dunkel färben und verschiedene Größe besitzen
(Abb. 153 b). Oft sind sie wie,Fremdkörper von einer Vakuole des Grundplasmas umhüllt.
Sie wirken wie Sporen, stellen aber zweifellos nur stark vergrößerte und durch die
Fixierung vom Plasma sehärfer abgehobene Granula dar, von der gleichen Art, wie sie
kleiner und zahlreicher in allen Riepnsymbionten auftreten. Sie. sind fü r die Riesen-
symbionten der B-Gruppe jedoch außerordentlich charakteristisch. Ähnliche Gebilde bes
i t z » auch die Riesensymbionten der Derbiden, jedoch nie von so enormer Größe.
Das unpaare, große r - O r g a n (Abb.XXIX) ist, im Verhältnis zur Größe des Wirtsorganismus,
eines der mächtigsten und vielleicht das umfangreichste Mycetom, das bei
Zikaden überhaupt vorkommt (Abb. 154). Es breitet sieh in der hinteren H ä lfte ’des Abdomens
flächenhaft nach allen Seiten aus und nimmt fast den Raum der beiden vorletzten
großen Abdominalsegmente wenigstens ventral ein, entsendpi aber zumeist auch große,
lappige, divergierende Fortsätze nach hinten und vorn und greift mit Seitlichen Wülsten
auch dorsalwärts hinauTjjind bildet eine zentrale Einmuldung, in der das Rektum dahin-
Zieht. Die Teilmycetome des paarigen X-Organs, sowie: die kurzen Schläuche des f-Organs
begleiten seine' F lanken oder sind zum Teil sogar in seine Randpartien eingesenkt. Nicht
weniger auffällig als seine Größe S t sgin Aufbau. Eine epitheliale Umhüllung fehlt vollständig;
nur eine kernlose Membran scheint seinen Inhalt gegen die angrenzenden Organe,
besonders gegen das m ^ t unmittelbar , anschließende sterile Fettgewebe abzutrennen,
wie überhaupt das ganze Organ deutlich den E in d p b k eines infizierten und zum Mycetom
umgewandelten riesigen Fettgewebskomplexes erweckt. Es besteht aus riesigen, aber
sehr verschieden großen, mehrkernigen Syneytien, deren Grenzen jedoch in vielen Fällen
überhaupt nicht mehr oder nur. noch stellenweise zu erkennen sind, da^feschon wieder zu
Sypcytien höherer Ordnung zu verschmelzen b e g in n e n lfe e Erscheinung, die ja bei den
meisten großen und von Symbionten überlasteten Wirtsgeweben zu verzeichnen ist. Besonders
merkwürdig verhält Sieh dabei das Wirtsplasma, indem es. sich nicht, wie in der
Regel in solchen Organen (a-Organ z.B.), auf die peripheren Zonen des Mycetoms zurückzieht
und einen flachen tapetenartigen Wandbelag bildet, sondern sich auf zwei große,
paarig entwickelte zentrale Inseln konzentriert, die mannigfach geschweift und gelappt
durch schwächere Anastomosen in Verbindung stehen. Sie entsprechen in ihrem Gesamtumriß
der äußeren Form des Mycetoms und zeigen, daß auch in diesem, äußerlich unpaaren
Organ eine innere, paarige Parallelität verwirklicht ist, die vermutlich früher oder
später im Laufe der phylogenetischen Entwicklung zu einer paarigen Ausbildung des Gesamtorgans
führen wird. Die Entstehung der zentralen Plasmainseln ist wohl so zu denken,
daß sich innerhalb der symbiontengefüllten Einzelsyncytien das Wirtsplasma zunächst
kappenförmig auf die nach innen gerichteten Teile derselben zurückgezogen hat, während
die Symbionten die peripheren Teilepmnahmen, und daß dann später die aneinandergrenzenden
Plasmalappen mehr oder weniger deutlich zu größeren Plasmainseln verschmolzen
sind, wie auch die symbiontenpÄiHten Teile der Syneytien mehr und mehr synsyncytial
zusammentreten. Von den Plasmainseln strahlen noch schmale Plasmabögen und -brücken