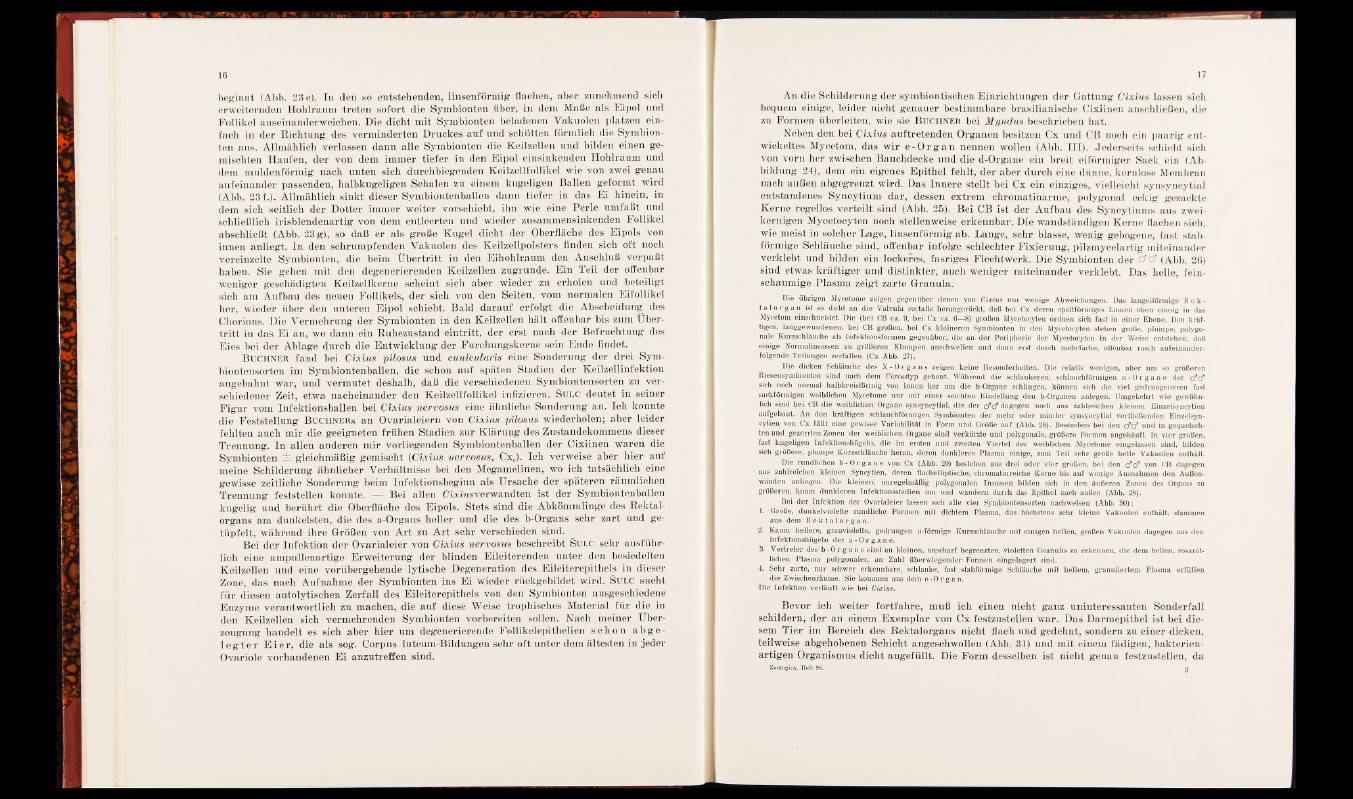
beginnt (Abb. 23 e). In den so entstehenden, linsenförmig flachen, aber zunehmend sich
erweiternden Hohlraum treten sofort die Symbionten über, in dem Maße als Eipol und
Follikel auseinanderweichen. Die dicht mit Symbionten beladenen Vakuolen platzen einfach
in der Richtung des verminderten Druckes auf und schütten förmlich die Symbionten
aus. Allmählich verlassen dann alle Symbionten die Keilzellen und bilden einen gemischten
Haufen, der von dem immer tiefer in den Eipol einsinkenden Hohlraum und
dem muldenförmig nach unten sich durchbiegenden Keilzellfollikel wie von zwei genau
aufeinander passenden, halbkugeligen Schalen zu einem kugeligen Ballen geformt wird
(Abb. 23 f.). Allmählich sinkt dieser Symbiontenballen dann tiefer in das Ei hinein, in
dem sich seitlich der Dotter immer weiter vorschiebt, ihn wie eine Perle umfaßt und
schließlich irisblendenartig von dem entleerten und wieder zusammensinkenden Follikel
abschließt (Abb. 23 g), so daß er als große Kugel dicht der Oberfläche des Eipols von
innen anliegt. In den schrumpfenden Vakuolen des Keilzellpolsters finden sich oft noch
vereinzelte Symbionten, die beim Übertritt in den Eihohlraum den Anschluß verpaßt
haben. Sie gehen mit den degenerierenden Keilzellen zugrunde. Ein Teil der offenbar
weniger geschädigten Keilzellkerne scheint sich aber wieder zu erholen und beteiligt
sich am Aufbau des neuen Follikels, der sich von den Seiten, vom normalen Eifollikel
her, wieder über den unteren Eipol schiebt. Bald darauf erfolgt die Abscheidung des
Chorions. Die Vermehrung der Symbionten in den Keilzellen hält offenbar bis zum Übertritt
in das E i an, wo dann ein Ruhezustand eintritt, der erst nach der Befruchtung des
Eies bei der Ablage durch die Entwicklung der Furchungskerne sein Ende findet.
B ü c h n e r fand bei Cixius pilosus und cunicularis eine Sonderung der drei Sym-
biontensorten im Symbiontenballen, die schon auf späten Stadien der Keilzellinfektion
angebahnt war, und vermutet deshalb, daß die verschiedenen Symbiontensorten zu verschiedener
Zeit, etwa nacheinander den Keilzellfollikel infizieren. ÖULC deutet in seiner
Figur vom Infektionsballen bei Cixius nervosus eine ähnliche Sonderung an. Ich konnte
die Feststellung B ü ch n er s an Ovarialeiern von Cixius pilosus wiederholen; aber leider
fehlten auch mir die geeigneten frühen Stadien zur Klärung des Zustandekommens dieser
Trennung. In allen anderen mir vorliegenden Symbiontenballen der Cixiinen waren die
Symbionten gleichmäßig gemischt (<Cixius nervosus, Cxc). Ich verweise aber hier auf
meine Schilderung ähnlicher Verhältnisse bei den Megamelinen, wo ich tatsächlich eine
gewisse zeitliche Sonderung beim Infektionsbeginn als Ursache der späteren räumlichen
Trennung feststellen konnte. v ^JB ei allen Cixiwsverwandten ist der Symbiontenballen
kugelig und berührt die Oberfläche des Eipols. Stets sind die Abkömmlinge des Rektalorgans
am dunkelsten, die des a-Organs heller und die des b-Organs sehr zart und getüpfelt,
während ihre Größen von Art zu Art sehr verschieden sind.
Bei der Infektion der Ovarialeier von Cixius nervosus beschreibt Su l c sehr ausführlich
eine ampullenartige Erweiterung der blinden Eileiterenden unter den besiedelten
Keilzellen und eine vorübergehende lytische Degeneration des Eileiterepithels in dieser
Zone, das nach Aufnahme der Symbionten ins Ei wieder rückgebildet wird. S u l c sucht
für diesen autolytischen Zerfall des Eileiterepithels von den Symbionten ausgeschiedene
Enzyme verantwortlich zu machen, die auf diese Weise trophisches Material für die in
den Keilzellen sich vermehrenden Symbionten vorbereiten sollen. Nach meiner Überzeugung
handelt es sich aber hier um degenerierende Follikelepithelien s c h o n a b g e l
e g t e r Ei e r , die als sog. Corpus luteum-Bildungen sehr oft unter dem ältesten in jeder
Ovariole vorhandenen Ei anzutreffen sind.
An die Schilderung der symbiontischen Einrichtungen der Gattung Cixius lassen sich
bequem einige, leider nicht genauer bestimmbare brasilianische Cixiinen anschließen, die
zu Formen überleiten, wie sie B ü c h n e r bei Myndus beschrieben hat.
Neben den bei Cixius auf tretenden Organen besitzen Cx und CB noch ein paarig entwickeltes
Mycetom, das wir e - O r g a n nennen wollen (Abb. III). Jederseits schiebt sich
von vorn her zwischen Bauchdecke und die d-Organe ein breit eiförmiger Sack ein (Abbildung
24), dem ein eigenes Epithel fehlt, der aber durch eine dünne, kernlose Membran
nach außen abgegrenzt wird. Das Innere stellt bei Cx ein einziges, vielleicht synsyncytial
entstandenes Syncytium dar, dessen extrem chromatinarme, polygonal eckig gezackte
Kerne regellos verteilt sind (Abb. 25). Bei CB ist der Aufbau des Syncytiums aus zweikernigen
Mycetocyten noch stellenweise erkennbar. Die wandständigen Kerne flachen sich,
wie meist in solcher Lage, linsenförmig ab. Lange, sehr blasse, wenig gebogene, fast stabförmige
Schläuche sind, offenbar infolge schlechter Fixierung, pilzmycelartig miteinander
verklebt und bilden ein lockeres, fasriges Flechtwerk. Die Symbionten der Cf Cf (Abb. 26)
sind etwas kräftiger und distinkter, auch weniger miteinander verklebt. Das helle, feinschaumige
Plasma zeigt zarte Granula.
Die übrigen Mycetome zeigen gegenüber denen von Cixius nur wenige Abweichungen. Das langeiförmige Re k -
t a l o r g a n ist so dicht an die Valvula rectalis herangerückt, daß bei Cx deren spaltförmiges Lumen oben rinnig in das
Mycetom einscbneidet. Die (bei CB ca. 9, bei Cx ca. 6—8) großen Mycetocyten ordnen sich fast in einer Ebene. Den kräftigen,
langgewundenen, bei CB großen, bei Cx kleineren Symbionten in den Mycetocyten stehen große, plumpe, polygonale
Kurzschläuche als Infektionsformen gegenüber, die an der Peripherie der Mycetocyten in der Weise entstehen, daß
einige Normalinsassen zu größeren Klumpen anschwellen und dann erst durch mehrfache, offenbar rasch aufeinanderfolgende
Teilungen zerfallen (Cx Abb. 27).
Die dicken Schläuche des X- Or g a n s zeigen keine Besonderheiten. Die relativ wenigen, aber um so größeren
Riesensymbionten sind nach dem Cixius typ gebaut. Während die schlankeren, schlauchförmigen a - O r g a n e der cf cf
sich noch normal halbkreisförmig von innen her um die b-Organe schlingen, können sich die viel gedrungeneren fast
sackförmigen weiblichen Mycetome nur mit einer seichten Eindellung den b-Organen anlegen. Umgekehrt wie gewöhnlich
sind bei CB die weiblichen Organe synsyncytial, die der cf cf dagegen noch aus zahlreichen kleinen Einzelsyncytien
aufgebaut. An den kräftigen schlauchförmigen Symbionten der mehr oder minder synsyncytial verfließenden Einzelsyncytien
von Cx fällt eine gewisse Variabilität in Form und Größe auf (Abb. 28). Besonders bei den cf cf und in gequetschten
und gezerrten Zonen der weiblichen Organe sind verkürzte und polygonale, größere Formen angehäuft. In vier großen,
fast kugeligen Infektionshügeln, die im ersten und zweiten Viertel der weiblichen Mycetome eingelassen sind, bilden
sich größere, plumpe Kurzschläuche heran, deren dunkleres Plasma einige, zum Teil sehr große helle Vakuolen enthält.
Die rundlichen b - O r g a n e von Cx (Abb. 29) bestehen aus drei oder vier großen, bei den cf cf von CB dagegen
aus zahlreichen kleinen Syncytien, deren flachelliptische, chromatinreiche Kerne bis auf wenige Ausnahmen den Außenwänden
anliegen. Die kleinen, unregelmäßig polygonalen Insassen bilden sich in den äußeren Zonen des Organs zu
größeren, kaum dunkleren Infektionsstadien um und wandern durch das Epithel nach außen (Abb. 28).
Bei der Infektion der Ovarialeier lassen sich alle vier Symbiontensorten nachweisen (Abb. 30):
1. Große, dunkelviolette rundliche Formen mit dichtem Plasma, das höchstens sehr kleine Vakuolen enthält, stammen
aus dem Re k t a l o r g a n .
2. Kaum hellere, grauviolette, gedrungen u-förmige Kurzschläuche mit einigen hellen, großen Vakuolen dagegen aus den
Infektionshügeln der a -Or g a n e .
3. Vertreter des b -Or g a n s sind an kleinen, unscharf begrenzten, violetten Granulis zu erkennen, die dem hellen, rosarötlichen
Plasma polygonaler, an Zahl überwiegender Formen eingelagert sind.
4. Sehr zarte, nur schwer erkennbare, schlanke, fast stabförmige Schläuche mit hellem, granuliertem Plasma erfüllen
die Zwischenräume. Sie kommen aus dem e-Or gan.
Die Infektion verläuft wie bei Cixius.
Bevor ich weiter fortfahre, muß ich einen nicht ganz uninteressanten Sonderfall
schildern, der an einem Exemplar von Cx festzustellen war. Das Darmepithel ist bei diesem
Tier im Bereich des Rektalorgans nicht flach und gedehnt, sondern zu einer dicken,
teilweise abgehobenen Schicht angeschwollen (Abb. 31) und mit einem fädigen, bakterienartigen
Organismus dicht angefüllt. Die Form desselben ist nicht genau festzustellen, da
Zoologica, Heft 98. g