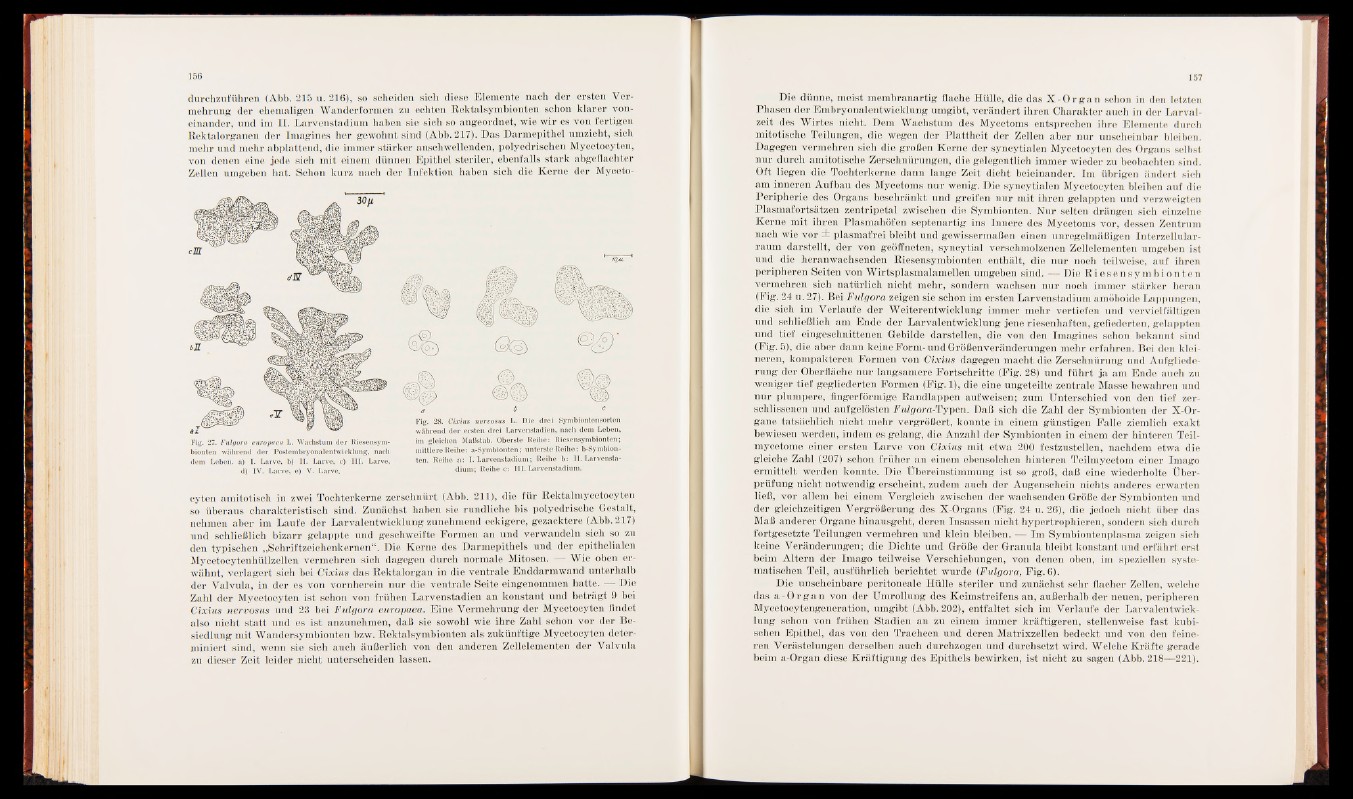
durchzuführen (Abb. 215 u. 216), so scheiden sich diese Elemente nach der ersten Vermehrung
der ehemaligen Wanderformen zu echten Rektalsymbionten schon klarer voneinander,
und im II. Larvenstadium haben sie sich so angeordnet, wie wir es von fertigen
Rektalorganen der Imagines her gewohnt sind (Abb. 217). Das Darmepithel umzieht, sich
mehr und mehr abplattend, die immer stärker anschwellenden, polyedrischen Mycetocyten,
von denen eine jede sich mit einem dünnen Epithel steriler, ebenfalls stark abgeflachter
Zellen umgeben hat. Schon kurz nach der Infektion haben sich die Kerne der Mycetoa
* c
Fig. 28. Cixius nervosus L. Die drei Symbiontensorten
während der ersten drei Larvenstadien, nach dem Leben,
im gleichen Maßstab. Oberste Reihe: Riesensymbionten;
mittlere Reihe: a-Symbionten; unterste Reihe: b-Symbion-
ten. Reihe a: I. Larvenstadium; Reihe b: II. Larvenstadium;
Reihe c: I
Fig. 27. Fulgora europaea L. Wachstum der Riesensymbionten
während der Postembryonalentwicklung, nach
dem Leben, a) I. Larve, b) II. Larve, c) III. Larve,
d) IV. Larve, e) V. Larve.
cyten amitotisch in zwei Tochterkerne zerschnürt (Abb. 211), die für Rektalmycetocyten
so überaus charakteristisch sind. Zunächst haben sie rundliche bis polyedrische Gestalt,
nehmen aber im Laufe der Larvalentwicklung zunehmend eckigere, gezacktere (Abh. 217)
und schließlich bizarr gelappte und geschweifte Formen an und verwandeln sich so zu
den typischen „Schriftzeichenkernen“ . Die Kerne des Darmepithels und der epithelialen
Mycetocytenhüllzellen vermehren sich dagegen durch normale Mitosen. — Wie oben erwähnt,
verlagert sich bei Cixius das Rektalorgan in die ventrale Enddarmwand unterhalb
der Valvula, in der es von vornherein nur die ventrale Seite eingenommen hatte. — Die
Zahl der Mycetocyten ist schon von frühen Larvenstadien an konstant und beträgt 9 hei
Cixius nervosus und 23 bei Fulgora europaea. Eine Vermehrung der Mycetocyten findet
also nicht sta tt und es ist anzunehmen, daß sie sowohl wie ihre Zahl schon vor der Besiedlung
mit Wandersymbionten bzw. Rektalsymbionten als zukünftige Mycetocyten determiniert
sind, wenn sie sich auch äußerlich von den anderen Zellelementen der Valvula
zu dieser Zeit leider nicht unterscheiden lassen.
Die dünne, meist membranartig flache Hülle, die das X -O r g a n schon in den letzten
Phasen der Embryonalentwicklung umgibt, verändert ihren Charakter auch in der Larvalzeit
des Wirtes nicht. Dem Wachstum des Mycetoms entsprechen ihre Elemente durch
mitotische Teilungen, die wegen der Plattheit der Zellen aber nur unscheinbar bleiben.
Dagegen vermehren sich die großen Kerne der syncytialen Mycetocyten des Organs selbst
nur durch amitotische Zerschnürungen, die gelegentlich immer wieder zu beobachten sind.
Oft liegen die Tochterkerne dann lange Zeit dicht beieinander. Im übrigen ändert sich
am inneren Aufbau des Mycetoms nur wenig. Die syncytialen Mycetocyten bleiben auf die
Peripherie des Organs beschränkt und greifen nur mit ihren gelappten und verzweigten
Plasmafortsätzen zentripetal zwischen die Symbionten. Nur selten drängen sich einzelne
Kerne mit ihren Plasmahöfen septenartig ins Innere des Mycetoms vor, dessen Zentrum
nach wie vor ± plasmafrei bleibt und gewissermaßen einen unregelmäßigen Interzellularraum
darstellt, der von geöffneten, syncytial verschmolzenen Zellelementen umgeben ist
und die heranwachsenden Riesensymbionten enthält, die nur noch teilweise, auf ihren
peripheren Seiten von Wirtsplasmalamellen umgeben sind. — Die R i e s e n s ymb i o n t e n
vermehren sich natürlich nicht mehr, sondern wachsen nur noch immer stärker heran
(Fig. 24 u. 27). Bei Fulgora zeigen sie schon im ersten Larvenstadium amöboide Lappungen,
die sich im Verlaufe der Weiterentwicklung immer mehr vertiefen und vervielfältigen
und schließlich am Ende der Larvalentwicklung jene riesenhaften, gefiederten, gelappten
und tief eingeschnittenen Gebilde darstellen, die von den Imagines schon bekannt sind
(Fig. 5), die aber dann keine Form-und Größenveränderungen mehr erfahren. Bei den kleineren,
kompakteren Formen von Cixius dagegen macht die Zerschnürung und Aufgliederung
der Oberfläche nur langsamere Fortschritte (Fig. 28) und fü hrt ja am Ende auch zu
weniger tief gegliederten Formen (Fig. 1), die eine ungeteilte zentrale Masse bewahren und
nu r plumpere, fingerförmige Randlappen auf weisen; zum Unterschied von den tief zerschlissenen
und aufgelösten Fulgora-Typen. Daß sich die Zahl der Symbionten der X-Or-
gane tatsächlich nicht mehr vergrößert, konnte in einem günstigen Falle ziemlich exakt
bewiesen werden, indem es gelang, die Anzahl der Symbionten in einem der hinteren Teil-
mycetome einer ersten Larve von Cixius mit etwa 200 festzustellen, nachdem etwa die
gleiche Zahl (207) schon früher an einem ebensolchen hinteren Teilmycetom einer Imago
ermittelt werden konnte. Die Übereinstimmung ist so groß, daß eine wiederholte Überprüfung
nicht notwendig erscheint, zudem auch der Augenschein nichts anderes erwarten
ließ, vor allem bei einem Vergleich zwischen der wachsenden Größe der Symbionten und
der gleichzeitigen Vergrößerung des X-Organs (Fig. 24 u. 26), die jedoch nicht über das
Maß anderer Organe hinausgeht, deren Insassen nicht hypertrophieren, sondern sich durch
fortgesetzte Teilungen vermehren und klein bleiben. — Im Symbiontenplasma zeigen sich
keine Veränderungen; die Dichte und Größe der Granula bleibt konstant und erfährt erst
heim Altern der Imago teilweise Verschiebungen, von denen oben, im speziellen systematischen
Teil, ausführlich berichtet wurde {Fulgora, Fig. 6).
Die unscheinbare peritoneale Hülle steriler und zunächst sehr flacher Zellen, welche
das a - O r g a n von der Umrollung des Keimstreifens an, außerhalb der neuen, peripheren
Mycetocytengeneration, umgibt (Abh. 202), entfaltet sich im Verlaufe der Larvalentwicklung
schon von frühen Stadien an zu einem immer kräftigeren, stellenweise fast kubischen
Epithel, das von den Tracheen und deren Matrixzellen bedeckt und von den feineren
Verästelungen derselben auch durchzogen und durchsetzt wird. Welche Kräfte gerade
beim a-Organ diese Kräftigung des Epithels bewirken, ist nicht zu sagen (Abb. 218—221).