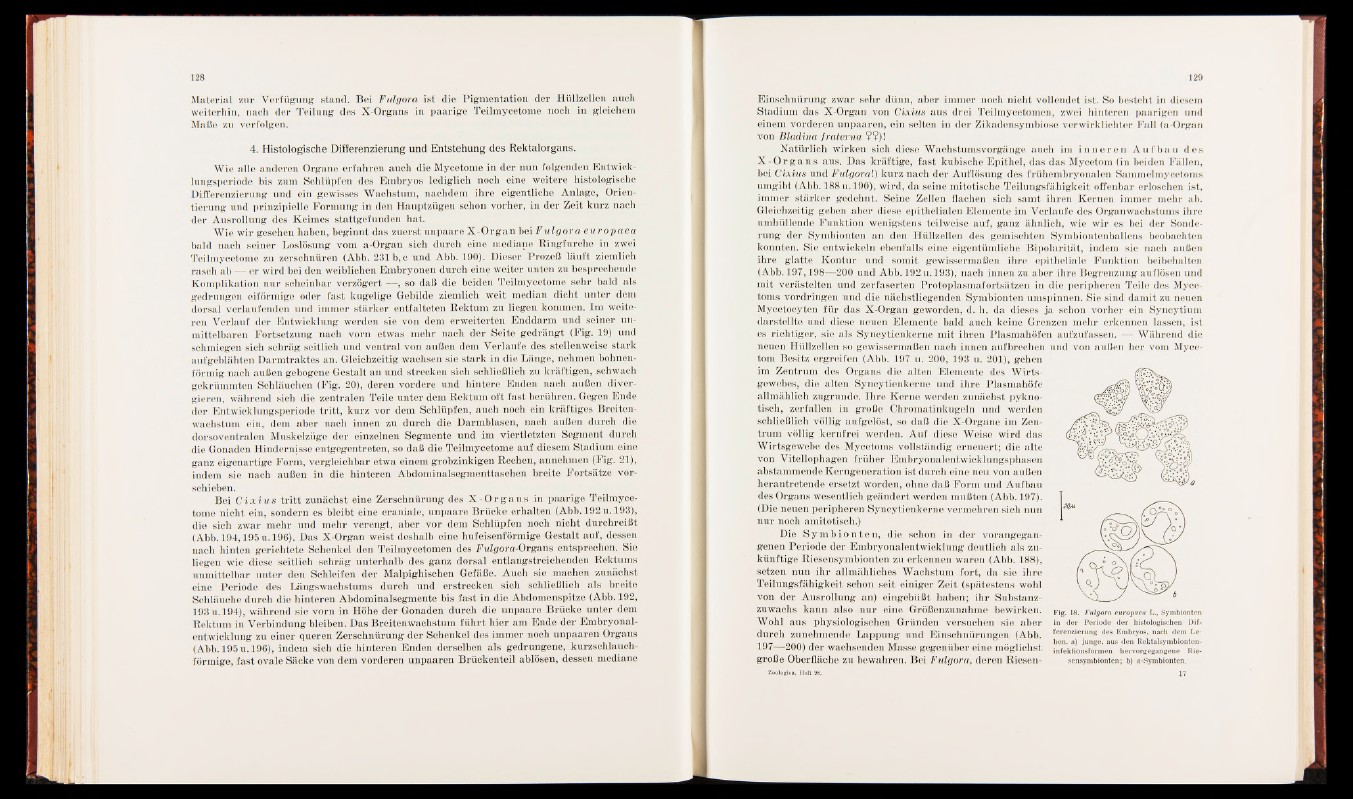
Material zur Verfügung stand. Bei Fulgora ist die Pigmentation der Hüllzellen auch
weiterhin, nach der Teilung des X-Organs in paarige Teilmycetome noch in gleichem
Maße zu verfolgen.
4. Histologische Differenzierung und Entstehung des Rektalorgans.
Wie alle anderen Organe erfahren auch die Mycetome in der nun folgenden Entwicklungsperiode
bis zum Schlüpfen des Embryos lediglich noch eine weitere histologische
Differenzierung und ein gewisses Wachstum, nachdem ihre eigentliche Anlage, Orientierung
und prinzipielle Formung in den Hauptzügen schon vorher, in der Zeit kurz nach
der Ausrollung des Keimes stattgefunden hat.
Wie wir gesehen haben, beginnt das zuerst unpaare X -O rg a n b e i F u lg o ra e u ro p a e a
bald nach seiner Loslösung vom a-Organ sich durch eine mediane Ringfurche in zwei
Teilmycetome zu zerschnüren (Abb. 231b, c und Abb. 190). Dieser Prozeß läuft ziemlich
rasch ah — er wird bei den weiblichen Embryonen durch eine weiter unten zu besprechende
Komplikation nur scheinbar verzögert —, so daß die beiden Teilmycetome sehr bald als
gedrungen eiförmige oder fast kugelige Gebilde ziemlich weit median dicht unter dem
dorsal verlaufenden und immer stärker entfalteten Rektum zu liegen kommen. Im weiteren
Verlauf der Entwicklung werden sie von dem erweiterten Enddarm und seiner unmittelbaren
Fortsetzung nach vorn etwas mehr nach der Seite gedrängt (Fig. 19) und
schmiegen sich schräg seitlich und ventral von außen dem Verlaufe des stellenweise stark
aufgeblähten Darmtraktes an. Gleichzeitig wachsen sie stark in die Länge, nehmen bohnenförmig
nach außen gebogene Gestalt an und strecken sich schließlich zu kräftigen, schwach
gekrümmten Schläuchen (Fig. 20), deren vordere und hintere Enden nach außen divergieren,
während sich die zentralen Teile unter dem Rektum oft fast berühren. Gegen Ende
der Entwicklungsperiode tritt, kurz vor dem Schlüpfen, auch noch ein kräftiges Breitenwachstum
ein, dem aber nach innen zu durch die Darmblasen, nach außen durch die
dorsoventralen Muskelzüge der einzelnen Segmente und im viertletzten Segment durch
die Gonaden Hindernisse entgegentreten, so daß die Teilmycetome auf diesem Stadium eine
ganz eigenartige Form, vergleichbar etwa einem grobzinkigen Rechen, annehmen (Fig. 21),
indem sie nach außen in die hinteren Abdominalsegmenttaschen breite Fortsätze vorschieben.
Bei C i x i u s tritt zunächst eine Zerschnürung des X-O r g a n s in paarige Teilmycetome
nicht ein, sondern es bleibt eine craniale, unpaare Brücke erhalten (Abb. 192 u. 193),
die sich zwar mehr und mehr verengt, aber vor dem Schlüpfen noch nicht durchreißt
(Abb. 194,195 u. 196). Das X-Organ weist deshalb eine hufeisenförmige Gestalt auf, dessen
nach hinten gerichtete Schenkel den Teilmycetomen des Fulgora-Organs entsprechen. Sie
liegen wie diese seitlich schräg unterhalb des ganz dorsal entlangstreichenden Rektums
unmittelbar unter den Schleifen der Malpighischen Gefäße. Auch sie machen zunächst
eine Periode des Längswachstums durch und erstrecken sich schließlich als breite
Schläuche durch die hinteren Abdominalsegmente bis fast in die Abdomenspitze (Abb. 192,
193 u. 194), während sie vorn in Höhe der Gonaden durch die unpaare Brücke unter dem
Rektum in Verbindung bleiben. Das Breitenwachstum füh rt hier am Ende der Embryonalentwicklung
zu einer queren Zerschnürung der Schenkel des immer noch unpaaren Organs
(Abb. 195 u. 196), indem sich die hinteren Enden derselben als gedrungene, kurzschlauchförmige,
fast ovale Säcke von dem vorderen unpaaren Brückenteil ablösen, dessen mediane
Einschnürung zwar sehr dünn, aber immer noch nicht vollendet ist. So besteht in diesem
Stadium das X-Organ von Cixius aus drei Teilmycetomen, zwei hinteren paarigen und
einem vorderen unpaaren, ein selten in der Zikadensymbiose verwirklichter Fall (a-Organ
von Bladina fr ater na 99)!
Natürlich wirken sich diese Wachstumsvorgänge auch im i n n e r e n Au f b a u des
X -O r g a n s aus. Das kräftige, fast kubische Epithel, das das Mycetom (in beiden Fällen,
bei Cixius und Fulgoral) kurz nach der Auflösung des frühemhryonalen Sammelmycetoms
umgibt (Abb. 188 u. 190), wird, da seine mitotische Teilungsfähigkeit offenbar erloschen ist,
immer stärker gedehnt. Seine Zellen flachen sich samt ihren Kernen immer mehr ab.
Gleichzeitig geben aber diese epithelialen Elemente im Verlaufe des Organ wachstu ms ihre
umhüllende Funktion wenigstens teilweise auf, ganz ähnlich, wie wir es bei der Sonderung
der Symbionten an den Hüllzellen des gemischten Symbiontenballens beobachten
konnten. Sie entwickeln ebenfalls eine eigentümliche Bipolarität, indem sie nach außen
ihre glatte Kontur und somit gewissermaßen ihre epitheliale Funktion beibehalten
(Abb. 197,198—200 und Abb. 192 u. 193), nach innen zu aber ihre Begrenzung auflösen und
mit verästelten und zerfaserten Protoplasmafortsätzen in die peripheren Teile des Myce-
toms Vordringen und die nächstliegenden Symbionten umspinnen. Sie sind damit zu neuen
Mycetocyten für das X-Organ geworden, d. h. da dieses ja schon vorher ein Syncytium
darstellte und diese neuen Elemente bald auch keine Grenzen mehr erkennen lassen, ist
es richtiger, sie als Syncytienkerne mit ihren Plasmahöfen aufzufassen.
neuen Hüllzellen so gewissermaßen nach innen aufbrechen
tom Besitz ergreifen (Abb. 197 u. 200, 193 u. 201), gehen
im Zentrum des Organs die alten Elemente des Wirtsgewebes,
die alten Syncytienkerne und ihre Plasmahöfe
allmählich zugrunde. Ihre Kerne werden zunächst pykno-
tisch, zerfallen in große Chromatinkugeln und werden
schließlich völlig aufgelöst, so daß die X-Organe im Zentrum
völlig kernfrei werden. Auf diese Weise wird das
Wirtsgewebe des Mycetoms vollständig erneuert; die alte
von Vitellophagen früher Embryonalentwicklungsphasen
ahstammende Kerngeneration ist durch eine neu von außen
herantretende ersetzt worden, ohne daß Form und Aufbau
des Organs wesentlich geändert werden mußten (Abb. 197).
(Die neuen peripheren Syncytienkerne vermehren sich nun
nur noch amitotisch.)
Die S y m b i o n t e n , die schon in der vorangegangenen
Periode der Embryonalentwicklung deutlich als zukünftige
Riesensymbionten zu erkennen waren (Abb. 188),
setzen nun ihr allmähliches Wachstum fort, da sie ihre
Teilungsfähigkeit schon seit einiger Zeit (spätestens wohl
von der Ausrollung an) eingebüßt haben; ihr Substanzzuwachs
kann also nur eine Größenzunahme bewirken.
Wohl aus physiologischen Gründen versuchen sie aber
durch zunehmende Lappung und Einschnürungen (Abb.
197—200) der wachsenden Masse gegenüber eine möglichst
große Oberfläche zu bewahren. Bei Fulgora, deren Riesenund
von außer
— Während die
her vom Myce-
• Periode der histologischen Dif-
erung des Embryos, nach dem Le-
i junge, aus den Rektalsymbionten-
onsformen hervorgegangene Rie-
; b) a-Symbionten.