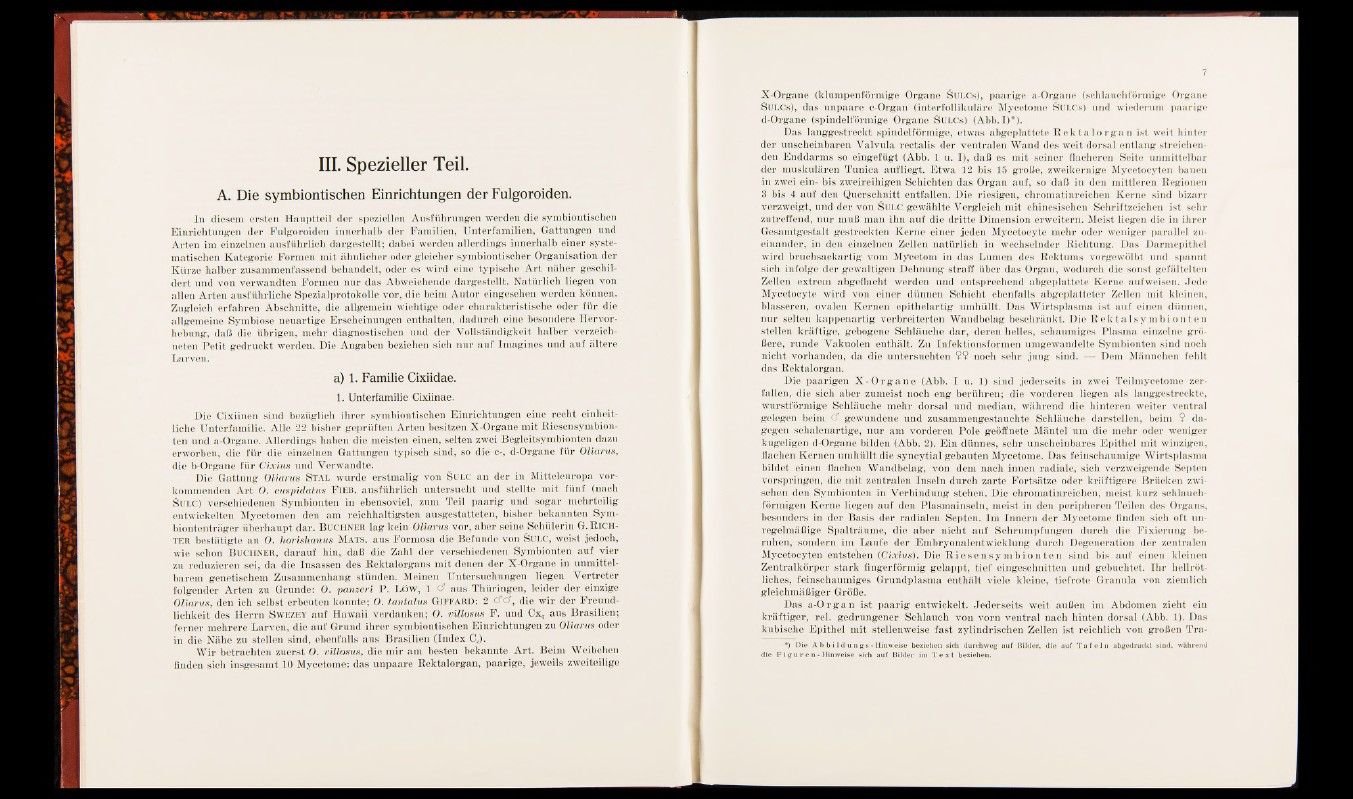
III. Spezieller Teil.
A. Die symbiontischen Einrichtungen der Fulgoroiden.
In diesem ersten Hanptteil der speziellen Ausführungen werden die symbiontischen
Einrichtungen der Fulgoroiden innerhalb der Familien, Unterfamilien, Gattungen und
Arten im einzelnen ausführlich dargestellt; dabei werden allerdings innerhalb einer systematischen
Kategorie Formen mit ähnlicher oder gleicher symbiontischer Organisation der
Kürze halber zusammenfassend behandelt, oder es wird eine typische Art näher geschildert
und von verwandten Formen nur das Abweichende dargestellt. Natürlich liegen von
allen Arten ausführliche Spezialprotokolle vor, die beim Autor eingesehen werden können.
Zugleich erfahren Abschnitte, die allgemein wichtige oder charakteristische oder für die
allgemeine Symbiose neuartige Erscheinungen enthalten, dadurch eine besondere Hervorhebung,
daß die übrigen, mehr diagnostischen und der Vollständigkeit halber verzeich-
neten Petit gedruckt werden. Die Angaben beziehen sich nu r auf Imagines und auf ältere
Larven.
a) 1. Familie Cixiidae.
1. Unterfamilie Cixiinae.
Die Cixiinen sind bezüglich ihrer symbiontischen Einrichtungen eine recht einheitliche
Unterfamilie. Alle 22 bisher geprüften Arten besitzen X-Organe mit Riesensymbion-
ten und a-Organe. Allerdings haben die meisten einen, selten zwei Begleitsymbionten dazu
erworben, die für die einzelnen Gattungen typisch sind, so die c-, d-Organe für Oliarus,
die b-Organe fü r Cixius und Verwandte.
Die Gattung Oliarus Sta l wurde erstmalig von S u l c an der in Mitteleuropa vorkommenden
Art 0. cuspidatus F ie b . ausführlich untersucht und stellte mit fünf (nach
Su l c ) verschiedenen Symbionten in ebensoviel, zum Teil paarig und sogar mehrteilig
entwickelten Mycetomen den am reichhaltigsten ausgestatteten, bisher bekannten Sym-
biontenträger überhaupt dar. B ü c h n e r lag kein Oliarus vor, aber seine Schülerin G. R ic h t
e r bestätigte an 0. horishanus Ma t s , aus Formosa die Befunde von S u l c , weist jedoch,
wie schon B ü c h n e r , darauf hin, daß die Zahl der verschiedenen Symbionten auf vier
zu reduzieren sei, da die Insassen des Rektalorgans mit denen der X-Organe in unmittelbarem
genetischem Zusammenhang stünden. Meinen Untersuchungen liegen Vertreter
folgender Arten zu Grunde: 0. panzeri P. Löw, 1 cf aus Thüringen, leider der einzige
Oliarus, den ich selbst erbeuten konnte; 0. tantalus GlFFARD: 2 cTcf, die wir der Freundlichkeit
des Herrn Swezey auf Hawaii verdanken; 0. villosus F. und Cxq aus Brasilien;
ferner mehrere Larven, die auf Grund ihrer symbiontischen Einrichtungen zu Oliarus oder
in die Nähe zu stellen sind, ebenfalls aus Brasilien (Index Cz).
Wir betrachten zuerst 0. villosus, die mir am besten bekannte Art. Beim Weibchen
finden sich insgesamt 10 Mycetome: das unpaare Rektalorgan, paarige, jeweils zweiteilige
X-Organe (klumpenförmige Organe ÖULCs), paarige a-Organe (schlauchförmige Organe
Su lcs), das unpaare c-Organ (interfollikuläre Mycetome ÖULCs) und wiederum paarige
d-Organe (spindelförmige Organe ÖULCs) (Abb. I)*).
Das langgestreckt spindelförmige, etwas abgeplattete R e k t a l o r g a n ist weit hinter
der unscheinbaren Valvula rectalis der ventralen Wand des weit dorsal entlang streichenden
Enddarms so eingefügt (Abb. 1 u. I), daß es mit seiner flacheren Seite unmittelbar
der muskulären Tunica auf liegt. Etwa 12 bis 15 große, zweikernige Mycetocyten bauen
in zwei ein- bis zweireihigen Schichten das Organ auf, so daß in den mittleren Regionen
3 bis 4 auf den Querschnitt entfallen. Die riesigen, chromatinreichen Kerne sind bizarr
verzweigt, und der von SULC gewählte Vergleich mit chinesischen Schriftzeichen ist sehr
zutreffend, nur muß man ihn auf die dritte Dimension erweitern. Meist liegen die in ihrer
Gesamtgestalt gestreckten Kerne einer jeden Mycetocyte mehr oder weniger parallel zueinander,
in den einzelnen Zellen natürlich in wechselnder Richtung. Das Darmepithel
wird bruchsackartig vom Mynetom in das Lumen des Rektums vorgewölbt und spannt
sich infolge der gewaltigen Dehnung straff über das Organ, wodurch die sonst gefältelten
Zellen extrem abgeflacht werden und entsprechend abgeplattete Kerne auf weisen. Jede
Mycetocyte wird von einer dünnen Schicht ebenfalls abgeplatteter Zellen mit kleinen,
blässeren, ovalen Kernen epithelartig umhüllt. Das Wirtsplasma ist auf einen dünnen,
nur selten kappenartig verbreiterten Wandbelag beschränkt. Die R e k t a l s ym b i o n t e n
stellen kräftige, gebogene Schläuche dar, deren helles, schaumiges Plasma einzelne größere,
runde Vakuolen enthält. Zu Infektionsformen umgewandelte Symbionten sind noch
nicht vorhanden, da die untersuchten 99 noch sehr jung sind. ^ Dem Männchen fehlt
das Rektalorgan.
Die paarigen X-O r g a n e (Abb. I u. 1) sind jederseits in zwei Teilmycetome zerfallen,
die sich aber zumeist noch eng berühren; die vorderen liegen als langgestreckte,
wurstförmige Schläuche mehr dorsal und median, während die hinteren weiter ventral
gelegen beim C? gewundene und zusammengestauchte Schläuche dar stellen, beim 9 dagegen
schalenartige, nur am vorderen Pole geöffnete Mäntel um die mehr oder weniger
kugeligen d-Organe bilden (Abb. 2). Ein dünnes, sehr unscheinbares Epithel mit winzigen,
flachen Kernen umhüllt die syncytial gebauten Mycetome. Das feinschaumige Wirtsplasma
bildet einen flachen Wandbelag, von dem nach innen radiale, sich verzweigende Septen
vorspringen, die mit zentralen Inseln durch zarte Fortsätze oder kräftigere Brücken zwischen
den Symbionten in Verbindung stehen. Die chromatinreichen, meist kurz schlauchförmigen
Kerne liegen auf den Plasmainseln, meist in den peripheren Teilen des Organs,
besonders in der Basis der radialen Septen. Im Innern der Mycetome finden sich oft unregelmäßige
Spalträume, die aber nicht auf Schrumpfungen durch die Fixierung beruhen,
sondern im Laufe der Embryonalentwicklung durch Degeneration der zentralen
Mycetocyten entstehen {Cixius). Die R i e s e n s ymb i o n t e n sind bis auf einen kleinen
Zentralkörper stark fingerförmig gelappt, tief eingeschnitten und gebuchtet. Ih r hellrötliches,
feinschaumiges Grundplasma enthält viele kleine, tiefrote Granula von ziemlich
gleichmäßiger Größe.
Das a-Organ ist paarig entwickelt. Jederseits weit außen im Abdomen zieht ein
kräftiger, rel. ged rungener Schlauch von vorn ventral nach hinten dorsal (Abb. 1). Das
kubische Epithel mit stellenweise fast zylindrischen Zellen ist reichlich von großen Tra-
*) Die A b b i l d u n g s -Hinweise beziehen sich durchweg auf Bilder, die auf T a f e l n abgedruckt sind, während
die F i g u r e n -Hinweise sich auf Bilder im T e x t beziehen.