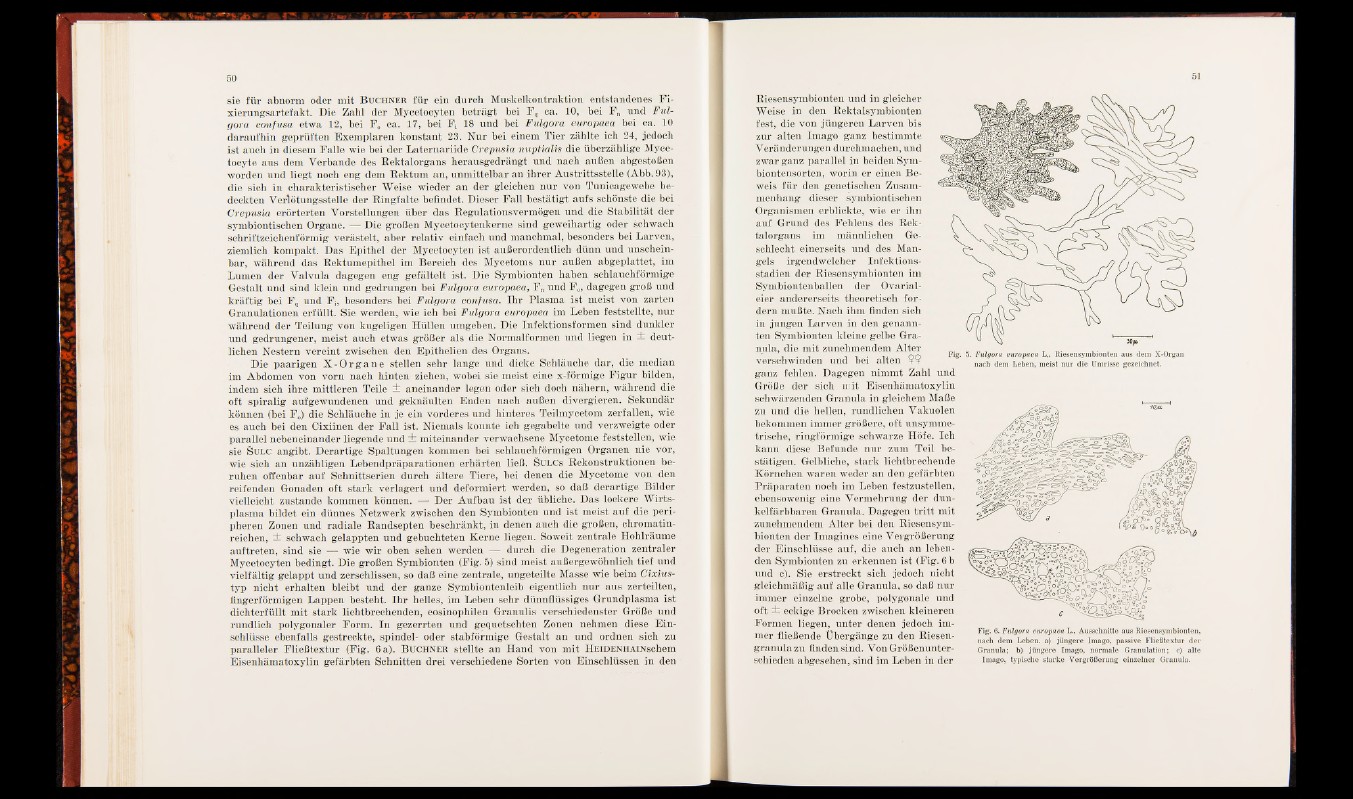
sie für abnorm oder mit B ü c h n e r fü r ein durch Muskelkontraktion entstandenes F ixierungsartefakt.
Die Zahl der Mycetocyten beträgt bei F q ca. 10, bei F n und Fulgora
confusa etwa 12, bei F 0 ca. 17, bei Fj 18 und bei Fulgora europaea bei ca. 10
daraufhin geprüften Exemplaren konstant 23. Nur bei einem Tier zählte ich 24, jedoch
ist auch in diesem Falle wie bei der Laternariide Crepusia nuptialis die überzählige Myce-
tocyte aus dem Verbände des Rektalorgans herausgedrängt und nach außen abgestoßen
worden und liegt noch eng dem Rektum an, unmittelbar an ihrer Austrittsstelle (Abb. 93),
die sich in charakteristischer Weise wieder an der gleichen nur von Tunicagewebe bedeckten
Verlötungsstelle der Ringfalte befindet. Dieser Fall bestätigt aufs schönste die bei
Crepusia erörterten Vorstellungen über das Regulationsvermögen und die Stabilität der
symbiontischen Organe.®- Die großen Mycetocytenkerne sind geweihartig oder schwach
schriftzeichenförmig verästelt, aber relativ einfach und manchmal, besonders bei Larven,
ziemlich kompakt. Das Epithel der Mycetocyten ist außerordentlich dünn und unscheinbar,
während das Rektumepithel im Bereich des Mycetoms nu r außen abgeplattet, im
Lumen der Valvula dagegen eng gefältelt ist. Die Symbionten haben schlauchförmige
Gestalt und sind klein und gedrungen bei Fulgora europaea, F n und F 0, dagegen groß und
k rä ftig bei F q und F b besonders bei Fulgora confusa. Ih r Plasma ist meist von zarten
Granulationen erfüllt. Sie werden, wie ich bei Fulgora europaea im Leben feststellte, nur
während der Teilung von kugeligen Hüllen umgeben. Die Infektionsformen sind dunkler
und gedrungener, meist auch etwas größer als die Normalformen und liegen in i t . deutlichen
Nestern vereint zwischen den Epithelien des Organs.
Die paarigen X-O r g a n e stellen sehr lange und dicke. Schläuche dar, die median
im Abdomen von vorn nach hinten ziehen, wobei sie meist eine x-förmige Figur bilden,
indem sich ihre mittleren Teile ± aneinander legen oder sich doch nähern, während die
oft spiralig auf gewundenen und geknäulten Enden nach außen divergieren. Sekundär
können (bei F 0) die Schläuche in je ein vorderes und hinteres Teilmycetom zerfallen, wie
es auch bei den Cixiinen der Fall ist. Niemals konnte ich gegabelte und verzweigte oder
parallel nebeneinander liegende und ± miteinander verwachsene Mycetome feststellen, wie
sie SüLC angibt. Derartige Spaltungen kommen bei schlauchförmigen Organen nie vor,
wie sich an unzähligen Lebendpräparationen erhärten ließ. SULCs Rekonstruktionen beruhen
offenbar auf Schnittserien durch ältere Tiere, bei denen die Mycetome von den
reifenden Gonaden oft stark verlagert und deformiert werden, so daß derartige Bilder
vielleicht zustande kommen können. — Der Aufbau ist der übliche. Das lockere Wirtsplasma
bildet ein dünnes Netzwerk zwischen den Symbionten und ist meist auf die peripheren
Zonen und radiale Randsepten beschränkt, in denen auch die großen, chromatin-
reichen, ± schwach gelappten und gebuchteten Kerne liegen. Soweit zentrale Hohlräume
auftreten, sind s ieH - wie wir oben sehen werden — durch die Degeneration zentraler
Mycetocyten bedingt. Die großen Symbionten (Fig. 5) sind meist außergewöhnlich tief und
vielfältig gelappt und zerschlissen, so daß eine zentrale, ungeteilte Masse wie beim Cixius-
typ nicht erhalten bleibt und der ganze Symbiontenleib eigentlich nur aus zerteilten,
fingerförmigen Lappen besteht. Ih r helles, im Leben sehr dünnflüssiges Grundplasma ist
dichterfüllt mit stark lichtbrechenden, eosinophilen Granulis verschiedenster Größe und
rundlich polygonaler Form. In gezerrten und gequetschten Zonen nehmen diese E inschlüsse
ebenfalls gestreckte, spindel- oder stabförmige Gestalt an und ordnen sich zu
paralleler Fließtextur (Fig. 6 a). B ü c h n e r stellte an Hand von mit HEiDENHAlNschem
Eisenhämatoxylin gefärbten Schnitten drei verschiedene Sorten von Einschlüssen in den
Fig.
Riesensymbionten und in gleicher
Weise in den Rektalsymbionten
fest, die von jüngeren Larven bis
zur alten Imago ganz bestimmte
Veränderungen durchmachen, und
zwar ganz parallel in beiden Sym-
biontensorten, worin er einen Beweis
fü r den genetischen Zusammenhang
dieser symbiontischen
Organismen erblickte, wie er ihn
auf Grund des Fehlens des Rektalorgans
im männlichen Geschlecht
einerseits und des Mangels
irgendwelcher Infektionsstadien
der Riesensymbionten im
Symbiontenballen der Ovarialeier
andererseits theoretisch fordern
mußte. Nach ihm finden sich
in jungen Larven in den genannten
Symbionten kleine gelbe Granula,
die mit zunehmendem Alter
verschwinden und bei alten $$
ganz fehlen. Dagegen nimmt Zahl und
Größe der sich mit Eisenhämatoxylin
schwärzenden Granula in gleichem Maße
zu und die hellen, rundlichen Vakuolen
bekommen immer größere, oft unsymmetrische,
ringförmige schwarze Höfe. Ich
kann diese Befunde nu r zum Teil bestätigen.
Gelbliche, stark lichtbrechende
Körnchen waren weder an den gefärbten
Präparaten noch im Leben festzustellen,
ebensowenig eine Vermehrung der dun-
kelfärbbaren Granula. Dagegen tritt mit
zunehmendem Alter bei den Riesensymbionten
der Imagines eine Vergrößerung
der Einschlüsse auf, die auch an lebenden
Symbionten zu erkennen ist (Fig. 6 b
und c). Sie erstreckt sich jedoch nicht
gleichmäßig auf alle Granula, so daß nur
immer einzelne grobe, polygonale und
oft i eckige Brocken zwischen kleineren
Formen liegen, unter denen jedoch immer
fließende Übergänge zu den Riesengranula
zu finden sind. Von Größenunterschieden
abgesehen, sind im Leben in der
5. Fulgora europaea Riesensymbionten aus dem X-Organ
nach dem Leben, meist nur die Umrisse gezeichnet.
Fig. 6. Fulgora europaea L., Ausschnitte aus Riesensymbionten,
nach dem Leben, a) jüngere Imago, passive Fließtextur der
Granula; b) jüngere Imago, normale Granulation; c) alte
Imago, typische starke Vergrößerung einzelner Granula.