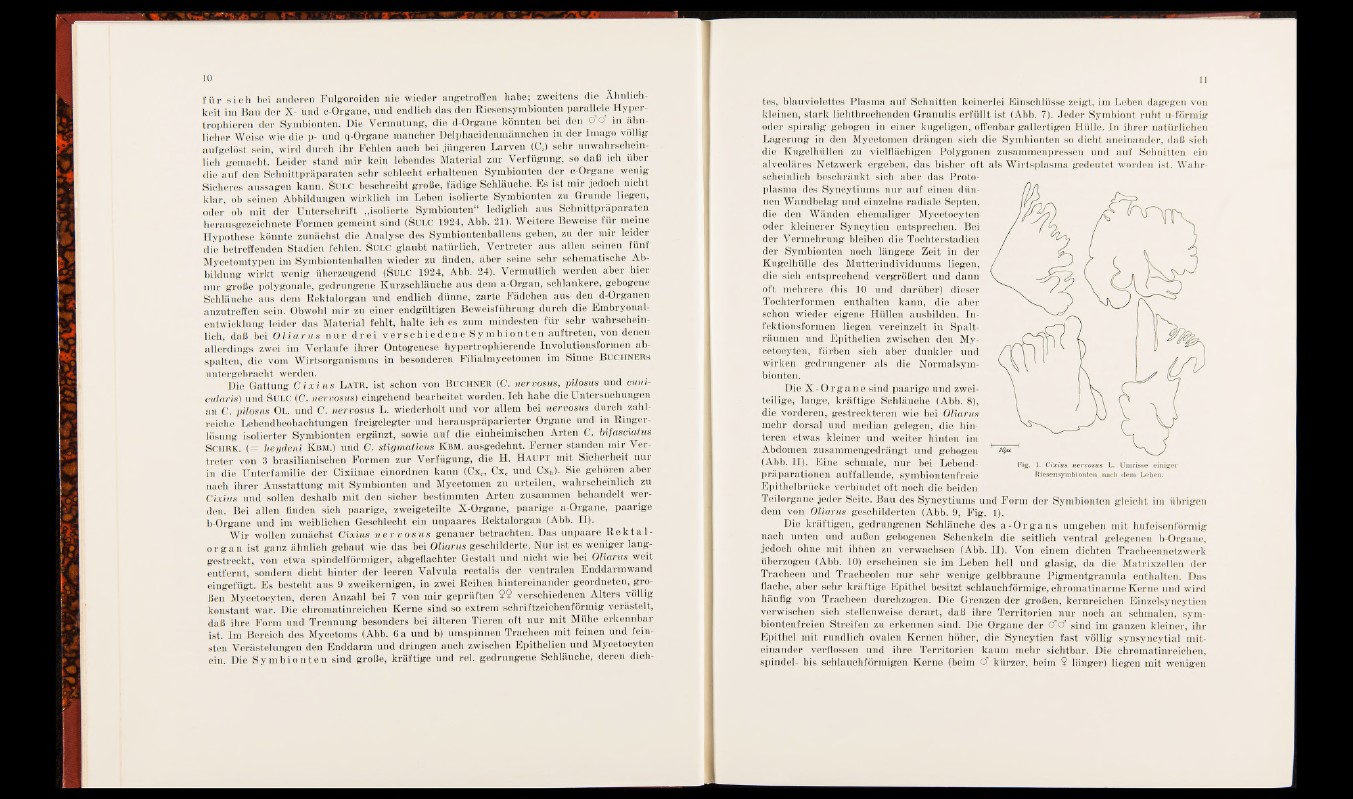
f ü r s i ch bei anderen Fulgoroiden nie wieder angetroffen habe; zweitens die Ähnlichkeit
im Bau der X- und c-Organe, und endlich das den Riesensymbionten parallele Hyper-
trophieren der Symhionten. Die Vermutung, die d-Organe könnten hei den Cf cT in ähnlicher
Weise wie die p- und q-Organe mancher Delphacidenmännchen in der Imago völlig
aufgelöst sein, wird durch ihr Fehlen auch bei jüngeren Larven (C,) sehr unwahrscheinlich
gemacht. Leider stand mir kein lebendes Material zur Verfügung, so daß ich über
die auf den Schnittpräparaten sehr schlecht erhaltenen Symhionten der e-Organe wenig
Sicheres aussagen kann. §ULC beschreibt große, fädige Schläuche. Es ist mir jedoch nicht
klar, ob seinen Abbildungen wirklich im Leben isolierte Symhionten zu Grunde liegen,
oder ob mit der Unterschrift „isolierte Symhionten“ lediglich aus Sehnittpräparaten
herausgezeichnete Formen gemeint sind ( S u l c 1924, Abb. 21.). Weitere Beweise für meine
Hypothese könnte zunächst die Analyse des Symbiontenballens gehen, zu der mir leider
die betreffenden Stadien fehlen. S u l c glaubt natürlich, Vertreter aus allen seinen fünf
Mycetomtypen im Symbiontenballen wieder zu finden, aber seine sehr schematische Abbildung
wirkt wenig überzeugend (SULC 1924, Abb. 24). Vermutlich werden aber hier
nur große polygonale, gedrungene Kurzschläuche aus dem a-Organ, schlankere, gebogene
Schläuche aus dem Rektalorgan und endlich dünne, zarte Fädchen aus den d-Organen
anzutreffen sein. Obwohl mir zu einer endgültigen Beweisführung durch die Embryonalentwicklung
leider das Material fehlt, halte ich es zum mindesten für sehr wahrscheinlich,
daß bei O l i a r u s n u r d r e i v e r s c h i e d e n e S ymh i o n t e n auftreten, von denen
allerdings zwei im Verlaufe ihrer Ontogenese hypertrophierende Involutionsformen abspalten,
die vom Wirtsorganismus in besonderen Filialmycetomen im Sinne B ü c h n e r s
untergebracht werden.
Die Gattung C i x i u s L a t r . ist schon von B ü c h n e r (C. nervosus, pilosus und cüni-
cularis) und Su l c (C. nervosus) eingehend bearbeitet worden. Ich habe die Untersuchungen
an C. pilosus Ol. und C. nervosus L. wiederholt und vor allem bei nervosus durch zahl
reiche Lebendbeobachtungen freigelegter und herauspräparierter Organe und in Ringerlösung
isolierter Symhionten ergänzt, sowie auf die einheimischen Arten C. bifasciatus
Sc h r k . (= heydeni K bm.) und C. stigmaticus Kbm. ausgedehnt. Ferner standen mir Vertreter
von 3 brasilianischen Formen zur Verfügung, die H . H a u p t mit Sicherheit nur
in die Unterfamilie der Cixiinae einordnen kann (Cxc, Cxe und Gxh). Sie gehören aber
nach ihrer Ausstattung mit Symbionten und Myeetomen zu urteilen, wahrscheinlich zu
Cixius und sollen deshalb mit den sicher bestimmten Arten zusammen behandelt werden.
Bei allen finden sich paarige;: zweigeteilte X-Organe, paarige a-Organe, paarige
b-Organe und im weiblichen Geschlecht ein nnpaares Rektalorgan (Abb. II).
Wir wollen zunächst Cixius n e r v o s u s genauer betrachten. Das unpaare R e k t a l o
r g a n ist ganz ähnlich gebaut wie das bei Oliarus geschilderte. Nur ist es weniger langgestreckt,
von etwa spindelförmiger, abgeflachter Gestalt und nicht wie bei Oliarus weit
entfernt, sondern dicht hinter der leeren Valvula rectalis der ventralen Enddarmwand
eingefügt. Es besteht aus 9 zweikernigen, in zwei Reihen hintereinander geordneten, großen
Mycetocyten, deren Anzahl bei 7 von mir geprüften Sgl verschiedenen Alters völlig
konstant war. Die chromatinreichen Kerne sind so extrem schriftzeichenförmig verästelt,
daß ihre Form und Trennung besonders bei älteren Tieren o ll nur mit Mühe erkennbar
ist. Im Bereich des Mycetoms (Abb. 6 a und b) umspinnen Tracheen mit feinen und feinsten
Verästelungen den Enddarm und dringen auch zwischen Epithelien und Mycetocyten
ein. Die S ymb i o n t e n sind große, kräftige und rel. gedrungene Schläuche, deren dichtes,
blauviolettes Plasma auf Schnitten keinerlei Einschlüsse zeigt, im Leben dagegen von
kleinen, stark lichtbrechenden Granulis erfüllt ist (Abb. 7). Jeder Symbiont ru h t u-förmig
oder spiralig gebogen in einer kugeligen, offenbar gallertigen Hülle. In ihrer natürlichen
Lagerung in den Myeetomen drängen sich die Symbionten so dicht aneinander, daß sich
die Kugelhüllen zu vielflächigen Polygonen zusammenpressen und auf Schnitten ein
alveoläres Netzwerk ergeben, das bisher oft als Wirtsplasma gedeutet worden ist. Wahrscheinlich
beschränkt sich aber das Protoplasma
des Syncytiums nur auf einen dünnen
Wandbelag und einzelne radiale Septen,
die den Wänden ehemaliger Mycetocyten
oder kleinerer Syncytien entsprechen. Bei
der Vermehrung bleiben die Tochterstadien
der Symbionten noch längere Zeit in der
Kugelhülle des Mutterindividuums liegen,
die sich entsprechend vergrößert und dann
oft mehrere (bis 10 und darüber) dieser
Tochterformen enthalten kann, die aber
schon wieder eigene Hüllen ausbilden. In fektionsformen
liegen vereinzelt in Spalträumen
und Epithelien zwischen den Mycetocyten,
färben sich aber dunkler und
wirken gedrungener als die NormalSym-
bionten.
Die X-O r g a n e sind paarige und zweiteilige,
lange, kräftige Schläuche (Abb. 8),
die vorderen, gestreckteren wie bei Oliarus
mehr dorsal und median gelegen, die hinteren
etwas kleiner und weiter hinten im
Abdomen zusammengedrängt und gebogen
(Abb. II). Eine schmale, nur bei Lebend- Fig. 1. Cixius nervosus L. Umrisse einiger
präparationen auffallende, symbiontenfreie Riesensymbionten nach dem Leben.
Epithelbrücke verbindet oft noch die beiden
Teilorgane jeder Seite. Bau des Syncytiums und Form der Symbionten gleicht im übrigen
dem von Oliarus geschilderten (Abb. 9, Fig. 1).
Die kräftigen, gedrungenen Schläuche des a -Or g a n s umgeben mit hufeisenförmig
nach unten und außen gebogenen Schenkeln die seitlich ventral gelegenen b-Organe,
jedoch ohne mit ihhön zu verwachsen (Abb. II). Von einem dichten Tracheennetzwerk
überzogen (Abb. 10) erscheinen sie im Leben hell und glasig, da die Matrixzellen der
Tracheen und Tracheolen nur sehr wenige gelbbraune Pigmentgranula enthalten. Das
flache, aber sehr kräftige Epithel besitzt schlauchförmige, chromatinarme Kerne und wird
häufig von Tracheen durchzogen. Die Grenzen der großen, kernreichen Einzelsyncytien
verwischen sich stellenweise derart, daß ihre Territorien nur noch an schmalen, sym-
biontenfreien Streifen zu erkennen sind. Die Organe der Cfcf sind im ganzen kleiner, ihr
Epithel mit rundlich ovalen Kernen höher, die Syncytien fast völlig synsyncytial miteinander
verflossen und ihre Territorien kaum mehr sichtbar. Die chromatinreichen,
spindel- bis schlauchförmigen Kerne (beim C? kürzer, beim $ länger) liegen mit wenigen