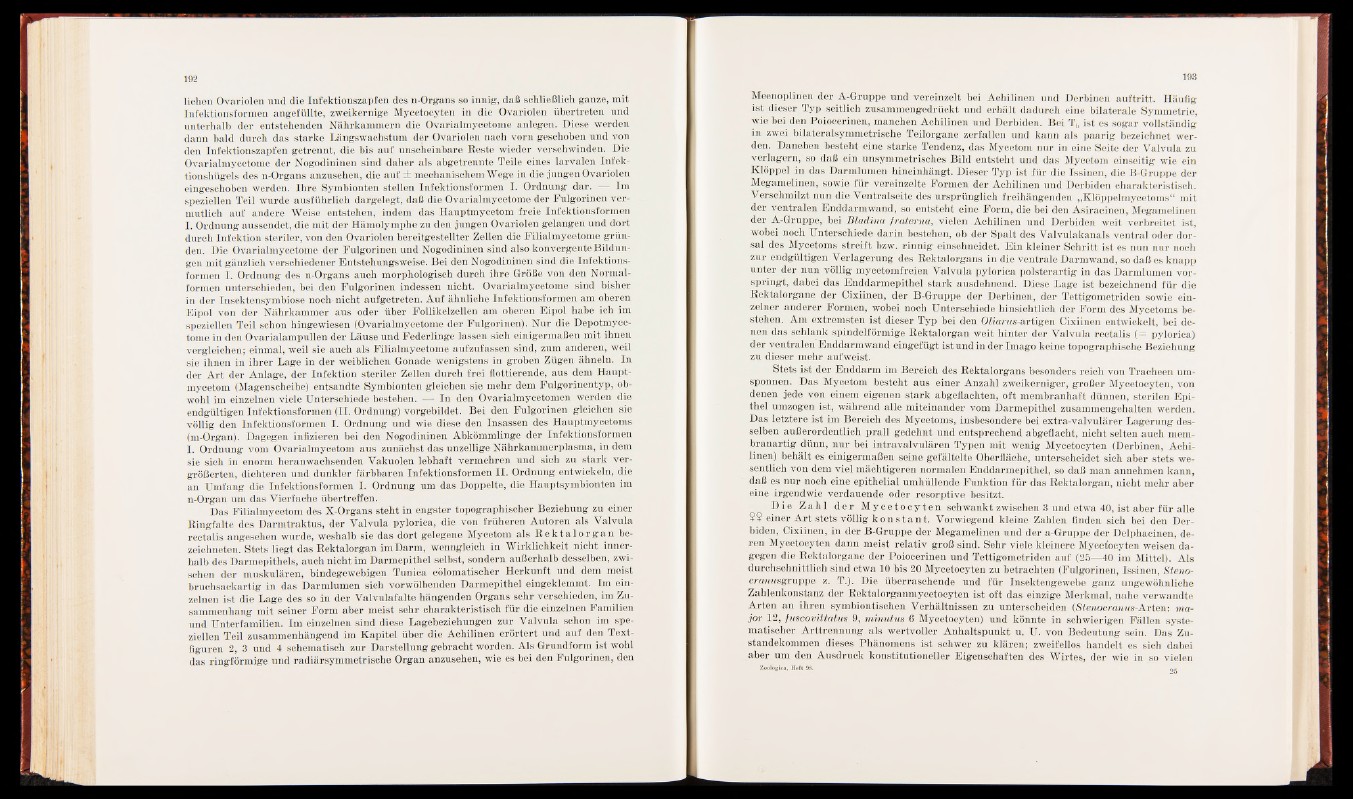
liehen Ovariolen und die Infektionszapfen des n-Organs so innig, daß schließlich ganze, mit
Infektionsformen angefüllte, zweikernige Mycetocyten in die Ovariolen übertreten und
unterhalb der entstehenden Nährkammern die Ovarialmycetome anlegen. Diese werden
dann bald durch das starke Längswachstum der Ovariolen nach vorn geschoben und von
den Infektionszapfen getrennt, die bis auf unscheinbare Reste wieder verschwinden. Die
Ovarialmycetome der Nogodininen sind daher als abgetrennte Teile eines larvalen Infektionshügels
des n-Organs anzusehen, die auf ± mechanischem Wege in die jungen Ovariolen
eingeschoben werden. Ihre Symbionten stellen Infektionsformen I. Ordnung dar. — Im
speziellen Teil wurde ausführlich dargelegt, daß die Ovarialmycetome der Fulgorinen vermutlich
auf andere Weise entstehen, indem das Hauptmycetom freie Infektionsformen
I. Ordnung aussendet, die mit der Hämolymphe zu den jungen Ovariolen gelangen und dort
durch Infektion steriler, von den Ovariolen bereitgestellter Zellen die Filialmycetome gründen.
Die Ovarialmycetome der Fulgorinen und Nogodininen sind also konvergente Bildungen
mit gänzlich verschiedener Entstehungs weise. Bei den Nogodininen sind die Infektionsformen
I. Ordnung des n-Organs auch morphologisch durch ihre Größe von den Normalformen
unterschieden, bei den Fulgorinen indessen nicht. Ovarialmycetome sind bisher
in der Insektensymbiose noch nicht aufgetreten. Auf ähnliche Infektionsformen am oberen
Eipol von der Nährkammer aus oder über Follikelzellen am oberen Eipol habe ich im
speziellen Teil schon hingewiesen (Ovarialmycetome der Fulgorinen). Nur die Depotmyce-
tome in den Ovarialampullen der Läuse und Federlinge lassen sich einigermaßen mit ihnen
vergleichen; einmal, weil sie auch als Filialmycetome aufzufassen sind, zum anderen, weil
sie ihnen in ihrer Lage in der weiblichen Gonade wenigstens in groben Zügen ähneln. In
der Art der Anlage, der Infektion steriler Zellen durch frei flottierende, aus dem Hauptmycetom
(Magenscheibe) entsandte Symbionten gleichen sie mehr dem Fulgorinentyp, obwohl
im einzelnen viele Unterschiede bestehen. — In den Ovarialmycetomen werden die
endgültigen Infektionsformen (II. Ordnung) vorgebildet. Bei den Fulgorinen gleichen sie
völlig den Infektionsformen I. Ordnung und wie diese den Insassen des Hauptmycetoms
(m-Organ). Dagegen infizieren bei den Nogodininen Abkömmlinge der Infektionsformen
I. Ordnung vom Ovarialmycetom aus zunächst das unzellige Nährkammerplasma, in dem
sie sich in enorm heran wachsenden Vakuolen lebhaft vermehren und sich zu stark vergrößerten,
dichteren und dunkler färbbaren Infektionsformen II. Ordnung entwickeln, die
an Umfang die Infektionsformen I. Ordnung um das Doppelte, die Hauptsymbionten im
n-Organ um das Vierfache übertreffen.
Das Filialmycetom des X-Organs steht in engster topographischer Beziehung zu einer
Ringfalte des Darmtraktus, der Valvula pylorica, die von früheren Autoren als Valvula
rectalis angesehen wurde, weshalb sie das dort gelegene Mycetom als R e k t a l o r g a n be-
zeichneten. Stets liegt das Rektalorgan im Darm, wenngleich in Wirklichkeit nicht innerhalb
des Darmepithels, auch nicht im D armepithel selbst, sondern außerhalb desselben, zwischen
der muskulären, bindegewebigen Tunica cölomatischer Herkunft und dem meist
bruchsackartig in das Darmlumen sich vorwölbenden Darmepithel eingeklemmt. Im einzelnen
ist die Lage des so in der Valvulafalte hängenden Organs sehr verschieden, im Zusammenhang
mit seiner Form aber meist sehr charakteristisch für die einzelnen Familien
und Unterfamilien. Im einzelnen sind diese Lagebeziehungen zur Valvula schon im speziellen
Teil zusammenhängend im Kapitel über die Achilinen erörtert und auf den Textfiguren
2, 3 und 4 schematisch zur Darstellung gebracht worden. Als Grundform ist wohl
das ringförmige und radiärsymmetrische Organ anzusehen, wie es bei den Fulgorinen, den
Meenoplinen der A-Gruppe und vereinzelt bei Achilinen und Derbinen auftritt. Häufig
ist dieser Typ seitlich zusammengedrückt und erhält dadurch eine bilaterale Symmetrie,
wie bei den Poiocerinen, manchen Achilinen und Derbiden. Bei Tb ist es sogar vollständig
in zwei bilateralsymmetrische Teilorgane zerfallen und kann als paarig bezeichnet werden.
Daneben besteht eine starke Tendenz, das Mycetom nur in eine Seite der Valvula zu
verlagern, so daß ein unsymmetrisches Bild entsteht und das Mycetom einseitig wie ein
Klöppel in das Darmlumen hineinhängt. Dieser Typ ist fü r die Issinen, die B-Gruppe der
Megamelinen, sowie fü r vereinzelte Formen der Achilinen und Derbiden charakteristisch.
Verschmilzt nun die Ventralseite des ursprünglich freihängenden „Klöppelmycetoms“ mit
der ventralen Enddarmwand, so entsteht eine Form, die bei den Asiracinen, Megamelinen
der A-Gruppe, bei Bladina fraterna, vielen Achilinen und Derbiden weit verbreitet ist,
wobei noch Unterschiede darin bestehen, ob der Spalt des Valvulakanals ventral oder dorsal
des Mycetoms streift bzw. rinnig einschneidet. Ein kleiner Schritt ist es nun nur noch
zur endgültigen Verlagerung des Rektalorgans in die ventrale Darmwand, so daß es knapp
unter der nun völlig mycetomfreien Valvula pylorica polsterartig in das Darmlumen vorspringt,
dabei das Enddarmepithel stark ausdehnend. Diese Lage ist bezeichnend für die
Rektalorgane der Cixiinen, der B-Gruppe der Derbinen, der Tettigometriden sowie einzelner
anderer Formen, wobei noch Unterschiede hinsichtlich der Form des Mycetoms bestehen.
Am extremsten ist dieser Typ bei den Oliarus-artigen Cixiinen entwickelt, bei denen
das schlank spindelförmige Rektalorgan weit hinter der Valvula rectalis (— pylorica)
der ventralen Enddarmwand eingefügt ist und in der Imago keine topographische Beziehung
zu dieser mehr aufweist.
Stets ist der Enddarm im Bereich des Rektalorgans besonders reich von Tracheen umsponnen.
Das Mycetom besteht aus einer Anzahl zweikerniger, großer Mycetocyten, von
denen jede von einem eigenen stark abgeflachten, oft membranhaft dünnen, sterilen Epithel
umzogen ist, während alle miteinander vom Darmepithel zusammengehalten werden.
Das letztere ist im Bereich des Mycetoms, insbesondere bei extra-valvulärer Lagerung desselben
außerordentlich prall gedehnt und entsprechend abgeflacht, nicht selten auch membranartig
dünn, nur bei intravalvulären Typen mit wenig Mycetocyten (Derbinen, Achilinen)
behält es einigermaßen seine gefältelte Oberfläche, unterscheidet sich aber stets wesentlich
von dem viel mächtigeren normalen Enddarmepithel, so daß man annehmen kann,
daß es nur noch eine epithelial umhüllende Funktion für das Rektalorgan, nicht mehr aber
eine irgendwie verdauende oder resorptive besitzt.
D ie Z a h l d e r My c e t o c y t e n schwankt zwischen 3 und etwa 40, ist aber für alle
$9 einer Art stets völlig k o n s t a n t . Vorwiegend kleine Zahlen finden sich bei den Derbiden,
Cixiinen, in der B-Gruppe der Megamelinen und der a-Gruppe der Delphacinen, deren
Mycetocyten dann meist relativ groß sind. Sehr viele kleinere Mycetocyten weisen dagegen
die Rektalorgane der Poiocerinen und Tettigometriden auf (25—40 im Mittel). Als
durchschnittlich sind etwa 10 bis 20 Mycetocyten zu betrachten (Fulgorinen, Issinen, Steno-
crawwsgruppe z. T.). Die überraschende und für Insektengewebe ganz ungewöhnliche
Zahlenkonstanz der Rektalorganmycetocyten ist oft das einzige Merkmal, nahe verwandte
Arten an ihren symbiontischen Verhältnissen zu unterscheiden (Stenocranus-Arten: major
12, fuscovittatus 9, minutus 6 Mycetocyten) und könnte in schwierigen Fällen systematischer
Arttrennung als wertvoller Anhaltspunkt u„ U. von Bedeutung sein. Das Zustandekommen
dieses Phänomens ist schwer zu klären; zweifellos handelt es sich dabei
aber um den Ausdruck konstitutioneller Eigenschaften des Wirtes, der wie in so vielen
Zoològica, Heft 98. ¡ S