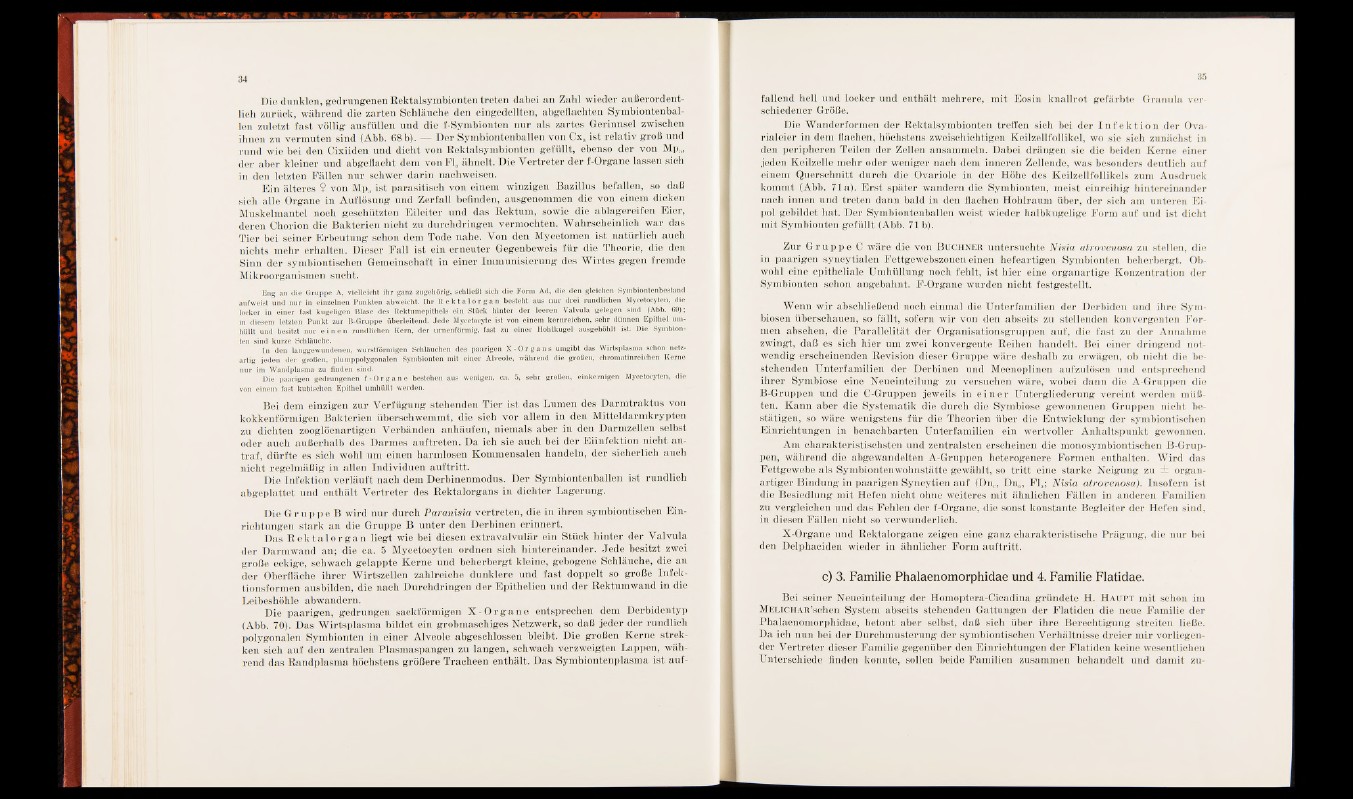
Die dunklen, gedrungenen Rektalsymbionten treten dabei an Zahl wieder außerordentlich
zurück, während die zarten Schläuche den eingedellten, abgeflachten Symbiontenbal-
len zuletzt fast völlig ausfüllen und die f-Symbionten nur als zartes Gerinnsel zwischen
ihnen zu vermuten sind (Abb. 68 b). — Der Symbiontenballen von Cx0 ist relativ groß und
rund wie bei den Cixiiden und dicht von Rektalsymbionten gefüllt, ebenso der von Mp,,
der aber kleiner und abgeflacht dem von Fl, ähnelt, Die Vertreter der f-Organe lassen sich
in den letzten Fällen nur schwer darin nachweisen.
Bin älteres 2 von Mp, ist parasitisch von einem winzigen Bazillus befallen, so daß
sich alle Organe in Auflösung und Zerfall befinden, ausgenommen die von einem dicken
Muskelmantel noch geschützten Eileiter und das Rektum, sowie die ahlagereifen Eier,
deren Chorion die Bakterien nicht zu durchdringen vermochten. Wahrscheinlich war das
Tier bei seiner Erbeutung schon dem Tode nahe. Von den Mycetomen ist natürlich auch
nichts mehr erhalten. Dieser Fall ist ein erneuter Gegenbeweis für die Theorie, die den
Sinn der symbiontischen Gemeinschaft in einer Immunisierung des Wirtes gegen fremde
Mikroorganismen sucht.
Eng an die Gruppe A, vielleicht ihr ganz zugehörig, schließt sich die Form Ad, die den ijlliehen Symbiontenbestands
aufweist und nur in einzelnen Punkten abweioht. Ihr R e k t a l o r g a n besteht aus nur d r ii rundlichen Mycetocyten, die
locker in einer fast kugeligen Blase des Rektumeplthels ein Stück hinter der leeren Valvula gelegen sind (Abb. 69);
in diesem letzten Punkt zur RcGruppe überleitend. Jede Mycetocyte ist yoij einem kernreichen, sehr dünnen Epithel umhüllt
und besitzt nur e i n e n rundlichen Kern, der urnenförmig, fast zu einer Hohlkugel ausgehöhlt ist. Die: Symbiön-
ten sind kurze Schläuche.
In den langgewundenen, wurstförmigen Schläuchen des paarigen X- Or g a n s umgibt das Wirtsplasma schon netzartig
jeden der großen, plumppolygonalen Symbionten mit einer Alveole, während die großen, chromatinreichen Kerne
nur im Wandplasma zu finden sind.
Die paarigen gedrungenen f -Or g a n e bestehen aus wenigen, ca. 5, sehr großen, einkernigen Mycetocyten, die
von einem fast kubischen Epithel umhüllt werden.
Bei dem einzigen zur Verfügung stehenden Tier ist das Lumen des Darmtraktus von
kokkenförmigen Bakterien überschwemmt, die sich vor allem in den Mitteldarmkrypten
zu dichten zooglöenartigen Verbänden anhäufen, niemals aber in den Darmzellen selbst
oder auch außerhalb des Darmes auf treten. Da ich sie auch bei der Eiinfektion nicht antraf,
dürfte es sich wohl um einen harmlosen Kommensalen handeln, der sicherlich auch
nicht regelmäßig in allen Individuen auftritt.
Die Infektion verläuft nach dem Derbinenmodus. Der Symbiontenballen ist rundlich
abgeplattet und enthält Vertreter des Rektalorgans in dichter Lagerung.
Die Gr u p p e B wird nur durch Paranisia vertreten, die in ihren symbiontischen Einrichtungen
stark an die Gruppe B unter den Derbinen erinnert.
Das R e k t a l o r g a n liegt wie bei diesen extra valvulär ein Stück hinter der Valvula
der Darm wand an; die ca. 5 Mycetocyten ordnen sich hintereinander. Jede besitzt zwei
große eckige, schwach gelappte Kerne und beherbergt kleine, gebogene Schläuche, die an
der Oberfläche ihrer Wirtszellen zahlreiche dunklere und fast doppelt so große Infektionsformen
ausbilden, die nach Durchdringen der Epithelien und der Rektumwand in die
Leibeshöhle abwandern.
Die paarigen, gedrungen sackförmigen X-O r g a n e entsprechen dem Derbidentyp
(Abb. 70). Das Wirtsplasma bildet ein grobmaschiges Netzwerk, so daß jeder der rundlich
polygonalen Symbionten in einer Alveole abgeschlossen bleibt. Die großen Kerne strek-
ken sich auf den zentralen Plasmaspangen zu langen, schwach verzweigten Lappen, während
das Randplasma höchstens größere Tracheen enthält. Das Symbiontenplasma ist auffallend
hell und locker und enthält mehrere, mit Eosin knallrot gefärbte Granula verschiedener
Größe.
Die Wanderformen der Rektalsymbionten treffen sich bei der I n f e k t i o n der Ovarialeier
in dem flachen, höchstens zweischichtigen Keilzellfollikel, wo sie sich zunächst in
den peripheren Teilen der Zellen ansammeln. Dabei drängen sie die beiden Kerne einer
jeden Keilzelle mehr oder weniger nach dem inneren Zellende, was besonders deutlich auf
einem Querschnitt durch die Ovariole in der Höhe des Keilzellfollikels zum Ausdruck
kommt (Abb. 71 a). E rst später wandern die Symbionten, meist einreihig hintereinander
nach innen und treten dann bald in den flachen Hohlraum über, der sich am unteren Eipol
gebildet hat. Der Symbiontenballen weist wieder halbkugelige Form auf und ist dicht
mit Symbionten gefüllt (Abb. 71b).
Zur Gr u p p e C wäre die von B ü c h n e r untersuchte Nisia atrovenosa zu stellen, die
in paarigen syncytialen Fettgewebszonen einen hefeartigen Symbionten beherbergt. Obwohl
eine epitheliale Umhüllung noch fehlt, ist hier eine organartige Konzentration der
Symbionten schon angebahnt. F-Organe wurden nicht festgestellt.
Wenn wir abschließend noch einmal die Unterfamilien der Derbiden und ihre Symbiosen
überschauen, so fällt, sofern wir von den abseits zu stellenden konvergenten Formen
absehen, die Parallelität der Organisationsgruppen auf, die fast zu der Annahme
zwingt, daß es sich hier um zwei konvergente Reihen handelt. Bei einer dringend notwendig
erscheinenden Revision dieser Gruppe wäre deshalb zu erwägen, ob nicht die bestehenden
Unterfamilien der Derbinen und Meenoplinen aufzulösen und entsprechend
ihrer Symbiose eine Neueinteilung zu versuchen wäre, wobei dann die A-Gruppen die
B-Gruppen und die C-Gruppen jeweils in e i n e r Untergliederung vereint werden müßten.
Kann aber die Systematik die durch die Symbiose gewonnenen Gruppen nicht bestätigen,
so wäre wenigstens für die Theorien über die Entwicklung der symbiontischen
Einrichtungen in benachbarten Unterfamilien ein wertvoller Anhaltspunkt gewonnen.
Am charakteristischsten und zentralsten erscheinen die monosymbiontischen B-Gruppen,
während die abgewandelten A-Gruppen heterogenere Formen enthalten. Wird das
Fettgewebe als Symbiontenwohnstätte gewählt, so tritt eine starke Neigung zu + organartiger
Bindung in paarigen Syncytien auf (Dnc, Dn0, Fla; Nisia atrovenosa). Insofern ist
die Besiedlung mit Hefen nicht ohne weiteres mit ähnlichen Fällen in anderen Familien
zu vergleichen und das Fehlen der f-Organe, die sonst konstante Begleiter der Hefen sind,
in diesen Fällen nicht so verwunderlich.
X-Organe und Rel^talorgane zeigen eine ganz charakteristische Prägung, die nur bei
den Delphaciden wieder in ähnlicher Form auftritt.
c) 3. Familie Phalaenomorphidae und 4. Familie Flatidae.
Bei seiner Neueinteilung der Homoptera-Cicadina gründete H. H a u p t mit schon im
MELiCHAR’schen System abseits stehenden Gattungen der Flatiden die neue Familie der
Phalaenomorphidae, betont aber selbst, daß sich über ihre Berechtigung streiten ließe.
Da ich nun bei der Durchmusterung der symbiontischen Verhältnisse dreier mir vorliegender
Vertreter dieser Familie gegenüber den Einrichtungen der Flatiden keine wesentlichen
Unterschiede finden konnte, sollen beide Familien zusammen behandelt und damit zu