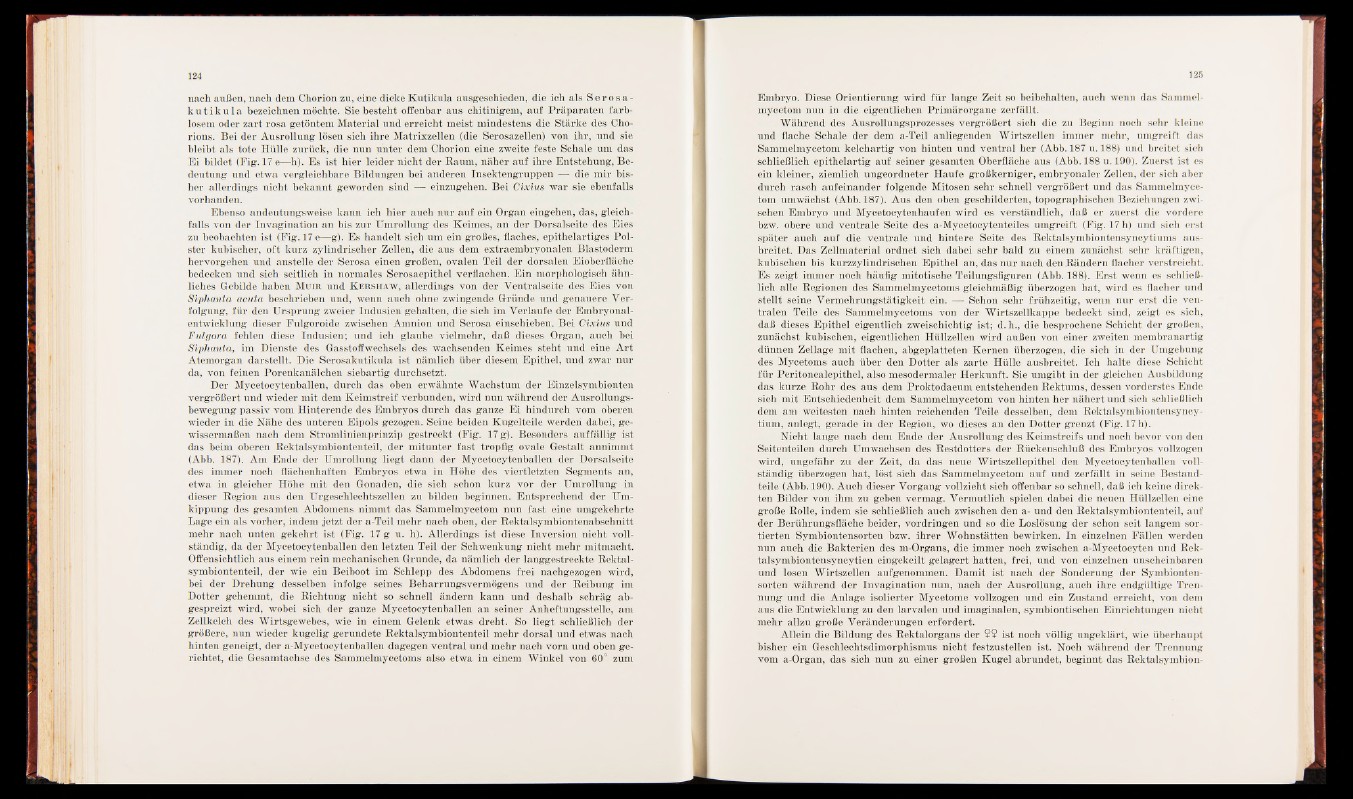
nach außen, nach dem Chorion zu, eine dicke K utikula ausgeschieden, die ich als S e r o s a -
k u t i k u l a bezeichnen möchte. Sie besteht offenbar aus chitinigem, auf Präparaten farblosem
oder zart rosa getöntem Material und erreicht meist mindestens die Stärke des Chorions.
Bei der Ausrollung lösen sich ihre Matrixzellen (die Serosazellen) von ihr, und sie
bleibt als tote Hülle zurück, die nun unter dem Chorion eine zweite feste Schale um das
Ei bildet (Fig. 17 e—h). Es ist hier leider nicht der Raum, näher auf ihre Entstehung, Bedeutung
und etwa vergleichbare Bildungen hei anderen Insektengruppen — die mir bisher
allerdings nicht bekannt geworden sind — einzugehen. Bei Cixius war sie ebenfalls
vorhanden.
Ebenso andeutungsweise kann ich hier auch nur auf ein Organ eingehen, das, gleichfalls
von der Invagination an bis zur Umrollung des Keimes, an der Dorsalseite des Eies
zu beobachten ist (Fig. 17 e—g). Es handelt sich um ein großes, flaches, epithelartiges Polster
kubischer, oft kurz zylindrischer Zellen, die aus dem extraembryonalen Blastoderm
hervorgehen und anstelle der Serosa einen großen, ovalen Teil der dorsalen Eioberfläche
bedecken und sich seitlich in normales Serosaepithel verflachen. Ein morphologisch ähnliches
Gebilde haben M u i r und K e r s h a w , allerdings von der Yentralseite des Eies von
Siphanta acuta beschrieben und, wenn auch ohne zwingende Gründe und genauere Verfolgung,
für den Ursprung zweier Indusien gehalten, die sich im Verlaufe der Embryonalentwicklung
dieser Fulgoroide zwischen Amnion und Serosa einschieben. Bei Cixius und
Fulgora fehlen diese Indusien; und ich glaube vielmehr, daß dieses Organ, auch bei
Siphanta, im Dienste des Gasstoffwechsels des wachsenden Keimes steht und eine Art
Atemorgan darstellt. Die Serosakutikula ist nämlich über diesem Epithel, und zwar nur
da, von feinen Porenkanälchen siebartig durchsetzt.
Der Mycetocytenballen, durch das oben erwähnte Wachstum der Einzelsymbionten
vergrößert und wieder mit dem Keimstreif verbunden, wird nun während der Ausrollungsbewegung
passiv vom Hinterende des Embryos durch das ganze Ei hindurch vom oberen
wieder in die Nähe des unteren Eipols gezogen. Seine beiden Kugelteile werden dabei, gewissermaßen
nach dem Stromlinienprinzip gestreckt (Fig. 17 g). Besonders auffällig ist
das beim oberen Rektalsymbiontenteil, der mitunter fast tropfig ovale Gestalt annimmt
(Abb. 187). Am Ende der Umrollung liegt dann der Mycetocytenballen der Dorsalseite
des immer noch flächenhaften Embryos etwa in Höhe des viertletzten Segments an,
etwa in gleicher Höhe mit den Gonaden, die sich schon kurz vor der Umrollung in
dieser Region aus den Urgeschlechtszellen zu bilden beginnen. Entsprechend der Umkippung
des gesamten Abdomens nimmt das Sammelmycetom nun fast eine umgekehrte
Lage ein als vorher, indem jetzt der a-Teil mehr nach oben, der Rektalsymbiontenabschnitt
mehr nach unten gekehrt ist (Fig. 17 g u. h). Allerdings ist diese Inversion nicht vollständig,
da der Mycetocytenballen den letzten Teil der Schwenkung nicht mehr mitmacht.
Offensichtlich aus einem rein mechanischen Grunde, da nämlich der langgestreckte Rektalsymbiontenteil,
der wie ein Beiboot im Schlepp des Abdomens frei nachgezogen wird,
bei der Drehung desselben infolge seines Beharrungsvermögens und der Reibung im
Dotter gehemmt, die Richtung nicht so schnell ändern kann und deshalb schräg abgespreizt
wird, wobei sich der ganze Mycetocytenballen an seiner Anheftungsstelle, am
Zellkelch des Wirtsgewehes, wie in einem Gelenk etwas dreht. So liegt schließlich der
größere, nun wieder kugelig gerundete Rektalsymbiontenteil mehr dorsal und etwas nach
hinten geneigt, der a-Mycetocytenballen dagegen ventral und mehr nach vorn und oben gerichtet,
die Gesamtachse des Sammelmycetoms also etwa in einem Winkel von 60° zum
Embryo. Diese Orientierung wird für lange Zeit so beibehalten, auch wenn das Sammelmycetom
nun in die eigentlichen Primärorgane zerfällt.
Während des Ausrollungsprozesses vergrößert sich die zu Beginn noch sehr kleine
und flache Schale der dem a-Teil anliegenden Wirtszellen immer mehr, umgreift das
Sammelmycetom kelchartig von hinten und ventral her (Abb. 187 u. 188) und breitet sich
schließlich epithelartig auf seiner gesamten Oberfläche aus (Abb. 188 u. 190). Zuerst ist es
ein kleiner, ziemlich ungeordneter Haufe großkerniger, embryonaler Zellen, der sich aber
durch rasch aufeinander folgende Mitosen sehr schnell vergrößert und das Sammelmycetom
umwächst (Abb. 187). Aus den oben geschilderten, topographischen Beziehungen zwischen
Embryo und Mycetocytenhaufen wird es verständlich, daß er zuerst die vordere
bzw. obere und ventrale Seite des a-Mycetocytenteiles umgreift (Fig. 17 h) und sich erst
später auch auf die ventrale und hintere Seite des Rektalsymbiontensyncytiums ausbreitet.
Das Zellmaterial ordnet sich dabei sehr bald zu einem zunächst sehr kräftigen,
kubischen bis kurzzylindrischen Epithel an, das nur nach den Rändern flacher verstreicht.
Es zeigt immer noch häufig mitotische Teilungsfiguren (Abb. 188). Erst wenn es schließlich
alle Regionen des Sammelmycetoms gleichmäßig überzogen hat, wird es flacher und
stellt seine Vermehrungstätigkeit ein. — Schon sehr frühzeitig, wenn nur erst die ventralen
Teile des Sammelmycetoms von der Wirtszellkappe bedeckt sind, zeigt es sich,
daß dieses Epithel eigentlich zweischichtig ist; d. h., die besprochene Schicht der großen,
zunächst kubischen, eigentlichen Hüllzellen wird außen von einer zweiten membranartig
dünnen Zellage mit flachen, abgeplatteten Kernen überzogen, die sich in der Umgebung
des Mycetoms auch über den Dotter als zarte Hülle ausbreitet. Ich halte diese Schicht
fü r Peritonealepithel, also mesodermaler Herkunft. Sie umgibt in der gleichen Ausbildung
das kurze Rohr des aus dem Proktodaeum entstehenden Rektums, dessen vorderstes Ende
sich mit Entschiedenheit dem Sammelmycetom von hinten her nähert und sich schließlich
dem am weitesten nach hinten reichenden Teile desselben, dem Rektalsymbiontensyncy-
tium, anlegt, gerade in der Region, wo dieses an den Dotter grenzt (Fig. 17 h).
Nicht lange nach dem Ende der Ausrollung des Keimstreifs und noch bevor von den
Seitenteilen durch Umwachsen des Restdotters der Rückenschluß des Embryos vollzogen
wird, ungefähr zu der Zeit, da das neue Wirtszellepithel den Mycetocytenballen vollständig
überzogen hat, löst sich das Sammelmycetom auf und zerfällt in seine Bestandteile
(Abb. 190). Auch dieser Vorgang vollzieht sich offenbar so schnell, daß ich keine direkten
Bilder von ihm zu geben vermag. Vermutlich spielen dabei die neuen Hüllzellen eine
große Rolle, indem sie schließlich auch zwischen den a- und den Rektalsymbiontenteil, auf
der Berührungsfläche beider, Vordringen und so die Loslösung der schon seit langem sortierten
Symbiontensorten bzw. ihrer Wohnstätten bewirken. In einzelnen Fällen werden
nun auch die Bakterien des m-Organs, die immer noch zwischen a-Mycetocyten und Rek-
talsymbiontensyncytien eingekeilt gelagert hatten, frei, und von einzelnen unscheinbaren
und losen Wirtszellen auf genommen. Damit ist nach der Sonderung der Symbiontensorten
während der Invagination nun, nach der Ausrollung, auch ihre endgültige Trennung
und die Anlage isolierter Mycetome vollzogen und ein Zustand erreicht, von dem
aus die Entwicklung zu den larvalen und imaginalen, symbiontischen Einrichtungen nicht
mehr allzu große Veränderungen erfordert.
Allein die Bildung des Rektalorgans der 99 ist noch völlig ungeklärt, wie überhaupt
bisher ein Geschlechtsdimorphismus nicht festzustellen ist. Noch während der Trennung
vom a-Organ, das sich nun zu einer großen Kugel abrundet, beginnt das Rektalsymbion