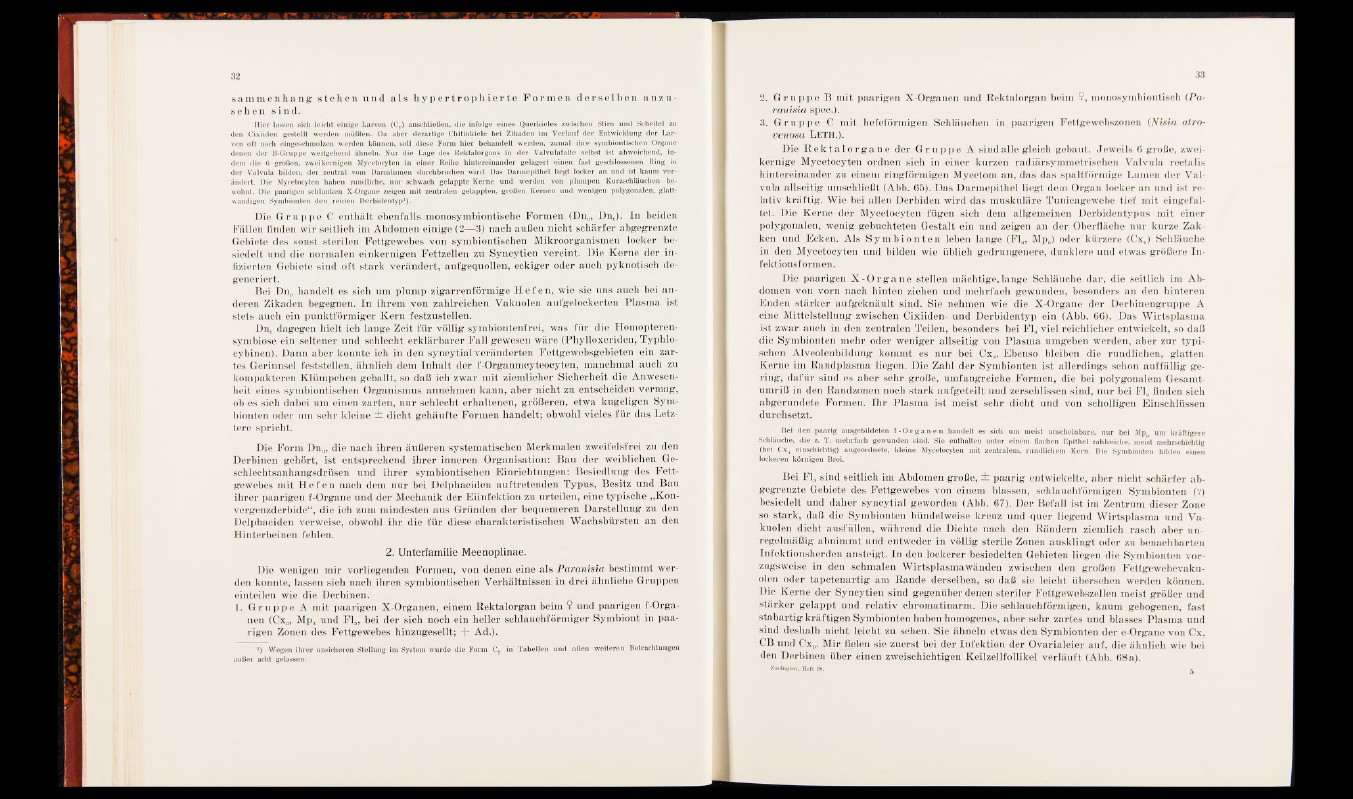
s am me n h a n g s t e h e n u n d a l s h y p e r t r o p h i e r t e F o rme n d e r s e l b e n a n z u s
e h e n sind.
Hier lassen sich leicht einige Larven (Cy) anschließen, die infolge eines Querkieles zwischen Stirn und Scheitel zu
den Cixiiden gestellt werden müßten. Da aber derartige Chitinkiele bei Zikaden im Verlauf der Entwicklung der Larven
oft noch eingeschmolzen werden können, soll diese Form hier behandelt werden, zumal ihre symbiontischen Organe
denen der B-Gruppe weitgehend ähneln. Nur die Lage des Rektalorgans in der Valvulafalte selbst ist abweichend, indem
die 6 großen, zweikernigen Mycetocyten in einer Reihe hintereinander gelagert einen fast geschlossenen Ring in
der Valvula bilden, der zentral vom Darmlumen durchbrochen wird. Das Darmepithel liegt locker an und ist kaum verändert.
Die Mycetocyten haben rundliche, nur schwach gelappte Kerne und werden von plumpen Kurzschläuchen bewohnt.
Die paarigen schlanken X-Organe zeigen mit zentralen gelappten, großen Kernen und wenigen polygonalen, glatt-
wandigen Symbionten den reinen Derbidentyp1).
Die Gr u p p e C enthält ebenfalls monosymbiontische Formen (Dn0, Dnc). In beiden
Fällen finden wir seitlich im Abdomen einige (2—3) nach außen nicht schärfer abgegrenzte
Gebiete des sonst sterilen Fettgewebes von symbiontischen Mikroorganismen locker besiedelt
und die normalen einkernigen Fettzellen zu Syncytien vereint. Die Kerne der infizierten
Gebiete sind oft stark verändert, aufgequollen, eckiger oder auch pyknotiscb degeneriert.
Bei Dn0 handelt es sich um plump zigarrenförmige He f en, wie sie uns auch bei anderen
Zikaden begegnen. In ihrem von zahlreichen Vakuolen aufgelockerten Plasma ist
stets auch ein punktförmiger Kern festzustellen.
Dnc dagegen hielt ich lange Zeit für völlig symbiontenfrei, was für die Homopteren-
symbiose ein seltener und schlecht erklärbarer Fall gewesen wäre (Phylloxeriden, Typhlo-
cyhinen). Dann aber konnte ich in den syncytial veränderten Fettgewebsgehieten ein zartes
Gerinnsel feststellen, ähnlich dem Inhalt der f-Organmcyteocyten, manchmal auch zu
kompakteren Klümpchen geballt, so daß ich zwar mit ziemlicher Sicherheit die Anwesenheit
eines symbiontischen Organismus annehmen kann, aber nicht zu entscheiden vermag,
ob es sich dabei um einen zarten, nur schlecht erhaltenen, größeren, etwa kugeligen Symbionten
oder um sehr kleine ± dicht gehäufte Formen handelt; obwohl vieles für das Letztere
spricht.
Die Form Dnq, die nach ihren äußeren systematischen Merkmalen zweifelsfrei zu den
Derbinen gehört, ist entsprechend ihrer inneren Organisation: Bau der weiblichen Geschlechtsanhangsdrüsen
und ihrer symbiontischen Einrichtungen: Besiedlung des Fettgewebes
mit H e f e n nach dem nur bei Delphaciden auftretenden Typus, Besitz und Bau
ihrer paarigen f-Organe und der Mechanik der Eiinfektion zu urteilen, eine typische „Kon-
vergenzderbide“, die ich zum mindesten aus Gründen der bequemeren Darstellung zu den
Delphaciden verweise, obwohl ihr die für diese charakteristischen Wachshürsten an den
Hinterbeinen fehlen.
2. Unterfamilie Meenoplinae.
Die wenigen mir vorliegenden Formen, von denen eine als Paranisia bestimmt werden
konnte, lassen sich nach ihren symbiontischen Verhältnissen in drei ähnliche Gruppen
einteilen wie die Derbinen.
1. Gr u p p e A mit paarigen X-Organen, einem Rektalorgan beim $ und paarigen f-Orga-
nen (Cxa, Mpa und Fla, bei der sich noch ein heller schlauchförmiger Symbiont in paarigen
Zonen des Fettgewebes hinzugesellt; + Ad.).
Wegen ihrer unsicheren Stellung im System wurde die Form Cy in Tabellen und allen weiteren Betrachtungen
außer acht gelassen.
2. Gr u p p e B mit paarigen X-Organen und Rektalorgan beim $, monosymbiontisch (Paranisia
spec.).
3. Gr u p p e C mit hefeförmigen Schläuchen in paarigen Fettgewebszonen (Nisia atro-
venosa L e t h .).
Die R e k t a l o r g a n e der Gr u p p e A sind alle gleich gebaut. Jeweils 6 große, zweikernige
Mycetocyten ordnen sich in einer kurzen radiärsymmetrischen Valvula rectalis
hintereinander zu einem ringförmigen Mycetom an, das das spaltförmige Lumen der Valvula
allseitig umschließt (Abb. 65). Das Darmepithel liegt dem Organ locker an und ist relativ
kräftig. Wie bei allen Derbiden wird das muskuläre Tunicagewebe tief mit eingefaltet.
Die Kerne der Mycetocyten fügen sich dem allgemeinen Derbidentypus mit einer
polygonalen, wenig gebuchteten Gestalt ein und zeigen an der Oberfläche nur kurze Zak-
ken und Ecken. Als S ymb i o n t e n leben lange (Fla, Mpa) oder kürzere (Cxa) Schläuche
in den Mycetocyten und bilden wie üblich gedrungenere, dunklere und etwas größere In fektionsformen.
Die paarigen X-O r g a n e stellen mächtige,lange Schläuche dar, die seitlich im Abdomen
von vorn nach hinten ziehen und mehrfach gewunden, besonders an den hinteren
Enden stärker aufgeknäult sind. Sie nehmen wie die X-Organe der Derbinengruppe A
eine Mittelstellung zwischen Cixiiden- und Derbidentyp ein (Abb. 66). Das Wirtsplasma
ist zwar auch in den zentralen Teilen, besonders bei Fla viel reichlicher entwickelt, so daß
die Symbionten mehr oder weniger allseitig von Plasma umgeben werden, aber zur typischen
Alveolenbildung kommt es nur bei Cxa. Ebenso bleiben die rundlichen, glatten
Kerne im Randplasma liegen. Die Zahl der Symbionten ist allerdings schon auffällig gering,
dafür sind es aber sehr große, umfangreiche Formen, die bei polygonalem Gesamtumriß
in den Randzonen noch stark aufgeteilt und zerschlissen sind, nur bei Fla finden sich
abgerundete Formen. Ih r Plasma ist meist sehr dicht und von scholligen Einschlüssen
durchsetzt.
Bei den paarig ausgebildeten f - 0 r g a n e n handelt es sich um meist unscheinbare, nur bei Mpa um kräftigere
Schläuche, die z. T. mehrfach gewunden sind. Sie enthalten unter einem flachen Epithel zahlreiche, meist mehrschichtig
(bei Cxa einschichtig) angeordnete, kleine Mycetocyten mit zentralem, rundlichem Kern. Die Symbionten bilden einen
lockeren körnigen Brei.
Bei Fla sind seitlich im Abdomen große, ± paarig entwickelte, aber nicht schärfer abgegrenzte
Gebiete des Fettgewebes von einem blassen, schlauchförmigen Symbionten (7)
besiedelt und daher syncytial geworden (Abb. 67). Der Befall ist im Zentrum dieser Zone
so stark, daß die: Symbionten bündelweise kreuz und quer liegend Wirtsplasma und Vakuolen
dicht ausfüllen, während die Dichte nach den Rändern ziemlich rasch aber unregelmäßig
abnimmt und entweder in völlig sterile Zonen ausklingt oder zu benachbarten
Infektionsherden ansteigt. In den lockerer besiedelten Gebieten liegen die Symbionten vorzugsweise
in den schmalen Wirtsplasmawänden zwischen den großen Fettgewebevakuolen
oder tapetenartig am Rande derselben, so daß sie leicht übersehen werden können.
Die Kerne der Syncytien sind gegenüber denen steriler Fettgewebszellen meist größer und
stärker gelappt und relativ chromatinarm. Die schlauchförmigen, kaum gebogenen, fast
stabartig kräftigen Symbionten haben homogenes, aber sehr zartes und blasses Plasma und
sind deshalb nicht leicht zu sehen. Sie ähneln etwas den Symbionten der e-Organe von Cx,
CB und Cx„. Mir fielen sie zuerst bei der Infektion der Ovarialeier auf, die ähnlich wie bei
den Derbinen über einen zweischichtigen Keilzellfollikel verläuft (Abb. 68 a).
Zoologica, Heft 98. |